«Boutique Gélatine» Basel: Im Gespräch mit Mia Brunner
Die «Boutique Gélatine» ist ein einladender Schmuckladen in der Basler Altstadt, der mit hochwertigem Mode- und Silberschmuck Vielfalt lebt und allen Menschen Raum bietet, etwas Passendes und Persönliches zu finden. Gegründet von ihrer Mutter, wird der Laden von Mia Brunner mit viel Feingefühl und Aufmerksamkeit geführt. Im Gespräch erfahren wir, was es für sie persönlich bedeutet hat, die Boutique zu übernehmen, welche Rolle die sorgfältig ausgewählten Schmuckstücke und der persönliche Austausch mit den Kund*innen spielen und was es für sie heisst, in der Basler Altstadt am Spalenberg zu arbeiten.
![]()
Liebe Mia, wie würdest du dich selbst beschreiben und was ist deine grösste Macke?
Ich würde mich selbst beschreiben als offener und kommunikativer Mensch mit viel Lebensfreude. Ich mag es laut, ich mag es bunt. Meine grösste Macke ist, dass ich immer in dieser Schnelligkeit lebe und in diesem Drive und wahnsinnig Mühe habe zu bremsen und langsamer zu machen. Weil ich irgendwie alles mitnehmen möchte, was kommt und ist und intensiv leben möchte. Und ich glaube, ich muss noch mehr lernen, mehr zu entschleunigen.
![]()
«Boutique Gélatine» – Was finden wir hier und wie ist die Boutique entstanden?
Die «Boutique Gélatine» ist ein wunderschöner Laden in der Basler Altstadt am Spalenberg. Und wir verkaufen hochwertigen Modeschmuck und Silberschmuck. Das Ziel ist, für alle etwas zu haben. Also dass jeder reinkommen kann und etwas findet, was zu einem passt. Wir möchten wirklich vielseitig ansprechen und auch vielseitig Freude verbreiten können. Die Geschichte der «Boutique Gélatine» ist auch etwas, was uns wahnsinnig stolz macht. Wir sind nämlich ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Und das hat «Mama Mia» gegründet (Lacht), also meine Mutter Christine Brunner, und das war vor 40 Jahren. Dieses Jahr haben wir unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das ist damals entstanden, das hat sie mit ihrem damaligen Lebenspartner gegründet. Sie haben lange Grosshandel betrieben und haben Geschäfte mit den neuesten Accessoires und Schmuck beliefert. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass ein cooles Geschäft in Basel fehlt. Damals gab es nur echte Goldschmiede mit echtem Schmuck, sozusagen. Ich mag den Ausdruck nicht, echten Schmuck. Es ist echtes Gold gemeint. Und dann war das Ziel, dass sie hier auch einen tollen Laden schaffen, wo die Leute einkaufen gehen können. Das war wirklich auch der erste seiner Art in Basel, der auch hohe Wellen geschlagen hat. Seit 40 Jahren gibt es die «Boutique Gélatine». Und auf den Namen, das werde ich ganz oft gefragt, warum «Gélatine». Der Name kommt daher, weil es etwas Formbares und Veränderbares ist, Gélatine. Es entwickelt sich weiter, man kann es formen und einfärben. Der Name bleibt in den Köpfen hängen und deshalb ist es ein guter Name.
![]()
Welche Prägungen und Werte aus der Zusammenarbeit mit deiner Mutter haben dich als Mensch besonders beeinflusst und wo gehst du bewusst eigene Wege?Ich sehe ja diesen Laden wie meine grosse Schwester, weil er war immer da. Schon als ich aufgewachsen bin, war der Laden immer da und ich habe ja wie alle Höhen und Tiefen miterlebt. Ich habe auch schon ganz früh erfahren, was Selbstständigkeit bedeutet und auch, wie hart man committed sein muss, um selbstständig sein zu können und auch zu wollen. Und das war meine Mama. Und ich glaube, das sind die Werte, die ich auch von ihr gelernt habe. Dieses harte Arbeiten und das sich ständig weiterentwickeln und nicht stehen zu bleiben und dieses Vorantreiben. Dieses Stark-Sein und sein eigener Chef zu sein und dieses auch stolz sein zu können, dass man das kann. Und das ist so viel wert.
![]()
Als sie mich gefragt hat, ob ich den Laden übernehmen wollte, habe ich ganz lange gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte unbedingt meinen eigenen Weg gehen. Und dann habe ich angefangen zu studieren, war aber nie glücklich mit meinem Werdegang, mit meiner Studienwahl und so weiter. Ich habe nebenbei immer im Verkauf gearbeitet. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich viel lieber arbeite als studiere und dass ich auch den Verkauf und den Menschenkontakt sehr schätze. Dann hat meine Mama noch mal gefragt: «Ich gehe jetzt bald in Rente, möchtest du den Laden oder möchtest du ihn nicht?». Und dann war ganz klar, dass ich das machen möchte. Ich möchte auch nicht an diesem Ort vorbeigehen und es ist nicht mehr unser Geschäft. Ich finde, in dieser Ecke von Basel gehört die «Gélatine». Meine Mutter kann mir Tipps und Tricks geben, die auch sehr kostbar für mich sind. Aber meine Bedingung war, dass ich es machen kann, wie ich möchte und es auch zu meinem eigenen machen kann. Und deshalb habe ich es auch umgebaut, so wie es mir gefällt und es zu meinem eigenen gemacht. Ich sehe uns aber, obwohl ich jetzt die eigene Chefin bin und meine Mama bei mir angestellt ist, immer noch als Familienbetrieb. Was mich so stolz macht, ist, dass trotz Generationenwechsel die Kund*innen meiner Mama behalten konnte und auch neue Generationen hinzukamen. Es kommen von Kindern bis Menschen mit Rollator in den Laden. Jeder Mensch ist willkommen.
![]()
Welche Rolle spielen Beziehungen und Begegnungen für dich generell – beruflich wie privat?
Oh, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, das muss es auch, damit man gerne im Verkauf arbeitet. Und ich arbeite sehr gerne im Verkauf. Ich finde es wunderschön, dass auch jede Begegnung anders ist. Und dass man gerade im Verkauf auch auf jede*n anders eingehen kann. Ich habe vorher schon erwähnt, dass wir alles an Kunden und Kundinnen haben. Und ich genau das finde, was meinen Job so schön macht, so individuell auch macht. Dass auch kein Tag ist wie der andere. Also ich mag gerne Menschen und ich kommuniziere sehr gerne mit Menschen.
![]()
Genau so ist es im Privaten. Mein Instagram-Status ist «Consider me a social butterfly» (Lacht). Und ich glaube, genau so ist es. Natürlich gibt es auch negative Begegnungen, aber hauptsächlich sind sie positiv. Und ja, deshalb freue ich mich über jede*n Einzelne*n. Es gibt ja viele Menschen, die arbeiten und die brauchen ihre Ruhe oder sitzen halt im Büro. Und ich kann mich nicht zurückziehen. Das ist etwas, was man wirklich lernen muss, immer so exponiert zu sein. Und für alle erreichbar auch zu sein. Auch immer einigermassen parat auszusehen, weil alle vorbeikommen.
![]()
Was lernst du durch die Menschen, die zu dir kommen, über dich selbst?Bei mir kommen die Leute ja viel, um sich zu belohnen. Oder auch, wenn sie einen schlechten Tag haben und sich was Gutes tun wollen. Und was ich gelernt habe, was mich auch sehr stolz macht, ist, dass ich diese Atmosphäre schaffen kann, wo das funktioniert. Dass ich einen Wohlfühlort bieten kann und auch sein kann. Aber Kund*innen lehren mich auch Geduld.
![]()
Wie nimmst du die Atmosphäre in der Basler Altstadt wahr, was gibt dir dieser Ort?
Der Ort gibt mir super viel. Ich freue mich, jeden Morgen arbeiten zu gehen. Gerade wenn ich den Spalenberg hochlaufe, dann macht es mich wahnsinnig stolz, dort ein Geschäft zu haben. Weil ich es einfach eine wunderschöne Umgebung finde, um zu arbeiten. Und natürlich auch eine sehr gute Lage, um ein Geschäft zu haben. Ich liebe die Basler Altstadt. Die Atmosphäre, auch dieses Entschleunigte am Spalenberg, wenn man unten in der Stadt ist und dann den Berg hochgeht. Und auch dieses gezielte Lädele stattfindet, dieses Entschleunigte finde ich sehr schön am Spalenberg. Und ich liebe Basel. Ich will nirgendwo anders leben als in Basel. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und fühle mich nach wie vor sehr wohl. Auch die Menschen nehme ich als sehr aufgeschlossen und unkompliziert wahr. Und es ist nicht zu gross, nicht zu klein.
![]()
Welche Orte in Basel sind dir ganz persönlich wichtig, weil sie dich inspirieren oder dir Kraft geben?
Gerade im Winter, wenn es kälter und dunkler wird, mag ich den Botanischen Garten und das Tropenhaus sehr als Kraftorte. Das ist, finde ich, so ein superschöner Ort in Basel, um auch kurz wieder Wärme zu tanken an kalten Tagen. Er ist so klein, fein und oft auch ruhig. Inspiration natürlich, ich muss ja auch immer kreativ sein mit dem Laden. Und darum finde ich halt auch, das in der Altstadt rumlaufen und sich die verschiedenen dekorierten Fenster angucken sehr toll. Da hole ich auch sehr viel Inspiration. Auch bei den anderen, schauen, was da so läuft. Und ich finde es auch nach wie vor schön, dass sie sehr viel auch mir geben bei den Schaufenstern. Dieses Schaufenster-Shopping in Basel mache ich sehr gerne.
![]()
40 Jahre «Gélatine Boutique» – was bedeutet so ein Jubiläum für dich als Mensch, der Teil dieser Geschichte ist?
40 Jahre machen einen natürlich wahnsinnig stolz, obwohl ich ja erst seit fünf Jahren davon Eigentümerin bin. Es macht mich wahnsinnig stolz einfach, dass das funktioniert. Seit 40 Jahren, dass wir nicht stehen geblieben sind, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass die Leute immer noch Freude haben, zu uns zu kommen. Nach 40 Jahren steht ja meine Mama immer noch im Laden und macht das immer noch gerne, und das ist wahnsinnig. Weil ich glaube, in den letzten vierzig Jahren hat es viele Höhen und Tiefen gegeben. Und es ist ja ein stetiges Ausprobieren und Weiterentwickeln und ja, das gibt mir wahnsinnig viel. Auch hatten wir eine Party zu unserem 40-jährigen Jubiläum und da war zu sehen, dass für einen so kleinen Laden so viele Leute gekommen sind, das hat mir und meiner Mutter die Welt bedeutet. Wir waren so glücklich, dass wir gesehen werden und dass die Leute Lust haben, mit uns zu feiern. Ja, wahnsinnig stolz, also ich hoffe auf weitere 40 Jahre (Lacht).
![]()
Welche Wünsche oder Ziele hast du für dich selbst in den nächsten Jahren jenseits der Arbeit?
Ich bin ja einfach froh, wenn es so weiterläuft wie bisher. Wenn die Leute weiterhin, also vor allem die Kund*innen, weiterhin so viel Freude am Laden haben wie bisher. Und das Wichtigste ist, dass auch ich weiterhin so gerne mache wie jetzt. Konkrete Wünsche und Ziele habe ich wie keine, weil es stetig in Veränderung ist und ich mir immer wieder was Neues einfallen lasse. Aber das passiert meistens sehr, sehr spontan.
Für mich persönlich glaube ich an dieses Entschleunigen. Als Selbstständige die Work-Life-Balance zu finden. Da muss ich noch viel dran arbeiten, und das ist auch okay. Das sind meine Wünsche und Ziele: dass es den Laden gibt, aber auch eine «Mia privat».
![]()
Wie wär’s mal mit...
...lauterem und buntem Schmuck auch im Alltag?
Danke an Mia Brunner für das offene Gespräch und den ehrlichen Austausch sowie das Engagement, Leidenschaft und das Leben von echten Begegnungen.
_
von Ada Neguer
am 02.02.2026
Fotos
© Ada Neguer für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Liebe Mia, wie würdest du dich selbst beschreiben und was ist deine grösste Macke?
Ich würde mich selbst beschreiben als offener und kommunikativer Mensch mit viel Lebensfreude. Ich mag es laut, ich mag es bunt. Meine grösste Macke ist, dass ich immer in dieser Schnelligkeit lebe und in diesem Drive und wahnsinnig Mühe habe zu bremsen und langsamer zu machen. Weil ich irgendwie alles mitnehmen möchte, was kommt und ist und intensiv leben möchte. Und ich glaube, ich muss noch mehr lernen, mehr zu entschleunigen.

«Boutique Gélatine» – Was finden wir hier und wie ist die Boutique entstanden?
Die «Boutique Gélatine» ist ein wunderschöner Laden in der Basler Altstadt am Spalenberg. Und wir verkaufen hochwertigen Modeschmuck und Silberschmuck. Das Ziel ist, für alle etwas zu haben. Also dass jeder reinkommen kann und etwas findet, was zu einem passt. Wir möchten wirklich vielseitig ansprechen und auch vielseitig Freude verbreiten können. Die Geschichte der «Boutique Gélatine» ist auch etwas, was uns wahnsinnig stolz macht. Wir sind nämlich ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Und das hat «Mama Mia» gegründet (Lacht), also meine Mutter Christine Brunner, und das war vor 40 Jahren. Dieses Jahr haben wir unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das ist damals entstanden, das hat sie mit ihrem damaligen Lebenspartner gegründet. Sie haben lange Grosshandel betrieben und haben Geschäfte mit den neuesten Accessoires und Schmuck beliefert. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass ein cooles Geschäft in Basel fehlt. Damals gab es nur echte Goldschmiede mit echtem Schmuck, sozusagen. Ich mag den Ausdruck nicht, echten Schmuck. Es ist echtes Gold gemeint. Und dann war das Ziel, dass sie hier auch einen tollen Laden schaffen, wo die Leute einkaufen gehen können. Das war wirklich auch der erste seiner Art in Basel, der auch hohe Wellen geschlagen hat. Seit 40 Jahren gibt es die «Boutique Gélatine». Und auf den Namen, das werde ich ganz oft gefragt, warum «Gélatine». Der Name kommt daher, weil es etwas Formbares und Veränderbares ist, Gélatine. Es entwickelt sich weiter, man kann es formen und einfärben. Der Name bleibt in den Köpfen hängen und deshalb ist es ein guter Name.

Welche Prägungen und Werte aus der Zusammenarbeit mit deiner Mutter haben dich als Mensch besonders beeinflusst und wo gehst du bewusst eigene Wege?Ich sehe ja diesen Laden wie meine grosse Schwester, weil er war immer da. Schon als ich aufgewachsen bin, war der Laden immer da und ich habe ja wie alle Höhen und Tiefen miterlebt. Ich habe auch schon ganz früh erfahren, was Selbstständigkeit bedeutet und auch, wie hart man committed sein muss, um selbstständig sein zu können und auch zu wollen. Und das war meine Mama. Und ich glaube, das sind die Werte, die ich auch von ihr gelernt habe. Dieses harte Arbeiten und das sich ständig weiterentwickeln und nicht stehen zu bleiben und dieses Vorantreiben. Dieses Stark-Sein und sein eigener Chef zu sein und dieses auch stolz sein zu können, dass man das kann. Und das ist so viel wert.

Als sie mich gefragt hat, ob ich den Laden übernehmen wollte, habe ich ganz lange gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte unbedingt meinen eigenen Weg gehen. Und dann habe ich angefangen zu studieren, war aber nie glücklich mit meinem Werdegang, mit meiner Studienwahl und so weiter. Ich habe nebenbei immer im Verkauf gearbeitet. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich viel lieber arbeite als studiere und dass ich auch den Verkauf und den Menschenkontakt sehr schätze. Dann hat meine Mama noch mal gefragt: «Ich gehe jetzt bald in Rente, möchtest du den Laden oder möchtest du ihn nicht?». Und dann war ganz klar, dass ich das machen möchte. Ich möchte auch nicht an diesem Ort vorbeigehen und es ist nicht mehr unser Geschäft. Ich finde, in dieser Ecke von Basel gehört die «Gélatine». Meine Mutter kann mir Tipps und Tricks geben, die auch sehr kostbar für mich sind. Aber meine Bedingung war, dass ich es machen kann, wie ich möchte und es auch zu meinem eigenen machen kann. Und deshalb habe ich es auch umgebaut, so wie es mir gefällt und es zu meinem eigenen gemacht. Ich sehe uns aber, obwohl ich jetzt die eigene Chefin bin und meine Mama bei mir angestellt ist, immer noch als Familienbetrieb. Was mich so stolz macht, ist, dass trotz Generationenwechsel die Kund*innen meiner Mama behalten konnte und auch neue Generationen hinzukamen. Es kommen von Kindern bis Menschen mit Rollator in den Laden. Jeder Mensch ist willkommen.

Welche Rolle spielen Beziehungen und Begegnungen für dich generell – beruflich wie privat?
Oh, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, das muss es auch, damit man gerne im Verkauf arbeitet. Und ich arbeite sehr gerne im Verkauf. Ich finde es wunderschön, dass auch jede Begegnung anders ist. Und dass man gerade im Verkauf auch auf jede*n anders eingehen kann. Ich habe vorher schon erwähnt, dass wir alles an Kunden und Kundinnen haben. Und ich genau das finde, was meinen Job so schön macht, so individuell auch macht. Dass auch kein Tag ist wie der andere. Also ich mag gerne Menschen und ich kommuniziere sehr gerne mit Menschen.

Genau so ist es im Privaten. Mein Instagram-Status ist «Consider me a social butterfly» (Lacht). Und ich glaube, genau so ist es. Natürlich gibt es auch negative Begegnungen, aber hauptsächlich sind sie positiv. Und ja, deshalb freue ich mich über jede*n Einzelne*n. Es gibt ja viele Menschen, die arbeiten und die brauchen ihre Ruhe oder sitzen halt im Büro. Und ich kann mich nicht zurückziehen. Das ist etwas, was man wirklich lernen muss, immer so exponiert zu sein. Und für alle erreichbar auch zu sein. Auch immer einigermassen parat auszusehen, weil alle vorbeikommen.

Was lernst du durch die Menschen, die zu dir kommen, über dich selbst?Bei mir kommen die Leute ja viel, um sich zu belohnen. Oder auch, wenn sie einen schlechten Tag haben und sich was Gutes tun wollen. Und was ich gelernt habe, was mich auch sehr stolz macht, ist, dass ich diese Atmosphäre schaffen kann, wo das funktioniert. Dass ich einen Wohlfühlort bieten kann und auch sein kann. Aber Kund*innen lehren mich auch Geduld.

Wie nimmst du die Atmosphäre in der Basler Altstadt wahr, was gibt dir dieser Ort?
Der Ort gibt mir super viel. Ich freue mich, jeden Morgen arbeiten zu gehen. Gerade wenn ich den Spalenberg hochlaufe, dann macht es mich wahnsinnig stolz, dort ein Geschäft zu haben. Weil ich es einfach eine wunderschöne Umgebung finde, um zu arbeiten. Und natürlich auch eine sehr gute Lage, um ein Geschäft zu haben. Ich liebe die Basler Altstadt. Die Atmosphäre, auch dieses Entschleunigte am Spalenberg, wenn man unten in der Stadt ist und dann den Berg hochgeht. Und auch dieses gezielte Lädele stattfindet, dieses Entschleunigte finde ich sehr schön am Spalenberg. Und ich liebe Basel. Ich will nirgendwo anders leben als in Basel. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und fühle mich nach wie vor sehr wohl. Auch die Menschen nehme ich als sehr aufgeschlossen und unkompliziert wahr. Und es ist nicht zu gross, nicht zu klein.

Welche Orte in Basel sind dir ganz persönlich wichtig, weil sie dich inspirieren oder dir Kraft geben?
Gerade im Winter, wenn es kälter und dunkler wird, mag ich den Botanischen Garten und das Tropenhaus sehr als Kraftorte. Das ist, finde ich, so ein superschöner Ort in Basel, um auch kurz wieder Wärme zu tanken an kalten Tagen. Er ist so klein, fein und oft auch ruhig. Inspiration natürlich, ich muss ja auch immer kreativ sein mit dem Laden. Und darum finde ich halt auch, das in der Altstadt rumlaufen und sich die verschiedenen dekorierten Fenster angucken sehr toll. Da hole ich auch sehr viel Inspiration. Auch bei den anderen, schauen, was da so läuft. Und ich finde es auch nach wie vor schön, dass sie sehr viel auch mir geben bei den Schaufenstern. Dieses Schaufenster-Shopping in Basel mache ich sehr gerne.

40 Jahre «Gélatine Boutique» – was bedeutet so ein Jubiläum für dich als Mensch, der Teil dieser Geschichte ist?
40 Jahre machen einen natürlich wahnsinnig stolz, obwohl ich ja erst seit fünf Jahren davon Eigentümerin bin. Es macht mich wahnsinnig stolz einfach, dass das funktioniert. Seit 40 Jahren, dass wir nicht stehen geblieben sind, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass die Leute immer noch Freude haben, zu uns zu kommen. Nach 40 Jahren steht ja meine Mama immer noch im Laden und macht das immer noch gerne, und das ist wahnsinnig. Weil ich glaube, in den letzten vierzig Jahren hat es viele Höhen und Tiefen gegeben. Und es ist ja ein stetiges Ausprobieren und Weiterentwickeln und ja, das gibt mir wahnsinnig viel. Auch hatten wir eine Party zu unserem 40-jährigen Jubiläum und da war zu sehen, dass für einen so kleinen Laden so viele Leute gekommen sind, das hat mir und meiner Mutter die Welt bedeutet. Wir waren so glücklich, dass wir gesehen werden und dass die Leute Lust haben, mit uns zu feiern. Ja, wahnsinnig stolz, also ich hoffe auf weitere 40 Jahre (Lacht).

Welche Wünsche oder Ziele hast du für dich selbst in den nächsten Jahren jenseits der Arbeit?
Ich bin ja einfach froh, wenn es so weiterläuft wie bisher. Wenn die Leute weiterhin, also vor allem die Kund*innen, weiterhin so viel Freude am Laden haben wie bisher. Und das Wichtigste ist, dass auch ich weiterhin so gerne mache wie jetzt. Konkrete Wünsche und Ziele habe ich wie keine, weil es stetig in Veränderung ist und ich mir immer wieder was Neues einfallen lasse. Aber das passiert meistens sehr, sehr spontan.
Für mich persönlich glaube ich an dieses Entschleunigen. Als Selbstständige die Work-Life-Balance zu finden. Da muss ich noch viel dran arbeiten, und das ist auch okay. Das sind meine Wünsche und Ziele: dass es den Laden gibt, aber auch eine «Mia privat».

Wie wär’s mal mit...
...lauterem und buntem Schmuck auch im Alltag?
Danke an Mia Brunner für das offene Gespräch und den ehrlichen Austausch sowie das Engagement, Leidenschaft und das Leben von echten Begegnungen.
_
von Ada Neguer
am 02.02.2026
Fotos
© Ada Neguer für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Auberge du Mouton» Porrentruy: Im Gespräch mit Samuel Tobler
Im Jura tauchen wir ein in die Welt der «Auberge du Mouton» in Porrentruy, ein Haus, das Persönlichkeit, Charme und Qualität vereint. Mit Samuel Tobler sprechen wir über das Gastgeben aus Leidenschaft, besondere Begegnungen und einen Ort, der entschleunigt und inspiriert.
![]()
Lieber Samuel, wer bist du und welche Macke begleitet dich durch deinen Alltag?
Ich bin Samuel, Gastgeber aus Überzeugung, Detailverliebter und jemand, der gerne Menschen zusammenbringt. Eine kleine Macke von mir: Ich richte Gläser und Stühle fast automatisch gerade, selbst wenn ich privat unterwegs bin. Ganz Gastgeber eben, auch off duty.
![]()
Du bist Geschäftsführer in der «Auberge du Mouton» in Porrentruy. Wie sieht dein Arbeitsalltag im Hotel aus und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich? Wie hat dich dein Weg nach Porrentruy geführt?
Meine Frau Rebecca Leaver und ich führen eine Liste mit Bars, Restaurants, Hotels, die wir gerne einmal besuchen möchten, oftmals sind das kleine Inspirationsreisen. Die Auberge war auch mal Teil dieser Liste, und so haben wir uns, nach einem Geburtstag von Freund*innen, die in der Nähe ihren 30. feierten, in der «Auberge du Mouton» für ein Wochenende einquartiert. Das Haus hat uns mit der Kombination von Restaurant und Hotel und den schönen renovierten Zimmern sehr gut gefallen. Nach zwei Tagen sind wir wieder abgereist nichts ahnend, dass das Haus zum Verkauf steht. Wenige Monate später haben wir in einer Hotellerie Zeitung ein Inserat entdeckt: kleines Haus mit 12 Zimmern, 30 Plätzen im Restaurant in der Altstadt. Wir waren auf der Suche nach einem gemeinsamen Projekt, bewarben uns und erhielten das Dossier, noch immer ohne genaue Angaben, um welchen Betrieb es sich handelt. Nun war es jedoch so, dass auf dem Titelblatt des Dossiers eine Aussicht aus einem Zimmer abgebildet war. Es war genau das Zimmer, in dem wir paar Monate zuvor übernachtet haben. So wussten wir, es kann nur die «Auberge du Mouton» sein, nahmen all unseren Mut zusammen und starteten in ein neues Abenteuer. Seither ist die Auberge Teil unseres Lebens geworden, ein Ort, an dem wir unsere Leidenschaft ausüben und der Arbeit nachgehen können, die uns gefällt.
![]()
Beschreibe die Philosophie des «Auberge du Mouton» in drei Worten.
Persönlich. Charmant. Qualitativ.
Worauf wurde bei der Gestaltung der Zimmer Wert gelegt?
Bei der Gestaltung der Zimmer stand die Verschmelzung des historischen Bestands mit modernen Elementen im Mittelpunkt. Die Zimmer sind von sich aus schon sehr charmant, wir haben mit subtilen Details gearbeitet. Handgemachte Lampen, Bilder von schweizer Künstlerinnen, originelle Lösungen für Vorhänge und Sitzmöglichkeiten, sodass die Zimmer nicht überladen sind und der historische Charme immer noch im Vordergrund steht.
![]()
Was ist dein bisher spannendstes, lustigstes Erlebnis in der «Auberge du Mouton»?
Wir hatten im Sommer ein junges Paar aus Kroatien, das für eine Woche zu uns kam. Zuerst dachte ich, es sei eine Fake-Buchung, da wir hauptsächlich Gäste aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich haben. Bei ihrer Anreise stellte sich heraus, dass sie der Hitze entfliehen wollten. Im Gespräch ergab sich dann eine überraschende Wendung: Er organisiert grosse Natur-Weinmessen in New York und Wien. Es war unglaublich spannend, jemanden mit so ungewöhnlichem Hintergrund und so viel Leidenschaft für Wein direkt hier bei uns in der Auberge zu haben. Solche Begegnungen machen meinen Alltag immer wieder besonders und zeigen, wie vielfältig die Welt der Gäste sein kann.
![]()
Nenne deine persönlichen 3 Tipps für Besuchende in der «Auberge du Mouton», die zum ersten Mal in Porrentruy sind.
Erstens: Ein Spaziergang durch die charmante Altstadt von Porrentruy und hinauf zum Château, am besten ohne Eile, um die Atmosphäre wirklich aufzusaugen.
Zweitens: Sich bewusst Zeit nehmen für gutes Essen, inspirierende Gespräche und das angenehm entschleunigte Tempo der Stadt. Und dann den Tag entspannt ausklingen lassen bei einer Übernachtung in einem der zwölf Zimmer der «Auberge du Mouton».
Drittens: Die erste Etappe des Trans Swiss Trail von Porrentruy nach Saint-Ursanne erwandern. Und wer weiss, vielleicht entsteht unterwegs die Lust, gleich alle 32 Etappen bis nach Mendrisio in Angriff zu nehmen.
![]()
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das und warum?
Zeit. Weil wir alle oft zu wenig davon haben und sie das Wertvollste ist, was man teilen kann.
![]()
Was sind deine Lieblingsorte in Porrentruy und wo hältst du dich am liebsten auf?
Zu meinen Lieblingsorten in Porrentruy zählen das Bistro «La Poire» mit der «Galerie Sauvage» gleich nebenan, ein Ort voller Leben Kreativität und guter Gespräche. In der Umgebung zieht es mich gerne an den Doubs. Spazieren entlang des Flusses und danach ein erfrischender Sprung ins kühle Nass gehört für mich einfach dazu. Für kurze Pausen im Arbeitsalltag ist der Jardin Botanique direkt hinter der Auberge mein Rückzugsort, ruhig grün und perfekt zum Durchatmen.
![]()
![]()
Wie wär’s mal mit...
...einer Auszeit im Jura voller Erholung, um die Natur zu entdecken, durch die ruhigen Dörfer zu schlendern und einfach einen Moment Abstand vom Alltag zu gewinnen.
![]()
Vielen Dank Samuel für die spannenden Einblicke und das entschleunigte Erlebnis.
_
von Ana Brankovic
am 19.01.2026
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Lieber Samuel, wer bist du und welche Macke begleitet dich durch deinen Alltag?
Ich bin Samuel, Gastgeber aus Überzeugung, Detailverliebter und jemand, der gerne Menschen zusammenbringt. Eine kleine Macke von mir: Ich richte Gläser und Stühle fast automatisch gerade, selbst wenn ich privat unterwegs bin. Ganz Gastgeber eben, auch off duty.
Du bist Geschäftsführer in der «Auberge du Mouton» in Porrentruy. Wie sieht dein Arbeitsalltag im Hotel aus und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich? Wie hat dich dein Weg nach Porrentruy geführt?
Meine Frau Rebecca Leaver und ich führen eine Liste mit Bars, Restaurants, Hotels, die wir gerne einmal besuchen möchten, oftmals sind das kleine Inspirationsreisen. Die Auberge war auch mal Teil dieser Liste, und so haben wir uns, nach einem Geburtstag von Freund*innen, die in der Nähe ihren 30. feierten, in der «Auberge du Mouton» für ein Wochenende einquartiert. Das Haus hat uns mit der Kombination von Restaurant und Hotel und den schönen renovierten Zimmern sehr gut gefallen. Nach zwei Tagen sind wir wieder abgereist nichts ahnend, dass das Haus zum Verkauf steht. Wenige Monate später haben wir in einer Hotellerie Zeitung ein Inserat entdeckt: kleines Haus mit 12 Zimmern, 30 Plätzen im Restaurant in der Altstadt. Wir waren auf der Suche nach einem gemeinsamen Projekt, bewarben uns und erhielten das Dossier, noch immer ohne genaue Angaben, um welchen Betrieb es sich handelt. Nun war es jedoch so, dass auf dem Titelblatt des Dossiers eine Aussicht aus einem Zimmer abgebildet war. Es war genau das Zimmer, in dem wir paar Monate zuvor übernachtet haben. So wussten wir, es kann nur die «Auberge du Mouton» sein, nahmen all unseren Mut zusammen und starteten in ein neues Abenteuer. Seither ist die Auberge Teil unseres Lebens geworden, ein Ort, an dem wir unsere Leidenschaft ausüben und der Arbeit nachgehen können, die uns gefällt.
Beschreibe die Philosophie des «Auberge du Mouton» in drei Worten.
Persönlich. Charmant. Qualitativ.
Worauf wurde bei der Gestaltung der Zimmer Wert gelegt?
Bei der Gestaltung der Zimmer stand die Verschmelzung des historischen Bestands mit modernen Elementen im Mittelpunkt. Die Zimmer sind von sich aus schon sehr charmant, wir haben mit subtilen Details gearbeitet. Handgemachte Lampen, Bilder von schweizer Künstlerinnen, originelle Lösungen für Vorhänge und Sitzmöglichkeiten, sodass die Zimmer nicht überladen sind und der historische Charme immer noch im Vordergrund steht.

Was ist dein bisher spannendstes, lustigstes Erlebnis in der «Auberge du Mouton»?
Wir hatten im Sommer ein junges Paar aus Kroatien, das für eine Woche zu uns kam. Zuerst dachte ich, es sei eine Fake-Buchung, da wir hauptsächlich Gäste aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich haben. Bei ihrer Anreise stellte sich heraus, dass sie der Hitze entfliehen wollten. Im Gespräch ergab sich dann eine überraschende Wendung: Er organisiert grosse Natur-Weinmessen in New York und Wien. Es war unglaublich spannend, jemanden mit so ungewöhnlichem Hintergrund und so viel Leidenschaft für Wein direkt hier bei uns in der Auberge zu haben. Solche Begegnungen machen meinen Alltag immer wieder besonders und zeigen, wie vielfältig die Welt der Gäste sein kann.

Nenne deine persönlichen 3 Tipps für Besuchende in der «Auberge du Mouton», die zum ersten Mal in Porrentruy sind.
Erstens: Ein Spaziergang durch die charmante Altstadt von Porrentruy und hinauf zum Château, am besten ohne Eile, um die Atmosphäre wirklich aufzusaugen.
Zweitens: Sich bewusst Zeit nehmen für gutes Essen, inspirierende Gespräche und das angenehm entschleunigte Tempo der Stadt. Und dann den Tag entspannt ausklingen lassen bei einer Übernachtung in einem der zwölf Zimmer der «Auberge du Mouton».
Drittens: Die erste Etappe des Trans Swiss Trail von Porrentruy nach Saint-Ursanne erwandern. Und wer weiss, vielleicht entsteht unterwegs die Lust, gleich alle 32 Etappen bis nach Mendrisio in Angriff zu nehmen.
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das und warum?
Zeit. Weil wir alle oft zu wenig davon haben und sie das Wertvollste ist, was man teilen kann.
Was sind deine Lieblingsorte in Porrentruy und wo hältst du dich am liebsten auf?
Zu meinen Lieblingsorten in Porrentruy zählen das Bistro «La Poire» mit der «Galerie Sauvage» gleich nebenan, ein Ort voller Leben Kreativität und guter Gespräche. In der Umgebung zieht es mich gerne an den Doubs. Spazieren entlang des Flusses und danach ein erfrischender Sprung ins kühle Nass gehört für mich einfach dazu. Für kurze Pausen im Arbeitsalltag ist der Jardin Botanique direkt hinter der Auberge mein Rückzugsort, ruhig grün und perfekt zum Durchatmen.
Wie wär’s mal mit...
...einer Auszeit im Jura voller Erholung, um die Natur zu entdecken, durch die ruhigen Dörfer zu schlendern und einfach einen Moment Abstand vom Alltag zu gewinnen.
Vielen Dank Samuel für die spannenden Einblicke und das entschleunigte Erlebnis.
_
von Ana Brankovic
am 19.01.2026
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Schloss Wartegg» am Bodensee: Im Gespräch mit Sabrina Butz
Im Gespräch mit Sabrina Butz schauen wir hinter die Kulissen des Bio Hotels «Schloss Wartegg» am Bodensee und sprechen über einen Ort, der Nachhaltigkeit, Natur, Urbanität und Inspiration vereint.
![]()
Liebe Sabrina, wer bist du und welche kleine Macke begleitet dich durch deinen Alltag?
Mein Name ist Sabrina Butz, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und lebe seit zwölf Jahren im schönen Heiden im Appenzellerland. Ich bin ein kreativer Allrounder mit vier Jobs, die mir alle sehr viel Freude bereiten. Es wird mir also nicht langweilig.
Meine kleine Macke: Ich brauche morgens mindestens zwei Tassen Kaffee und ich bin lieber eine Minute zu früh als zu spät.
![]()
![]()
Was machst du beim Hotel «Schloss Wartegg» und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich?
Ich arbeite im Marketing und im Kulturverein von «Schloss Wartegg». Für mich ist das «Schloss Wartegg» ein echter Kraftort mit einem wunderschönen Park und einem Team, das mit viel Herzblut arbeitet. Die Werte, für die das Hotel steht, decken sich mit meinen eigenen. Genau das gibt meiner Arbeit im Schloss Sinn, was ich sehr schätze.
![]()
![]()
Nenne drei Werte, die dir wichtig sind. Wir erlebst du diese Werte im Alltag oder beim täglichen Arbeiten?
Persönlich sind mir Freude, Wertschätzung und Mitgefühl besonders wichtig. Im Arbeitsalltag erlebe ich diese Werte durch Freude an der Zusammenarbeit im Team, gegenseitige Wertschätzung und Inspiration.
![]()
![]()
![]()
Wie würdest du die Philosophie des Hotels «Schloss Wartegg» in drei Worten beschreiben?
Nachhaltig, inspirierend, mit Herz.
![]()
Wenn das Team vom Hotel «Schloss Wartegg» ein Gericht oder Zutaten wären, welche und warum?
Ein liebevoll zubereitetes Bio-Menü mit frischen, regionalen Zutaten: Jede Person bringt ihren eigenen Geschmack ein und zusammen entsteht etwas sehr Stimmiges, Nährendes und Besonderes!
![]()
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, statt Wasser, was wäre das und warum?
Ganz klar: Liebe.
![]()
Was sind deine Lieblingsorte und wo hältst du dich am liebsten auf nebst «Schloss Wartegg»?
Im Café «La Vela» in Rorschach gibt es ausgezeichneten italienischen Kaffee, feine Schokolade und kleine italienische Dolci. Auch das indische Restaurant «Holi» in St. Gallen kann ich sehr empfehlen.
Wie wär’s mal mit...
...einem Monat vegan oder zuckerfrei essen?
![]() Vielen Dank Sabrina für die spannenden Einblicke in deinen Alltag.
Vielen Dank Sabrina für die spannenden Einblicke in deinen Alltag.
_
von Ana Brankovic
am 29.12.2025
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Liebe Sabrina, wer bist du und welche kleine Macke begleitet dich durch deinen Alltag?
Mein Name ist Sabrina Butz, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und lebe seit zwölf Jahren im schönen Heiden im Appenzellerland. Ich bin ein kreativer Allrounder mit vier Jobs, die mir alle sehr viel Freude bereiten. Es wird mir also nicht langweilig.
Meine kleine Macke: Ich brauche morgens mindestens zwei Tassen Kaffee und ich bin lieber eine Minute zu früh als zu spät.
Was machst du beim Hotel «Schloss Wartegg» und was bedeutet dieser Ort für dich persönlich?
Ich arbeite im Marketing und im Kulturverein von «Schloss Wartegg». Für mich ist das «Schloss Wartegg» ein echter Kraftort mit einem wunderschönen Park und einem Team, das mit viel Herzblut arbeitet. Die Werte, für die das Hotel steht, decken sich mit meinen eigenen. Genau das gibt meiner Arbeit im Schloss Sinn, was ich sehr schätze.
Nenne drei Werte, die dir wichtig sind. Wir erlebst du diese Werte im Alltag oder beim täglichen Arbeiten?
Persönlich sind mir Freude, Wertschätzung und Mitgefühl besonders wichtig. Im Arbeitsalltag erlebe ich diese Werte durch Freude an der Zusammenarbeit im Team, gegenseitige Wertschätzung und Inspiration.
Wie würdest du die Philosophie des Hotels «Schloss Wartegg» in drei Worten beschreiben?
Nachhaltig, inspirierend, mit Herz.
Wenn das Team vom Hotel «Schloss Wartegg» ein Gericht oder Zutaten wären, welche und warum?
Ein liebevoll zubereitetes Bio-Menü mit frischen, regionalen Zutaten: Jede Person bringt ihren eigenen Geschmack ein und zusammen entsteht etwas sehr Stimmiges, Nährendes und Besonderes!
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, statt Wasser, was wäre das und warum?
Ganz klar: Liebe.
Was sind deine Lieblingsorte und wo hältst du dich am liebsten auf nebst «Schloss Wartegg»?
Im Café «La Vela» in Rorschach gibt es ausgezeichneten italienischen Kaffee, feine Schokolade und kleine italienische Dolci. Auch das indische Restaurant «Holi» in St. Gallen kann ich sehr empfehlen.
Wie wär’s mal mit...
...einem Monat vegan oder zuckerfrei essen?
_
von Ana Brankovic
am 29.12.2025
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Art Lab»
Fondation Beyeler: Im Gespräch mit Naomi Ena Eggli
Im Gespräch mit Naomi Ena Eggli tauchen wir in
eine Arbeitsweise ein, die sich weniger an Orte als an Menschen und inspirierende Verbindungen knüpft. Gemeinsam mit Nora Inja Petersen leitet sie das «Art Lab» der Fondation Beyeler nicht hierarchisch, sondern als gleichberechtigtes Mitglied der Gruppe. Mit Offenheit schaffen sie einen Raum für Dialog, Neugier und Zusammenarbeit, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unmittelbare Einblicke ins Museum ermöglicht. Naomi bewegt sich zwischen Museum, Uni, Atelier und Yogamatte, ohne ihren Kern zu verlieren. Wir sprechen mit ihr über Anfänge, neue Formate, Mut und Neugier.
Scroll for English
![]()
Hallo Naomi, bitte beschreibe dich in 3 Worten.
Offen, motiviert und involviert.
Gibt es Orte, die dich im Alltag inspirieren?
Für mich ist es tatsächlich weniger ein bestimmter Ort. Es sind vor allem die Menschen, die mich inspirieren. Ich habe das Glück, spannende Arbeitskolleg*innen und Freund*innen zu haben. Viele meiner Freund*innen kenne ich seit Jahren und wir kennen die Arbeitsweisen der anderen sehr gut. Ich liebe es, mit ihnen über meine Projekte zu sprechen und von ihren zu hören. Ihre Perspektiven und Herangehensweisen inspirieren mich sehr oft. In diesem Sinn kommt Inspiration für mich mehr von Menschen als von Räumen. Wenn ich Ausstellungen besuche und mich ein Kunstwerk anspricht, frage ich mich, welcher Mensch dahinter steht und warum diese Person etwas auf genau diese Weise gestaltet hat. Mich zieht immer der Hintergrund an, die Geschichte hinter dem Werk.
![]()
Du leitest das «Art Lab» der Fondation Beyeler. Wie war dein allererster Arbeitstag?
Den ersten Arbeitstag hätte ich fast verpasst. Ich war am Wochenende auf einer Fähre aus Griechenland, welche viel zu spät in Italien eintraf. Am Ende hat aber alles geklappt und ich konnte pünktlich meine Arbeit beginnen. Im Museum starteten wir sofort mit einer Tour durch alle Abteilungen. Ich lernte so viele Menschen kennen, dass ich mir unmöglich alle Namen merken konnte. Gleichzeitig begegnete ich direkt sehr sympathischen Kolleg*innen, die mir den Einstieg erleichterten.
Hattest du eine bestimmte Strategie für den ersten Arbeitstag?
Ich hatte mir die erste Arbeitswoche im Voraus zwar ausgemalt, aber dann war trotzdem alles anders. Ich tauchte voll und ganz in die Fondation Beyeler-Welt ein. Es blieb gar keine Zeit, nervös zu sein. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. In den folgenden Wochen habe ich mir dann die Zeit genommen, mit jeder Abteilung einen Kaffee zu trinken. Das hat mir geholfen, zu verstehen, wie die Menschen arbeiten und wie alles miteinander verbunden ist.
![]()
Welche Fähigkeiten sind für deine Rolle besonders wichtig?
Man muss kommunikationsstark sein und ein gewisses Selbstvertrauen mitbringen. Im «Art Lab» entwickeln wir ständig neue Formate, daher ist es wichtig, eigene Ideen überzeugend präsentieren zu können. Hilfreich ist auch Erfahrung darin, Projekte von Anfang bis Ende zu realisieren und zu wissen, wie man etwas wirklich aufbaut.
![]()
Wenn jemand in einer ähnlichen Position arbeiten möchte, welcher Hintergrund ist dafür sinnvoll?
Ich habe Design studiert – Trends und Identity an der Zürcher Hochschule der Künste, kurz ZHdK. Mein Studium hat mir viele Fähigkeiten vermittelt, die ich heute nutze: Ideen entwickeln, Konzepte erstellen, Prototypen bauen, testen, verfeinern und umsetzen. Ein Design- oder allgemein kreativer, lösungsorientierter Hintergrund ist eine gute Grundlage fürs «Art Lab». Aber selbst wenn man etwas ganz anderes studiert hat, wie beispielsweise Geisteswissenschaften, kann man seinen Platz in diesem Feld finden. Wichtig ist der Übergang vom Theoretischen zum Praktischen: mit Menschen arbeiten, mit Prozessen, mit realen Projekten wie Marketingkampagnen oder partizipativen Formaten. Beim «Art Lab» fühlt sich jedes Projekt wie ein Neuanfang an. Man lernt konstant weiter und muss keine Angst haben, alles wissen zu müssen. Es gibt immer neue Menschen, Themen und Herausforderungen. Die Bereitschaft, neugierig zu bleiben und zu lernen, ist oft wichtiger als die perfekte Ausbildung.
![]()
Wenn du in einem Kunstwerk aus der Sammlung der Fondation Beyeler leben könntest, welches wäre es und warum?
Es gibt ein Kunstwerk, das schon immer mein Favorit war. Es war auch das erste Werk, das mich in der Fondation Beyeler wirklich gepackt hat und ich glaube, vielen geht es ähnlich: der «Snowman» (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, Kupfer, Aluminium, Glas, Wasser, Kühlsystem, 218 x 128 x 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) von Fischli/Weiss. Ich habe den Winter schon immer geliebt, besonders den Moment, wenn der erste Schnee fällt. Es ist magisch, wenn diese weissen
Flocken vom Himmel kommen und man sie zu einem Schneemann formen kann. Wenn Besucher*innen den Snowman sehen, müssen sie oft sofort lächeln. Das Werk macht sehr schnell glücklich. Aber wenn man tiefer schaut, verändert sich die Bedeutung. Der Schneemann steht in einem Gefrierschrank. Warum? Weil die Welt jedes Jahr wärmer wird. Und dann stellt man sich Fragen: Wird es in 20 Jahren noch Schnee geben? Werden meine Kinder je einen Schneemann sehen? Wird dieses Kunstwerk ausserhalb eines Kühlschranks überhaupt existieren können? Ich liebe Kunstwerke, die beide Ebenen vereinen, die unmittelbare Freude und die tiefere Reflexion. «Snowman» zeigt beide Seiten des Lebens auf wunderschöne Weise.
Wenn du ein Werkzeug wärst, welches wärst du und warum?
Wenn das Werkzeug meine Persönlichkeit widerspiegeln soll, dann wäre ich wohl ChatGPT. Denn wenn jemand mir etwas zuwirft, eine Frage, eine Idee, ein Problem, liebe ich es, daraus einen neuen Gedanken zu formen oder mit anderen Dingen zu verknüpfen.
![]()
Was war das seltsamste oder lustigste Erlebnis, das dir bei der Arbeit in der Fondation Beyeler passiert ist?
Die Tage in der Fondation Beyeler sind meist unvorhersehbar. Dies ist sehr interessant und herausfordernd. Die Institution ist sehr strukturiert, aber das Publikum bringt eine völlig eigene Dynamik hinein. Man plant, administrative Aufgaben zu erledigen und plötzlich ruft jemand an, weil er dringend Hilfe braucht. Jeder Tag wird zu einem kleinen Abenteuer. Ich schätze diese Momente am meisten, wenn ich merke, dass die jungen Menschen selbständig arbeiten und es mich eigentlich nicht mehr braucht. Dann wird das Museum zu ihrem Ort. Solche Momente sind es, für die ich arbeite, wenn junge Menschen Selbstvertrauen gewinnen, neue Fähigkeiten lernen, Dinge ausprobieren und erfolgreich umsetzen. Jedes Projekt verstärkt dieses Gefühl.
![]()
Lebst du im Beruf und privat die gleiche Rolle?
Im Kern bin ich die gleiche Person, aber weil ich viele unterschiedliche Dinge tue, bewege ich mich je nach Kontext in verschiedenen Rollen. Im «Art Lab» bin ich in einem Organisierungsmodus, Struktur, Planung, Aufgaben abhaken, dafür sorgen, dass alles läuft. An der Uni bin ich völlig anders. Da bin ich Studentin: Ich nehme Wissen auf, lese, lerne. Ich bin nur für mich verantwortlich, ich bin ruhig und absorbierend. Wenn ich an eigenen kreativen Projekten mit Freund*innen arbeite,
denke ich gross und schaue, wohin Ideen führen können. Diese Seite denkt gross, experimentiert und schaut, wohin Ideen führen können. Und dann gibt es meine Yoga-Lehrerinnen-Seite. Dort bin ich für das Wohlbefinden anderer Menschen verantwortlich und
probiere klar, ruhig und achtsam zu sein. Ich glaube, dass wir alle viele unterschiedliche Seiten haben, die wir an verschiedenen Orten zeigen können.
Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...
...einem Spaziergang von Basel nach Riehen entlang der Langen Erle.
![]()
Vielen Dank an Naomi für die spannenden Einblicke in den Arbeitsalltag im Museum. Dieser Beitrag entstand in Kollaboration mit jungen, mitwirkenden Menschen der «Art Lab» Gruppe und dem Kulturverein Wie wär’s mal mit.
«Art Lab» Fondation Beyeler: In conversation with Naomi Ena Eggli
In conversation with Naomi Ena Eggli, we enter a way of working that is shaped less by places than by people and inspiring connections. Together with Nora Inja Petersen, she co-directs the «Art Lab» at Fondation Beyeler not hierarchically, but as an equal member of the group. Through openness, they create a space for dialogue, curiosity, and collaboration, one that gives adolescents and young adults direct access to the museum. Naomi moves fluidly between the museum, university, studio, and yoga mat without losing her sense of self. We talk with her about chaotic beginnings, new formats, courage, and curiosity.
Hi Naomi, please describe yourself in 3 words.
Open, motivated, and involved.
Are there places that inspire you in your every daily life?
For me, it’s actually less about a specific place. It’s mainly the people who inspire me. I’m fortunate to have inspiring colleagues and friends. I’ve known many of my friends for years, and we understand each other’s ways of working very well. I love talking with them about my projects and hearing about theirs. Their perspectives and approaches often inspire me greatly. In this sense, inspiration comes more from people than from spaces. When I visit exhibitions and a work of art speaks to me, I ask myself who the person behind it is and why they chose to create something in that particular way. I’m always drawn to the background, the story behind the work.
You lead the Art Lab at the Fondation Beyeler. What was your very first day at work like?
I had imagined what my first week at work would be like in advance, but in the end everything turned out differently. I immersed myself completely in the world of the Fondation Beyeler. There was no time at all to feel nervous. I met many new people. In the weeks that followed, I took the time to have coffee with each department. That helped me understand how people work and how everything is connected.
Were you nervous, or did you have a strategy for the first day at work?
I had imagined the week beforehand, but after everything that happened I was too tired to overthink, so everything unfolded on its own.
There wasn’t really time to be nervous, as soon as you left one person, you were already greeting the next. I simply went with the flow. In the following weeks, I took the time to meet every department for coffee. It helped me understand how people work and how everything connects.
What are the essential skills for your role?
You need to be communicative and have a certain level of self-confidence. In «Art Lab» we constantly develop new formats, so you must be able to present your ideas convincingly. It also helps to have experience realizing projects from start to finish, knowing how to build something from the ground up makes a big difference.
If someone wanted to work in a similar position, what kind of background would they need?
I studied design, Trends and Identity, at the Zurich University of the Arts (ZHdK). My studies gave me many skills that I still use today: developing ideas, creating concepts, building prototypes, testing, refining, and implementing them. A design background, or more generally, a creative, solution-oriented one, is a strong foundation for the «Art Lab». But even if you studied something completely different, such as the humanities, you can still find your place in this field. What matters is the transition from theory to practice: working with people, with processes, and with real projects like marketing campaigns or participatory formats. At the «Art Lab», every project feels like a new beginning. You are constantly learning and don’t have to be afraid of not knowing everything. There are always new people, topics, and challenges. The willingness to stay curious and keep learning is often more important than having the perfect educational background.
If you could live inside an artwork from the Fondation Beyeler collection, which one would you choose and why?
There is one artwork that has always been my favorite. It was also the first work that truly captivated me at the Fondation Beyeler, and I think many people feel the same way: “Snowman” (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, copper, aluminum, glass, water, cooling system, 218 × 128 × 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) by Fischli/Weiss. I have always loved winter, especially the moment when the first snow falls. There is something magical about those white flakes coming down from the sky and being shaped into a snowman. When visitors see the “Snowman”, they often smile immediately. The work makes people happy very quickly. But when you look more closely, its meaning changes. The snowman stands inside a freezer. Why? Because the world is getting warmer every year. And then questions arise: Will there still be snow in 20 years? Will my children ever see a snowman? Will this artwork even be able to exist outside of a refrigerator? I love artworks that combine both levels, immediate joy and deeper reflection. “Snowman” shows both sides of life in a beautiful way.
If you were a tool, which one would you be and why?
If the tool were meant to reflect my personality, it would probably be ChatGPT. Because when someone throws something my way, a question, an idea, a problem, I love shaping it into a new thought or connecting it with other things.
What was the strangest or funniest thing that ever happened to you at work at Fondation Beyeler?
The days at the Fondation Beyeler are usually unpredictable. This is both very interesting and challenging. The institution itself is highly structured, but the public brings an entirely different dynamic into it. You plan to take care of administrative tasks, and suddenly someone calls because they urgently need help. Each day becomes a small adventure.
I value those moments most when I realize that the young people are working independently and that I’m no longer really needed. Then the museum becomes their place. These are the moments I work for—when young people gain self-confidence, learn new skills, try things out, and successfully put them into practice. Every project strengthens this feeling.
Do you feel you play the same role as a person in your work and in your private life?
At my core, I’m the same person. But because I do many different things, I move between different roles depending on the context. When I’m responsible for «Art Lab», I switch into an organizing mode, structure, planning, ticking off tasks, making sure everything runs. At university, I’m completely different. There I’m a student: I absorb knowledge, read, learn. I’m not the person in charge, I’m quietly taking things in. When I work on my own creative projects with friends, I think big and see where ideas can lead. That part of me thinks big, experiments, and sees where ideas can go. And then there’s my yoga-teacher side. In that role, I’m responsible for people’s well-being, and try to be clear, calm, and mindful. I believe that we all have many different sides, which we can show in different places.
How about...
...a walk from Basel to Riehen along the Lange Erle?
Many thanks to Naomi for the fascinating insights into everyday working life at the museum. This contribution was created in collaboration with the young participants of the «Art Lab» group and the cultural association Wie wär’s mal mit.
_
von Sofia Shumeiko
am 15.12.2025
Fotos
© Sofia Shumeiko für Wie wär's mal mit
Kunstwerke
Installationsansicht «Eine kleine Kunstgeschichte des Punktes», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025
Barnett Newman, Queen of the Night II, 1967, Acryl auf Leinwand, 275,3 x 121,6 cm, Ananda Foundation N.V.
eine Arbeitsweise ein, die sich weniger an Orte als an Menschen und inspirierende Verbindungen knüpft. Gemeinsam mit Nora Inja Petersen leitet sie das «Art Lab» der Fondation Beyeler nicht hierarchisch, sondern als gleichberechtigtes Mitglied der Gruppe. Mit Offenheit schaffen sie einen Raum für Dialog, Neugier und Zusammenarbeit, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unmittelbare Einblicke ins Museum ermöglicht. Naomi bewegt sich zwischen Museum, Uni, Atelier und Yogamatte, ohne ihren Kern zu verlieren. Wir sprechen mit ihr über Anfänge, neue Formate, Mut und Neugier.
Scroll for English

Hallo Naomi, bitte beschreibe dich in 3 Worten.
Offen, motiviert und involviert.
Gibt es Orte, die dich im Alltag inspirieren?
Für mich ist es tatsächlich weniger ein bestimmter Ort. Es sind vor allem die Menschen, die mich inspirieren. Ich habe das Glück, spannende Arbeitskolleg*innen und Freund*innen zu haben. Viele meiner Freund*innen kenne ich seit Jahren und wir kennen die Arbeitsweisen der anderen sehr gut. Ich liebe es, mit ihnen über meine Projekte zu sprechen und von ihren zu hören. Ihre Perspektiven und Herangehensweisen inspirieren mich sehr oft. In diesem Sinn kommt Inspiration für mich mehr von Menschen als von Räumen. Wenn ich Ausstellungen besuche und mich ein Kunstwerk anspricht, frage ich mich, welcher Mensch dahinter steht und warum diese Person etwas auf genau diese Weise gestaltet hat. Mich zieht immer der Hintergrund an, die Geschichte hinter dem Werk.

Du leitest das «Art Lab» der Fondation Beyeler. Wie war dein allererster Arbeitstag?
Den ersten Arbeitstag hätte ich fast verpasst. Ich war am Wochenende auf einer Fähre aus Griechenland, welche viel zu spät in Italien eintraf. Am Ende hat aber alles geklappt und ich konnte pünktlich meine Arbeit beginnen. Im Museum starteten wir sofort mit einer Tour durch alle Abteilungen. Ich lernte so viele Menschen kennen, dass ich mir unmöglich alle Namen merken konnte. Gleichzeitig begegnete ich direkt sehr sympathischen Kolleg*innen, die mir den Einstieg erleichterten.
Hattest du eine bestimmte Strategie für den ersten Arbeitstag?
Ich hatte mir die erste Arbeitswoche im Voraus zwar ausgemalt, aber dann war trotzdem alles anders. Ich tauchte voll und ganz in die Fondation Beyeler-Welt ein. Es blieb gar keine Zeit, nervös zu sein. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. In den folgenden Wochen habe ich mir dann die Zeit genommen, mit jeder Abteilung einen Kaffee zu trinken. Das hat mir geholfen, zu verstehen, wie die Menschen arbeiten und wie alles miteinander verbunden ist.

Welche Fähigkeiten sind für deine Rolle besonders wichtig?
Man muss kommunikationsstark sein und ein gewisses Selbstvertrauen mitbringen. Im «Art Lab» entwickeln wir ständig neue Formate, daher ist es wichtig, eigene Ideen überzeugend präsentieren zu können. Hilfreich ist auch Erfahrung darin, Projekte von Anfang bis Ende zu realisieren und zu wissen, wie man etwas wirklich aufbaut.

Wenn jemand in einer ähnlichen Position arbeiten möchte, welcher Hintergrund ist dafür sinnvoll?
Ich habe Design studiert – Trends und Identity an der Zürcher Hochschule der Künste, kurz ZHdK. Mein Studium hat mir viele Fähigkeiten vermittelt, die ich heute nutze: Ideen entwickeln, Konzepte erstellen, Prototypen bauen, testen, verfeinern und umsetzen. Ein Design- oder allgemein kreativer, lösungsorientierter Hintergrund ist eine gute Grundlage fürs «Art Lab». Aber selbst wenn man etwas ganz anderes studiert hat, wie beispielsweise Geisteswissenschaften, kann man seinen Platz in diesem Feld finden. Wichtig ist der Übergang vom Theoretischen zum Praktischen: mit Menschen arbeiten, mit Prozessen, mit realen Projekten wie Marketingkampagnen oder partizipativen Formaten. Beim «Art Lab» fühlt sich jedes Projekt wie ein Neuanfang an. Man lernt konstant weiter und muss keine Angst haben, alles wissen zu müssen. Es gibt immer neue Menschen, Themen und Herausforderungen. Die Bereitschaft, neugierig zu bleiben und zu lernen, ist oft wichtiger als die perfekte Ausbildung.

Wenn du in einem Kunstwerk aus der Sammlung der Fondation Beyeler leben könntest, welches wäre es und warum?
Es gibt ein Kunstwerk, das schon immer mein Favorit war. Es war auch das erste Werk, das mich in der Fondation Beyeler wirklich gepackt hat und ich glaube, vielen geht es ähnlich: der «Snowman» (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, Kupfer, Aluminium, Glas, Wasser, Kühlsystem, 218 x 128 x 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) von Fischli/Weiss. Ich habe den Winter schon immer geliebt, besonders den Moment, wenn der erste Schnee fällt. Es ist magisch, wenn diese weissen
Flocken vom Himmel kommen und man sie zu einem Schneemann formen kann. Wenn Besucher*innen den Snowman sehen, müssen sie oft sofort lächeln. Das Werk macht sehr schnell glücklich. Aber wenn man tiefer schaut, verändert sich die Bedeutung. Der Schneemann steht in einem Gefrierschrank. Warum? Weil die Welt jedes Jahr wärmer wird. Und dann stellt man sich Fragen: Wird es in 20 Jahren noch Schnee geben? Werden meine Kinder je einen Schneemann sehen? Wird dieses Kunstwerk ausserhalb eines Kühlschranks überhaupt existieren können? Ich liebe Kunstwerke, die beide Ebenen vereinen, die unmittelbare Freude und die tiefere Reflexion. «Snowman» zeigt beide Seiten des Lebens auf wunderschöne Weise.
Wenn du ein Werkzeug wärst, welches wärst du und warum?
Wenn das Werkzeug meine Persönlichkeit widerspiegeln soll, dann wäre ich wohl ChatGPT. Denn wenn jemand mir etwas zuwirft, eine Frage, eine Idee, ein Problem, liebe ich es, daraus einen neuen Gedanken zu formen oder mit anderen Dingen zu verknüpfen.

Was war das seltsamste oder lustigste Erlebnis, das dir bei der Arbeit in der Fondation Beyeler passiert ist?
Die Tage in der Fondation Beyeler sind meist unvorhersehbar. Dies ist sehr interessant und herausfordernd. Die Institution ist sehr strukturiert, aber das Publikum bringt eine völlig eigene Dynamik hinein. Man plant, administrative Aufgaben zu erledigen und plötzlich ruft jemand an, weil er dringend Hilfe braucht. Jeder Tag wird zu einem kleinen Abenteuer. Ich schätze diese Momente am meisten, wenn ich merke, dass die jungen Menschen selbständig arbeiten und es mich eigentlich nicht mehr braucht. Dann wird das Museum zu ihrem Ort. Solche Momente sind es, für die ich arbeite, wenn junge Menschen Selbstvertrauen gewinnen, neue Fähigkeiten lernen, Dinge ausprobieren und erfolgreich umsetzen. Jedes Projekt verstärkt dieses Gefühl.
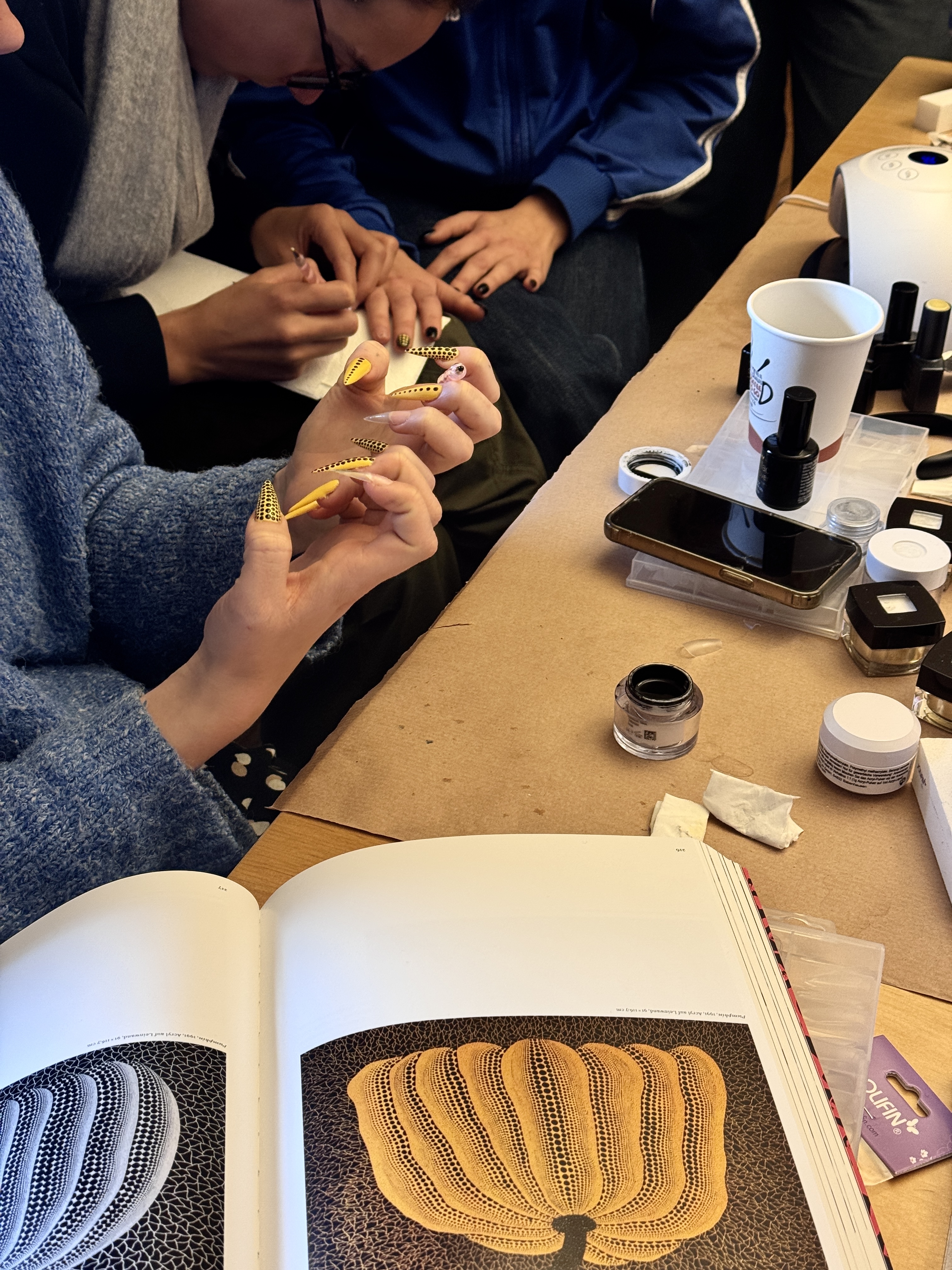
Lebst du im Beruf und privat die gleiche Rolle?
Im Kern bin ich die gleiche Person, aber weil ich viele unterschiedliche Dinge tue, bewege ich mich je nach Kontext in verschiedenen Rollen. Im «Art Lab» bin ich in einem Organisierungsmodus, Struktur, Planung, Aufgaben abhaken, dafür sorgen, dass alles läuft. An der Uni bin ich völlig anders. Da bin ich Studentin: Ich nehme Wissen auf, lese, lerne. Ich bin nur für mich verantwortlich, ich bin ruhig und absorbierend. Wenn ich an eigenen kreativen Projekten mit Freund*innen arbeite,
denke ich gross und schaue, wohin Ideen führen können. Diese Seite denkt gross, experimentiert und schaut, wohin Ideen führen können. Und dann gibt es meine Yoga-Lehrerinnen-Seite. Dort bin ich für das Wohlbefinden anderer Menschen verantwortlich und
probiere klar, ruhig und achtsam zu sein. Ich glaube, dass wir alle viele unterschiedliche Seiten haben, die wir an verschiedenen Orten zeigen können.
Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...
...einem Spaziergang von Basel nach Riehen entlang der Langen Erle.

Vielen Dank an Naomi für die spannenden Einblicke in den Arbeitsalltag im Museum. Dieser Beitrag entstand in Kollaboration mit jungen, mitwirkenden Menschen der «Art Lab» Gruppe und dem Kulturverein Wie wär’s mal mit.
«Art Lab» Fondation Beyeler: In conversation with Naomi Ena Eggli
In conversation with Naomi Ena Eggli, we enter a way of working that is shaped less by places than by people and inspiring connections. Together with Nora Inja Petersen, she co-directs the «Art Lab» at Fondation Beyeler not hierarchically, but as an equal member of the group. Through openness, they create a space for dialogue, curiosity, and collaboration, one that gives adolescents and young adults direct access to the museum. Naomi moves fluidly between the museum, university, studio, and yoga mat without losing her sense of self. We talk with her about chaotic beginnings, new formats, courage, and curiosity.
Hi Naomi, please describe yourself in 3 words.
Open, motivated, and involved.
Are there places that inspire you in your every daily life?
For me, it’s actually less about a specific place. It’s mainly the people who inspire me. I’m fortunate to have inspiring colleagues and friends. I’ve known many of my friends for years, and we understand each other’s ways of working very well. I love talking with them about my projects and hearing about theirs. Their perspectives and approaches often inspire me greatly. In this sense, inspiration comes more from people than from spaces. When I visit exhibitions and a work of art speaks to me, I ask myself who the person behind it is and why they chose to create something in that particular way. I’m always drawn to the background, the story behind the work.
You lead the Art Lab at the Fondation Beyeler. What was your very first day at work like?
I had imagined what my first week at work would be like in advance, but in the end everything turned out differently. I immersed myself completely in the world of the Fondation Beyeler. There was no time at all to feel nervous. I met many new people. In the weeks that followed, I took the time to have coffee with each department. That helped me understand how people work and how everything is connected.
Were you nervous, or did you have a strategy for the first day at work?
I had imagined the week beforehand, but after everything that happened I was too tired to overthink, so everything unfolded on its own.
There wasn’t really time to be nervous, as soon as you left one person, you were already greeting the next. I simply went with the flow. In the following weeks, I took the time to meet every department for coffee. It helped me understand how people work and how everything connects.
What are the essential skills for your role?
You need to be communicative and have a certain level of self-confidence. In «Art Lab» we constantly develop new formats, so you must be able to present your ideas convincingly. It also helps to have experience realizing projects from start to finish, knowing how to build something from the ground up makes a big difference.
If someone wanted to work in a similar position, what kind of background would they need?
I studied design, Trends and Identity, at the Zurich University of the Arts (ZHdK). My studies gave me many skills that I still use today: developing ideas, creating concepts, building prototypes, testing, refining, and implementing them. A design background, or more generally, a creative, solution-oriented one, is a strong foundation for the «Art Lab». But even if you studied something completely different, such as the humanities, you can still find your place in this field. What matters is the transition from theory to practice: working with people, with processes, and with real projects like marketing campaigns or participatory formats. At the «Art Lab», every project feels like a new beginning. You are constantly learning and don’t have to be afraid of not knowing everything. There are always new people, topics, and challenges. The willingness to stay curious and keep learning is often more important than having the perfect educational background.
If you could live inside an artwork from the Fondation Beyeler collection, which one would you choose and why?
There is one artwork that has always been my favorite. It was also the first work that truly captivated me at the Fondation Beyeler, and I think many people feel the same way: “Snowman” (Fischli/Weiss, Snowman, 2016, copper, aluminum, glass, water, cooling system, 218 × 128 × 165 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel) by Fischli/Weiss. I have always loved winter, especially the moment when the first snow falls. There is something magical about those white flakes coming down from the sky and being shaped into a snowman. When visitors see the “Snowman”, they often smile immediately. The work makes people happy very quickly. But when you look more closely, its meaning changes. The snowman stands inside a freezer. Why? Because the world is getting warmer every year. And then questions arise: Will there still be snow in 20 years? Will my children ever see a snowman? Will this artwork even be able to exist outside of a refrigerator? I love artworks that combine both levels, immediate joy and deeper reflection. “Snowman” shows both sides of life in a beautiful way.
If you were a tool, which one would you be and why?
If the tool were meant to reflect my personality, it would probably be ChatGPT. Because when someone throws something my way, a question, an idea, a problem, I love shaping it into a new thought or connecting it with other things.
What was the strangest or funniest thing that ever happened to you at work at Fondation Beyeler?
The days at the Fondation Beyeler are usually unpredictable. This is both very interesting and challenging. The institution itself is highly structured, but the public brings an entirely different dynamic into it. You plan to take care of administrative tasks, and suddenly someone calls because they urgently need help. Each day becomes a small adventure.
I value those moments most when I realize that the young people are working independently and that I’m no longer really needed. Then the museum becomes their place. These are the moments I work for—when young people gain self-confidence, learn new skills, try things out, and successfully put them into practice. Every project strengthens this feeling.
Do you feel you play the same role as a person in your work and in your private life?
At my core, I’m the same person. But because I do many different things, I move between different roles depending on the context. When I’m responsible for «Art Lab», I switch into an organizing mode, structure, planning, ticking off tasks, making sure everything runs. At university, I’m completely different. There I’m a student: I absorb knowledge, read, learn. I’m not the person in charge, I’m quietly taking things in. When I work on my own creative projects with friends, I think big and see where ideas can lead. That part of me thinks big, experiments, and sees where ideas can go. And then there’s my yoga-teacher side. In that role, I’m responsible for people’s well-being, and try to be clear, calm, and mindful. I believe that we all have many different sides, which we can show in different places.
How about...
...a walk from Basel to Riehen along the Lange Erle?
Many thanks to Naomi for the fascinating insights into everyday working life at the museum. This contribution was created in collaboration with the young participants of the «Art Lab» group and the cultural association Wie wär’s mal mit.
_
von Sofia Shumeiko
am 15.12.2025
Fotos
© Sofia Shumeiko für Wie wär's mal mit
Kunstwerke
Installationsansicht «Eine kleine Kunstgeschichte des Punktes», Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2025
Barnett Newman, Queen of the Night II, 1967, Acryl auf Leinwand, 275,3 x 121,6 cm, Ananda Foundation N.V.
«kostbar» Luzern: Im Gespräch mit Elena Herger
Die «kostbar» ist eine Symbiose aus Secondhand-Laden und gemütlichem Beisammensein im Bistro an der Murbacherstrasse 35 in Luzern. Hier starten Kleider in ihr neues Leben, und das Bistro bietet Platz für Genuss und gemeinsames Verweilen. Wir sprachen mit der Gründerin der «kostbar», Elena Herger, über Neubeginne, schöne Momente und die Chance von Secondhand.
![]()
Hoi Elena, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?
Tierlieb, witzig (I guess, lacht) und neugierig.
Was ist für dich «kostbar»?
Mein Hund Enzo ist für mich «kostbar». Alle meine engen Menschen sind für mich «kostbar».
Die «kostbar» ist für mich ein Ort der Begegnung, der Kreativität und für alle.
![]()
![]()
Was gefällt dir an Secondhand-Kleidung?
Mir gefällt besonders die Individualität daran. Man findet Einzelstücke, die man gerade in anderen Kleiderläden nicht kaufen kann. Man kann Teile zu neuem Leben erwecken, persönlich kombinieren und seinen ganz eigenen Stil ausdrücken.
Zur Einzigartigkeit kommt für mich auch die Leistbarkeit, z.B. von Designstücken. Bei mir in der «kostbar» gibt es auch sogenannte Fast-Fashion-Teile, denn meinem Empfinden nach sind das auch schöne Stücke, die es verdient haben, weiter geliebt zu werden, wenn der Trend schon vorbei ist.
![]()
Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Immer bewussteres Konsumieren. Dort, wo es möglich ist, Secondhand zu wählen. Ich kenne es zum Beispiel, dass man Kleider von jemand anderem noch weiterträgt, weil es Freude macht. Alle meine Handys, die ich gekauft habe, waren Secondhand. Ich sehe das Potenzial in schon bestehenden Artikeln. Ich ernähre mich gerne vegetarisch und bin mir bewusst, dass man den eigenen Konsum immer wieder neu erfinden kann.
![]()
Welche Vision hast du für die «kostbar» in der Luzerner Neustadt?
Die Location eignet sich für diverse Anlassarten. Einerseits gibt es den Teil des Secondhand-Ladens voller Kostbarkeiten. Es ist ein Verkaufs- und Ausstellungsort für Kleidungsstücke und Accessoires, die Personen weiterverkaufen möchten, als auch eine Plattform für kreative Menschen aus der Umgebung, die beispielsweise selber nähen und hier ihre eigenen Kreationen zeigen. Ausserdem sehe ich es als einen Fundus und Showroom für Stylist*innen zum Ausleihen von ausgefallenen Kleidern für ihre Fotoshootings, anstatt neue Kleider zu kaufen. Das Bistro ist offen für diverse Ideen wie Pop-ups von Menschen, die backen, kochen, Drinks für Leib und Seele anbieten. Es ist ein Ort für Austausch und neues Zusammenarbeiten. Es ist schön, mir und anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich zu zeigen und ihrer Passion zu folgen.
![]()
![]()
Welches sind die schönen Seiten, und was sind die Herausforderungen, einen eigenen Laden zu leiten?
Durch den Laden habe ich schon viele tolle Menschen kennengelernt. Er bietet mir die Möglichkeit, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten. Ausserdem macht es Spass, Menschen für Secondhand zu inspirieren und durch das Angebot ein neues Interesse zu wecken. Durch die freiere Einteilung meiner Arbeitszeiten kann ich meinen Hund Enzo bei mir haben, einen Traum, den ich mir verwirklichen durfte. Dieser Laden vereint diverse Interessen von mir wie Mode, Styling, Kleiderverwaltung, Verkauf, Social Media, das Produzieren von Content, Online-Marketing und vieles mehr. Zu den Herausforderungen zählt für mich der Druck, konstant zu performen, und schlussendlich eine grössere Verantwortung zu tragen.
![]()
Was ist eine deiner liebsten Erinnerungen im Leben?
Eine der liebsten Erinnerungen in meinem Leben ist, als ich meinen Hund Enzo vor vier Jahren getroffen und zu mir nach Hause gebracht habe. Es war wie ein Wunder, dass alles so geklappt hat, wie es damals lief. Mit einem kleinen Wesen beschenkt zu werden, mit ihm so viel Freude zu teilen, das war einer der schönsten Tage in meinem Leben.
Wo ist ein Lieblingsort in Luzern, ausser der «kostbar», an den du mit Freund*innen hingehen würdest?
Ich liebe es, Zeit auf der Museggmauer zu verbringen. Im Sommer dort mit Blick über die ganze Stadt zu essen, hat etwas Therapeutisches. Ein anderer Platz, an den ich gehen würde, ist dieses eine Bänkli im Konservatorium. Die Aussicht über den See ist sehr eindrücklich. Und die Orte am See allgemein gefallen mir in Luzern besonders.
Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...
...zwei Secondhand-Stücke kaufen und daraus etwas Neues kreieren.
![]()
Vielen Dank, Elena, für deine Offenheit und die schönen Momente in der «kostbar».
_
von Fabienne Steiner
am 10.11.2025
Fotos
© Fabienne Steiner für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Hoi Elena, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?
Tierlieb, witzig (I guess, lacht) und neugierig.
Was ist für dich «kostbar»?
Mein Hund Enzo ist für mich «kostbar». Alle meine engen Menschen sind für mich «kostbar».
Die «kostbar» ist für mich ein Ort der Begegnung, der Kreativität und für alle.
Was gefällt dir an Secondhand-Kleidung?
Mir gefällt besonders die Individualität daran. Man findet Einzelstücke, die man gerade in anderen Kleiderläden nicht kaufen kann. Man kann Teile zu neuem Leben erwecken, persönlich kombinieren und seinen ganz eigenen Stil ausdrücken.
Zur Einzigartigkeit kommt für mich auch die Leistbarkeit, z.B. von Designstücken. Bei mir in der «kostbar» gibt es auch sogenannte Fast-Fashion-Teile, denn meinem Empfinden nach sind das auch schöne Stücke, die es verdient haben, weiter geliebt zu werden, wenn der Trend schon vorbei ist.
Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Immer bewussteres Konsumieren. Dort, wo es möglich ist, Secondhand zu wählen. Ich kenne es zum Beispiel, dass man Kleider von jemand anderem noch weiterträgt, weil es Freude macht. Alle meine Handys, die ich gekauft habe, waren Secondhand. Ich sehe das Potenzial in schon bestehenden Artikeln. Ich ernähre mich gerne vegetarisch und bin mir bewusst, dass man den eigenen Konsum immer wieder neu erfinden kann.
Welche Vision hast du für die «kostbar» in der Luzerner Neustadt?
Die Location eignet sich für diverse Anlassarten. Einerseits gibt es den Teil des Secondhand-Ladens voller Kostbarkeiten. Es ist ein Verkaufs- und Ausstellungsort für Kleidungsstücke und Accessoires, die Personen weiterverkaufen möchten, als auch eine Plattform für kreative Menschen aus der Umgebung, die beispielsweise selber nähen und hier ihre eigenen Kreationen zeigen. Ausserdem sehe ich es als einen Fundus und Showroom für Stylist*innen zum Ausleihen von ausgefallenen Kleidern für ihre Fotoshootings, anstatt neue Kleider zu kaufen. Das Bistro ist offen für diverse Ideen wie Pop-ups von Menschen, die backen, kochen, Drinks für Leib und Seele anbieten. Es ist ein Ort für Austausch und neues Zusammenarbeiten. Es ist schön, mir und anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich zu zeigen und ihrer Passion zu folgen.
Welches sind die schönen Seiten, und was sind die Herausforderungen, einen eigenen Laden zu leiten?
Durch den Laden habe ich schon viele tolle Menschen kennengelernt. Er bietet mir die Möglichkeit, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten. Ausserdem macht es Spass, Menschen für Secondhand zu inspirieren und durch das Angebot ein neues Interesse zu wecken. Durch die freiere Einteilung meiner Arbeitszeiten kann ich meinen Hund Enzo bei mir haben, einen Traum, den ich mir verwirklichen durfte. Dieser Laden vereint diverse Interessen von mir wie Mode, Styling, Kleiderverwaltung, Verkauf, Social Media, das Produzieren von Content, Online-Marketing und vieles mehr. Zu den Herausforderungen zählt für mich der Druck, konstant zu performen, und schlussendlich eine grössere Verantwortung zu tragen.
Was ist eine deiner liebsten Erinnerungen im Leben?
Eine der liebsten Erinnerungen in meinem Leben ist, als ich meinen Hund Enzo vor vier Jahren getroffen und zu mir nach Hause gebracht habe. Es war wie ein Wunder, dass alles so geklappt hat, wie es damals lief. Mit einem kleinen Wesen beschenkt zu werden, mit ihm so viel Freude zu teilen, das war einer der schönsten Tage in meinem Leben.
Wo ist ein Lieblingsort in Luzern, ausser der «kostbar», an den du mit Freund*innen hingehen würdest?
Ich liebe es, Zeit auf der Museggmauer zu verbringen. Im Sommer dort mit Blick über die ganze Stadt zu essen, hat etwas Therapeutisches. Ein anderer Platz, an den ich gehen würde, ist dieses eine Bänkli im Konservatorium. Die Aussicht über den See ist sehr eindrücklich. Und die Orte am See allgemein gefallen mir in Luzern besonders.
Ergänze den Satz: Wie wär’s mal mit...
...zwei Secondhand-Stücke kaufen und daraus etwas Neues kreieren.
Vielen Dank, Elena, für deine Offenheit und die schönen Momente in der «kostbar».
_
von Fabienne Steiner
am 10.11.2025
Fotos
© Fabienne Steiner für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Kollektiv LITER» Basel: Im Gespräch mit Caterina John, Nina Hurni und Sina Aebischer
Im Gespräch mit dem
«Kollektiv LITER», bestehend aus Caterina John, Nina Hurni und Sina Aebischer
tauchen wir ein in ein Schreiben, das fliesst, sich vermischt und neu formt. Drei Stimmen, die gemeinsam Wörter verhandeln, Grenzen auflösen und im Prozess kollektiver Kreativität Halt finden. Wir sprechen über Mut, Wandel und die Kunst, gemeinsam zu schreiben, ohne zu wissen, wem ein Satz eigentlich gehört.
![]()
Hallo Caterina John, Nina Hurni und Sina Aebischer. Beschreibt euch jeweils gegenseitig in Drei Worten.
Caterina: abgebrüht, wortreich, krass
Nina: kreativ, schelmisch, abenteuerlustig
Sina: sprudelnd, geheimniskrämerisch, grosszügig
«Kollektiv LITER» – weshalb der Name und wie kamt ihr zusammen?
Der Name kommt ursprünglich von einem Grafiker-Freund, der eine Idee für ein Literaturmagazin hatte. Wir kennen uns aus Jugendtagen, von der Uni, dem Schreiben. Dass wir irgendwann zusammen etwas machen wollten, war schon lange ein Thema. Die Idee für das Literaturmagazin «LITER», das sich Flüssigkeiten zum Thema nehmen sollte, fanden wir toll. Im Prozess merkten wir dann schnell, dass wir lieber selbst in der schreibenden Rolle sein wollten, als mit Open Calls oder so andere Schreibende zu suchen. Gemeinsam hatten wir den Mut und die Motivation, ein kollektives Schreibprojekt zu beginnen.
![]()
Euer «Kollektiv LITER» versteht sich als «flüssig» und sucht die Zwischenräume. Was bedeutet dieses Fliessen für euch konkret im künstlerischen Arbeiten und im Zusammen-Sein als Kollektiv?
Kollektives Schreiben – oder auch allgemeiner: Arbeiten – an sich nehmen wir als subversiv und queer wahr. Es ist eine Form von Kunst und besonders Literatur, die in der sogenannten Hochkultur, im Feuilleton, im allgemeinen Literaturdiskurs kaum behandelt wird. Sie widerspricht dem Bild des männlichen, weissen Autorengenies. Das finden wir politisch. Und empowernd. Im Sich-Verflüssigen, Zwischenräume suchen und da Raum schaffen und einnehmen fühlen wir uns bestärkt, eigene Stimmen zu finden und zu schreiben. Das Fliessen im Schreiben zeigt sich, wenn wir gegenseitig Sätze ergänzen oder sich unsere Ideen vermischen, bis unklar ist, wer dem Text was genau beigesteuert hat.
![]()
Flüssigkeit steht oft auch für Verwandlung und Instabilität. Wie geht ihr im kollektiven Prozess mit Veränderung, Reibung oder Auflösung um?
Wir reden drüber. Es gibt keinen Prozess ohne Veränderung. Als wir begonnen haben, zusammen zu schreiben, hatten wir alle etwas Respekt davor, Texte oder Passagen gegenseitig zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen. Diese Unsicherheiten mussten wir irgendwann ansprechen, um Wege zu finden, damit umzugehen und eigene Besitzansprüche an einen geschriebenen Satz abzubauen. Wir waren erstaunt, wie schwer uns das fiel. «Das Auflösen der Enden», unser erstes Buch, das im Januar erscheint, wird noch sehr fest in unseren individuellen Stimmen erzählt. Diese wollen wir in einem nächsten Projekt noch mehr verwischen.
![]()
Wie prägt eure jeweilige Praxis und Persönlichkeit die gemeinsame Zusammenarbeit?
Wir kennen und ergänzen uns sehr gut und haben auch vor dem Kollektiv häufig zusammen geschrieben, dann aber jeweils an eigenen Texten. In der engen Zusammenarbeit zeigten sich Unterschiede im Arbeiten, die uns vorher weniger bewusst waren. Wir schreiben zum Beispiel nicht alle gleich schnell. Und während es für die eine Person wichtig ist, dass ein Satz von Anfang an gut klingt, ist es bei einer anderen Person vielleicht eher ein schnelles Runterschreiben einer Idee, die später ausgearbeitet wird. Diese Unterschiede sind sehr spannend zu beobachten und beeinflussen sich teilweise auch gegenseitig.
Gibt es Momente im Alltag, in denen ihr merkt, dass euer Denken oder Schreiben plötzlich kollektiv wird, also wo sich eure Stimmen vermischen, auch ausserhalb der künstlerischen Arbeit?
Oft fallen wir in kollektive Begeisterung. Und uns manchmal einander ins Wort.
![]()
Wenn ihr nicht gerade an Texten arbeitet: Was nährt euch? Gibt es Rituale, Orte oder Gewohnheiten, die euch verbinden oder unterscheiden?
Uns verbinden viele Wollfäden beim Stricken, gemeinsame Spassgetränke vor dem Hirschi, Rants und Fanmomente.
Nennt Drei Themenbereiche, in welchen ihr euch als Kollektiv verortet.
Körper, Kapitalismus und Frittieröl.
![]()
Wenn «LITER» den Aggregatzustand ändern könnte, in welchem Moment würdet ihr gefrieren und wann verdampfen?
Distanz und lange Pausen lassen uns ein wenig einfrieren: Nina wohnt jetzt nicht mehr in Basel, und das nervt uns ein bisschen. Wenn wir lange Zeit nicht zusammen schreiben, müssen wir erst auftauen, bevor wir uns wieder schreibend finden.
Verdampfen tun wir nach einer Schreibsession, wenn unsere Hirne überhitzen und wir draussen in die kalte Luft treten. Oder wenn wir sooo Freude an uns und einem Satz oder Wort haben. Wenn wir uns anschauen und uns einfach mega toll finden.
Ergänzt den Satz: Wie wär’s mal mit...
...weniger etepetete.
...mehr Menschen, mehr Zusammen, mehr Mut. Mehr einfach mal machen.
...weniger Individualismus.
...etwas mehr zerfliessenden Flow.
![]()
Vielen Dank an Caterina, Nina und Sina für die spannenden Einblicke in ihr kollektives Schaffen.
_
von Ana Brankovic
am 20.10.2025
Fotos
© Soraya Koefer / Kollektiv LITER für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hallo Caterina John, Nina Hurni und Sina Aebischer. Beschreibt euch jeweils gegenseitig in Drei Worten.
Caterina: abgebrüht, wortreich, krass
Nina: kreativ, schelmisch, abenteuerlustig
Sina: sprudelnd, geheimniskrämerisch, grosszügig
«Kollektiv LITER» – weshalb der Name und wie kamt ihr zusammen?
Der Name kommt ursprünglich von einem Grafiker-Freund, der eine Idee für ein Literaturmagazin hatte. Wir kennen uns aus Jugendtagen, von der Uni, dem Schreiben. Dass wir irgendwann zusammen etwas machen wollten, war schon lange ein Thema. Die Idee für das Literaturmagazin «LITER», das sich Flüssigkeiten zum Thema nehmen sollte, fanden wir toll. Im Prozess merkten wir dann schnell, dass wir lieber selbst in der schreibenden Rolle sein wollten, als mit Open Calls oder so andere Schreibende zu suchen. Gemeinsam hatten wir den Mut und die Motivation, ein kollektives Schreibprojekt zu beginnen.

Euer «Kollektiv LITER» versteht sich als «flüssig» und sucht die Zwischenräume. Was bedeutet dieses Fliessen für euch konkret im künstlerischen Arbeiten und im Zusammen-Sein als Kollektiv?
Kollektives Schreiben – oder auch allgemeiner: Arbeiten – an sich nehmen wir als subversiv und queer wahr. Es ist eine Form von Kunst und besonders Literatur, die in der sogenannten Hochkultur, im Feuilleton, im allgemeinen Literaturdiskurs kaum behandelt wird. Sie widerspricht dem Bild des männlichen, weissen Autorengenies. Das finden wir politisch. Und empowernd. Im Sich-Verflüssigen, Zwischenräume suchen und da Raum schaffen und einnehmen fühlen wir uns bestärkt, eigene Stimmen zu finden und zu schreiben. Das Fliessen im Schreiben zeigt sich, wenn wir gegenseitig Sätze ergänzen oder sich unsere Ideen vermischen, bis unklar ist, wer dem Text was genau beigesteuert hat.

Flüssigkeit steht oft auch für Verwandlung und Instabilität. Wie geht ihr im kollektiven Prozess mit Veränderung, Reibung oder Auflösung um?
Wir reden drüber. Es gibt keinen Prozess ohne Veränderung. Als wir begonnen haben, zusammen zu schreiben, hatten wir alle etwas Respekt davor, Texte oder Passagen gegenseitig zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen. Diese Unsicherheiten mussten wir irgendwann ansprechen, um Wege zu finden, damit umzugehen und eigene Besitzansprüche an einen geschriebenen Satz abzubauen. Wir waren erstaunt, wie schwer uns das fiel. «Das Auflösen der Enden», unser erstes Buch, das im Januar erscheint, wird noch sehr fest in unseren individuellen Stimmen erzählt. Diese wollen wir in einem nächsten Projekt noch mehr verwischen.

Wie prägt eure jeweilige Praxis und Persönlichkeit die gemeinsame Zusammenarbeit?
Wir kennen und ergänzen uns sehr gut und haben auch vor dem Kollektiv häufig zusammen geschrieben, dann aber jeweils an eigenen Texten. In der engen Zusammenarbeit zeigten sich Unterschiede im Arbeiten, die uns vorher weniger bewusst waren. Wir schreiben zum Beispiel nicht alle gleich schnell. Und während es für die eine Person wichtig ist, dass ein Satz von Anfang an gut klingt, ist es bei einer anderen Person vielleicht eher ein schnelles Runterschreiben einer Idee, die später ausgearbeitet wird. Diese Unterschiede sind sehr spannend zu beobachten und beeinflussen sich teilweise auch gegenseitig.
Gibt es Momente im Alltag, in denen ihr merkt, dass euer Denken oder Schreiben plötzlich kollektiv wird, also wo sich eure Stimmen vermischen, auch ausserhalb der künstlerischen Arbeit?
Oft fallen wir in kollektive Begeisterung. Und uns manchmal einander ins Wort.

Wenn ihr nicht gerade an Texten arbeitet: Was nährt euch? Gibt es Rituale, Orte oder Gewohnheiten, die euch verbinden oder unterscheiden?
Uns verbinden viele Wollfäden beim Stricken, gemeinsame Spassgetränke vor dem Hirschi, Rants und Fanmomente.
Nennt Drei Themenbereiche, in welchen ihr euch als Kollektiv verortet.
Körper, Kapitalismus und Frittieröl.

Wenn «LITER» den Aggregatzustand ändern könnte, in welchem Moment würdet ihr gefrieren und wann verdampfen?
Distanz und lange Pausen lassen uns ein wenig einfrieren: Nina wohnt jetzt nicht mehr in Basel, und das nervt uns ein bisschen. Wenn wir lange Zeit nicht zusammen schreiben, müssen wir erst auftauen, bevor wir uns wieder schreibend finden.
Verdampfen tun wir nach einer Schreibsession, wenn unsere Hirne überhitzen und wir draussen in die kalte Luft treten. Oder wenn wir sooo Freude an uns und einem Satz oder Wort haben. Wenn wir uns anschauen und uns einfach mega toll finden.
Ergänzt den Satz: Wie wär’s mal mit...
...weniger etepetete.
...mehr Menschen, mehr Zusammen, mehr Mut. Mehr einfach mal machen.
...weniger Individualismus.
...etwas mehr zerfliessenden Flow.

Vielen Dank an Caterina, Nina und Sina für die spannenden Einblicke in ihr kollektives Schaffen.
_
von Ana Brankovic
am 20.10.2025
Fotos
© Soraya Koefer / Kollektiv LITER für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Franck Areal» Basel: Im Gespräch mit Julia Füzesi und Lea Schneider
Auf dem
«Franck Areal» in Basel wächst eine lebendige Mischung aus Kultur, Handwerk und Gemeinschaft. Es ist ein Ort im Wandel, getragen von Menschen, die Stadtentwicklung neu denken. Wir waren im Gespräch mit Julia Füzesi und Lea Schneider über geteilte Räume, nachbarschaftliche Visionen und die Frage, wie aus Zwischennutzung nachhaltige Stadtverbindung wird.
![]()
![]()
Liebe Julia und Lea, stellt euch gegenseitig gerne in einem Satz vor.
Julia: Das ist Lea. Sie jongliert gekonnt mehrere Projekte, weil sie mit Begeisterung bei der Sache ist, vernetzt Menschen und moderiert auch in langen Diskussionen ruhig und geduldig und macht den besten Mate-Sirup!
Lea: Das ist Julia. Expertin darin, den Überblick zu behalten, auch in chaotischen Momenten Ruhe zu bewahren und das richtige Getränk für jede Situation bereit zu haben.
![]()
Welche Rolle spielt das «Franck Areal» für die Nachbarschaft und die lokale Kulturszene?
Das «Franck Areal» soll ein Ort sein, der im Austausch mit der Nachbarschaft und der lokalen Kulturszene entsteht und weiterwächst. Das Areal wird vor allem durch die Menschen definiert, die hier ihrem Schaffen nachgehen und die Räume mit ihren unterschiedlichen Projekten beleben. So entsteht ein Nährboden für Austausch und Synergien, und die Resultate daraus fliessen wiederum zurück in die Nachbarschaft und Kulturszene – ganz im Sinne eines nachhaltigen Kreislaufs, der uns hier in vielen Formen beschäftigt.
![]()
![]()
Wie wär’s mal mit einem Blick in die Zukunft: Welche Vision habt ihr für das Franck Areal? Wie soll sich der Ort in Basel langfristig entwickeln?
Das «Franck Areal» wird jetzt schon immer belebter – in einigen Jahren soll hier jedes Gebäude und jede Ecke bespielt sein. Der Standort bringt mit seiner Lage zwischen Industrie und Wohnquartier auch gewisse Herausforderungen mit sich. Künftig soll das Areal ein Scharnier der Nachbarschaft und des unmittelbaren Quartiers zum Rest der Stadt werden. Die Entwicklung in den nächsten Jahren soll also nicht nur immer mehr Nutzer:innen auf das Franck Areal bringen, sondern auch eine interessierte Öffentlichkeit aus ganz Basel und darüber hinaus. Auf dem Areal entsteht passend zu unseren Schwerpunkten also nebst neuem Wohnraum auch ein Austauschort für das Quartier, die Kulturszene und die Kreislaufwirtschaft. Es wird ein Ort für den Kaffee an der Sonne nach dem Spaziergang in den Langen Erlen, fürs Box-Training nach dem Feierabend, für einen Workshop-Besuch zu Re-Use am Bau, für die Tanzperformance der neusten lokalen Compagnie und vieles mehr.
![]()
![]()
Was sind aktuell die groessten Herausforderungen bei der Entwicklung oder im Betrieb des Areals?
Bisher haben wir viel im Hintergrund geplant. Das «Franck Areal» ist erst seit Kurzem als eigenständige Parzelle im Grundbuch von Basel-Stadt eingetragen – wir können also jetzt erst richtig in die Umsetzung gehen. Jetzt starten also viele parallele Baustellen, erste Nutzer:innen ziehen auf das Areal, und es finden immer mehr Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter statt – das bereitet natürlich viel Freude und bringt viele Chancen mit sich. Die damit verbundene Koordination zwischen allen Beteiligten ist aber sicherlich eine der grössten Herausforderungen, vor der wir täglich stehen.
![]()
Welche Momente im Alltag inspirieren euch persönlich am meisten?
Beide: Ein grosser Teil unserer Arbeit ist immer auch, das «Franck Areal» verschiedensten Menschen zu zeigen und uns mit ihnen über den Ort und seine Potenziale auszutauschen. Diese vielfältigen Begegnungen mit kreativen und beeindruckenden Persönlichkeiten sind sehr inspirierend – und diese Inspiration nehmen wir auch mit in unseren persönlichen Alltag. Und weil wir nie inspiriert genug sind, sind wir auch immer offen für neue Ideen und Projekte – wer das also liest und selbst etwas realisieren möchte: Schreibt uns!
![]()
![]()
Wenn ihr Basel jemandem zeigen würdet, der noch nie hier war, welchen Ort würdet ihr unbedingt als Erstes besuchen – abseits vom «Franck Areal» – und weshalb?
Beide: Für uns ist es natürlich auch immer ein Ansporn zu sehen, was auf dem «Franck Areal» alles noch entstehen kann und wird. Daher zieht es uns oft auch mit Besuch aufs Gundeldinger Feld als Referenzprojekt. Die erfahrenen Basler Projektentwickler:innen Barbara Buser und Eric Honegger, die auch mit hinter der Entwicklung des Franck Areals stehen, haben dort bereits gezeigt, was alles auf einem solchen Areal entstehen kann. Für das Feierabendbier gehen wir dann ins Hirschi, weil wir uns schon nicht nur mit Arealentwicklung beschäftigen. Und am nächsten Tag dann zum Blumenpflücken aufs Bruderholz.
![]()
![]()
Welche Frage habt ihr euch selbst schon lange gestellt, aber bisher keine klare Antwort gefunden?
Julia: Wie viele Realitäten existieren gleichzeitig in einem Moment?
Lea: Wie komme ich auf genug Stunden Schlaf und kann trotzdem in all den spannenden Projekten mitwirken, von denen ich gerne Teil sein möchte?
![]()
![]()
Wovon braucht die Schweiz mehr? Wovon weniger?
Beide: Mehr Offenheit und Haltung, weniger Diskriminierung und «Neutralität».
Wie wär’s mal mit...
...einer Tasse Kaffee im neuen Bistro «Francka»?
![]()
Vielen Dank an Julia und Lea für die spannenden Einblicke in ihre Arbeit und das «Franck Areal».
_
von Ana Brankovic
am 13.10.2025
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Liebe Julia und Lea, stellt euch gegenseitig gerne in einem Satz vor.
Julia: Das ist Lea. Sie jongliert gekonnt mehrere Projekte, weil sie mit Begeisterung bei der Sache ist, vernetzt Menschen und moderiert auch in langen Diskussionen ruhig und geduldig und macht den besten Mate-Sirup!
Lea: Das ist Julia. Expertin darin, den Überblick zu behalten, auch in chaotischen Momenten Ruhe zu bewahren und das richtige Getränk für jede Situation bereit zu haben.
Welche Rolle spielt das «Franck Areal» für die Nachbarschaft und die lokale Kulturszene?
Das «Franck Areal» soll ein Ort sein, der im Austausch mit der Nachbarschaft und der lokalen Kulturszene entsteht und weiterwächst. Das Areal wird vor allem durch die Menschen definiert, die hier ihrem Schaffen nachgehen und die Räume mit ihren unterschiedlichen Projekten beleben. So entsteht ein Nährboden für Austausch und Synergien, und die Resultate daraus fliessen wiederum zurück in die Nachbarschaft und Kulturszene – ganz im Sinne eines nachhaltigen Kreislaufs, der uns hier in vielen Formen beschäftigt.
Wie wär’s mal mit einem Blick in die Zukunft: Welche Vision habt ihr für das Franck Areal? Wie soll sich der Ort in Basel langfristig entwickeln?
Das «Franck Areal» wird jetzt schon immer belebter – in einigen Jahren soll hier jedes Gebäude und jede Ecke bespielt sein. Der Standort bringt mit seiner Lage zwischen Industrie und Wohnquartier auch gewisse Herausforderungen mit sich. Künftig soll das Areal ein Scharnier der Nachbarschaft und des unmittelbaren Quartiers zum Rest der Stadt werden. Die Entwicklung in den nächsten Jahren soll also nicht nur immer mehr Nutzer:innen auf das Franck Areal bringen, sondern auch eine interessierte Öffentlichkeit aus ganz Basel und darüber hinaus. Auf dem Areal entsteht passend zu unseren Schwerpunkten also nebst neuem Wohnraum auch ein Austauschort für das Quartier, die Kulturszene und die Kreislaufwirtschaft. Es wird ein Ort für den Kaffee an der Sonne nach dem Spaziergang in den Langen Erlen, fürs Box-Training nach dem Feierabend, für einen Workshop-Besuch zu Re-Use am Bau, für die Tanzperformance der neusten lokalen Compagnie und vieles mehr.
Was sind aktuell die groessten Herausforderungen bei der Entwicklung oder im Betrieb des Areals?
Bisher haben wir viel im Hintergrund geplant. Das «Franck Areal» ist erst seit Kurzem als eigenständige Parzelle im Grundbuch von Basel-Stadt eingetragen – wir können also jetzt erst richtig in die Umsetzung gehen. Jetzt starten also viele parallele Baustellen, erste Nutzer:innen ziehen auf das Areal, und es finden immer mehr Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter statt – das bereitet natürlich viel Freude und bringt viele Chancen mit sich. Die damit verbundene Koordination zwischen allen Beteiligten ist aber sicherlich eine der grössten Herausforderungen, vor der wir täglich stehen.
Welche Momente im Alltag inspirieren euch persönlich am meisten?
Beide: Ein grosser Teil unserer Arbeit ist immer auch, das «Franck Areal» verschiedensten Menschen zu zeigen und uns mit ihnen über den Ort und seine Potenziale auszutauschen. Diese vielfältigen Begegnungen mit kreativen und beeindruckenden Persönlichkeiten sind sehr inspirierend – und diese Inspiration nehmen wir auch mit in unseren persönlichen Alltag. Und weil wir nie inspiriert genug sind, sind wir auch immer offen für neue Ideen und Projekte – wer das also liest und selbst etwas realisieren möchte: Schreibt uns!
Wenn ihr Basel jemandem zeigen würdet, der noch nie hier war, welchen Ort würdet ihr unbedingt als Erstes besuchen – abseits vom «Franck Areal» – und weshalb?
Beide: Für uns ist es natürlich auch immer ein Ansporn zu sehen, was auf dem «Franck Areal» alles noch entstehen kann und wird. Daher zieht es uns oft auch mit Besuch aufs Gundeldinger Feld als Referenzprojekt. Die erfahrenen Basler Projektentwickler:innen Barbara Buser und Eric Honegger, die auch mit hinter der Entwicklung des Franck Areals stehen, haben dort bereits gezeigt, was alles auf einem solchen Areal entstehen kann. Für das Feierabendbier gehen wir dann ins Hirschi, weil wir uns schon nicht nur mit Arealentwicklung beschäftigen. Und am nächsten Tag dann zum Blumenpflücken aufs Bruderholz.
Welche Frage habt ihr euch selbst schon lange gestellt, aber bisher keine klare Antwort gefunden?
Julia: Wie viele Realitäten existieren gleichzeitig in einem Moment?
Lea: Wie komme ich auf genug Stunden Schlaf und kann trotzdem in all den spannenden Projekten mitwirken, von denen ich gerne Teil sein möchte?
Wovon braucht die Schweiz mehr? Wovon weniger?
Beide: Mehr Offenheit und Haltung, weniger Diskriminierung und «Neutralität».
Wie wär’s mal mit...
...einer Tasse Kaffee im neuen Bistro «Francka»?
Vielen Dank an Julia und Lea für die spannenden Einblicke in ihre Arbeit und das «Franck Areal».
_
von Ana Brankovic
am 13.10.2025
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Carambolage» Basel: Im Gespräch mit dem Kollektiv
An der Ecke Mattenstrasse-Erlenstrasse bietet die «Carambolage» schon seit 2015 eine gemütliche Zuflucht im von Umbruch gezeichneten Quartier. Die kollektiv und ehrenamtlich geführte Bar bietet Platz für kleine feine Konzerte, politische Debatten und Quartierbeizfeeling. Mit Sarah, Leo, Viola, Meret, Rabea und Jules, dem Kollektiv der «Carambi», sprachen wir über besondere Begegnungen und darüber, wieso dieser Ort wichtig ist.
![]()
Hey«Carambolage» Kollektiv, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Momentan sind wir ein sechsköpfiges Kollektiv unbeabsichtigt bestehend aus Frauen und genderqueeren Personen. Wir schmieden seit 9 Jahren gute Pläne, sind manchmal etwas chaotisch in der Durchführung und die Spinnweben arbeiten immer etwas schneller als wir.
![]()
«Carambolage» – was ist das und wie kam es dazu?
Die «Carambolage» ist ein kollektiv selbstverwalteter Ort seit 2015. Wir betreiben eine Bar mit Raum für Begegnung, Austausch und Quartierbeiz. Dies machen wir unentgeltlich. Wir sind ein Veranstaltungsort für Menschen, die Freude an Musik, Film, Ausstellungen und politischen Auseinandersetzungen haben. Wir haben den Wunsch nach hierarchie- und diskriminierungsfreieren Räumen. Der Ort wird von verschiedenen Menschen durch gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit belebt und getragen.
![]()
Was ist die schönste Anekdote oder Begegnung, die ihr von eurem Alltag in der Carambi erzählen könnt?
Die unendlich vielen Begegnungen mit Menschen, die wir kennen und die wir noch nicht kennen und die manchmal zu Bekannten und Freund*innen werden, sodass zeitweise die «Carambolage» ein zweites Zuhause wird. Das Aufwachen auf den Bänken durch belustigte Blicke des Quartiers sind längerfristig jedoch nicht erholsam. Erfrischende Begegnungen waren: Besuch von Musical-Theater-Crews und internationalen Sport-Trainer*innen, Quartier-Bewohnenden, grosse Bands, die das Kleine suchen, Menschen, die uns viel Geld für den Kauf unserer Bar anboten, Menschen, die uns verklagen wollten, Menschen, die die «Carambi» mit gebrochenen Herzen füllten, Menschen, die frisch in der Stadt angekommen sind und Halt und Freude fanden, Menschen, die uns von ihrem Leben erzählen, Menschen, die bei uns kurz durchatmen.
![]()
Was kann Mensch an einem typischen «Carambolage»-Abend so erleben?
Unser Programm planen wir so, dass für viele etwas dabei ist. Es gibt gemütliche Bar-Abende, es gibt feine Konzerte gegen Kollekte, spannende Film-Abende, Kleider-Flick- und Mal-Abende, politische Veranstaltungen und Austausch, leckere und nicht maximal-teure Getränke, Spieleabende, Karaoke und dazwischen immer wieder Überraschungen. Ein Ort, an den du mit oder ohne Freund*innen kommst oder mit Neuen gehst, wenn du magst.
![]()
Welche Bedeutung hat die «Carambolage» für das Quartier und welche Werte liegen euch besonders am Herzen für den Raum den ihr darin bietet?
Die «Carambolage» gibt es nun seit über 16 Jahren, also auch schon zu NT-Areal-Zeiten (ehemaliges Areal auf dem Erlenmatt, auf dem es viel «Freiräume» gab). Das Quartier und die Bewohner*innen sind uns wichtig und sind immer eine wichtige Referenz. Es gibt Zusammenarbeiten mit Quartier-Projekten. Wir sind ein lang bestehender Raum, den die Menschen im Quartier und aus der Nachbar*innenschaft schätzen. In einem Quartier in dem viel Veränderung, Aufwertung und Verdrängung stattfindet. Aus diesem Grund haben wir immer wieder Quartier-Bewohner*innen eingeladen und mit «Hände-Weg-Vom-Rosental» uns für den Erhalt von günstigem Wohnraum etc. eingesetzt. Die benachbarte Schwarze Erle-Besetzung kam und wurde gegangen, das Mattenstrasse-Hausprojekt gewann den Häuserkampf, Menschen wurden aus den Häusern geworfen, andere organisierten sich. Wir sind wohl einer der letzten Orte für günstiges Bier. Unsere Werte dabei sind: keine Diskriminierung, alle sollten sich wohlfühlen können und stetig arbeiten wir daran, dies auch umzusetzen.
![]()
Wenn Geld und Realismus keine Rolle spielen würden: Was ist das Ideale Zukunftsbild der «Carambolage»?
Das ist eine tolle Frage, denn weder Geld noch Realismus herrschen in der «Carambi», vielmehr deren Gegenteil: Ohne Idealismus würde bei uns nicht viel laufen und was wir an Geld nicht haben, machen wir mit kreativen Ideen und einem tollen Netzwerk engagierter Menschen wett. Das macht die «Carambi» wohl auch aus. Es ist schön zu merken, dass es so funktioniert, auch wenn wir immer wieder in Kapazitätsengpässe kommen. Das wäre also ein Wunsch: noch mehr Menschen und mehr Kapazitäten.
![]()
Was braucht es in Basel mehr, was weniger?
Weniger Aufwertung, mehr beständige, selbstverwaltete Orte, mehr günstigen Wohnraum. Weniger rassistische Polizeikontrollen, mehr Raum für alle.
![]()
Wenn ihr als Kollektiv ein Getränk wärt, welches?
Prosecco in allen Varianten; mit Sprudel, mit Immer, mit Gin, mit Eis.
Was macht ihr, wenn ihr nicht in der «Carambolage» seid?
Lohnarbeiten, Schule geben, Arbeitskämpfe unterstützen, Schnitzen, Bücher verkaufen, Kinder betreuen, Räume verwalten, Ausschlafen, Kaffee trinken, andere tolle Bars besuchen und dem Patriarchat die Kniescheibe rauswummern.
Wie wärs mal mit...
...einem Getränk in deiner netten Bar ums Eck?
![]()
Danke Sarah, Leo, Viola, Meret, Rabea und Jules, dass ihr unsere Fragen beantwortet habt!
_
von Nina Hurni
am 21.10.2024
Fotos
© Christina Cattelani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hey«Carambolage» Kollektiv, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Momentan sind wir ein sechsköpfiges Kollektiv unbeabsichtigt bestehend aus Frauen und genderqueeren Personen. Wir schmieden seit 9 Jahren gute Pläne, sind manchmal etwas chaotisch in der Durchführung und die Spinnweben arbeiten immer etwas schneller als wir.

«Carambolage» – was ist das und wie kam es dazu?
Die «Carambolage» ist ein kollektiv selbstverwalteter Ort seit 2015. Wir betreiben eine Bar mit Raum für Begegnung, Austausch und Quartierbeiz. Dies machen wir unentgeltlich. Wir sind ein Veranstaltungsort für Menschen, die Freude an Musik, Film, Ausstellungen und politischen Auseinandersetzungen haben. Wir haben den Wunsch nach hierarchie- und diskriminierungsfreieren Räumen. Der Ort wird von verschiedenen Menschen durch gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit belebt und getragen.

Was ist die schönste Anekdote oder Begegnung, die ihr von eurem Alltag in der Carambi erzählen könnt?
Die unendlich vielen Begegnungen mit Menschen, die wir kennen und die wir noch nicht kennen und die manchmal zu Bekannten und Freund*innen werden, sodass zeitweise die «Carambolage» ein zweites Zuhause wird. Das Aufwachen auf den Bänken durch belustigte Blicke des Quartiers sind längerfristig jedoch nicht erholsam. Erfrischende Begegnungen waren: Besuch von Musical-Theater-Crews und internationalen Sport-Trainer*innen, Quartier-Bewohnenden, grosse Bands, die das Kleine suchen, Menschen, die uns viel Geld für den Kauf unserer Bar anboten, Menschen, die uns verklagen wollten, Menschen, die die «Carambi» mit gebrochenen Herzen füllten, Menschen, die frisch in der Stadt angekommen sind und Halt und Freude fanden, Menschen, die uns von ihrem Leben erzählen, Menschen, die bei uns kurz durchatmen.

Was kann Mensch an einem typischen «Carambolage»-Abend so erleben?
Unser Programm planen wir so, dass für viele etwas dabei ist. Es gibt gemütliche Bar-Abende, es gibt feine Konzerte gegen Kollekte, spannende Film-Abende, Kleider-Flick- und Mal-Abende, politische Veranstaltungen und Austausch, leckere und nicht maximal-teure Getränke, Spieleabende, Karaoke und dazwischen immer wieder Überraschungen. Ein Ort, an den du mit oder ohne Freund*innen kommst oder mit Neuen gehst, wenn du magst.

Welche Bedeutung hat die «Carambolage» für das Quartier und welche Werte liegen euch besonders am Herzen für den Raum den ihr darin bietet?
Die «Carambolage» gibt es nun seit über 16 Jahren, also auch schon zu NT-Areal-Zeiten (ehemaliges Areal auf dem Erlenmatt, auf dem es viel «Freiräume» gab). Das Quartier und die Bewohner*innen sind uns wichtig und sind immer eine wichtige Referenz. Es gibt Zusammenarbeiten mit Quartier-Projekten. Wir sind ein lang bestehender Raum, den die Menschen im Quartier und aus der Nachbar*innenschaft schätzen. In einem Quartier in dem viel Veränderung, Aufwertung und Verdrängung stattfindet. Aus diesem Grund haben wir immer wieder Quartier-Bewohner*innen eingeladen und mit «Hände-Weg-Vom-Rosental» uns für den Erhalt von günstigem Wohnraum etc. eingesetzt. Die benachbarte Schwarze Erle-Besetzung kam und wurde gegangen, das Mattenstrasse-Hausprojekt gewann den Häuserkampf, Menschen wurden aus den Häusern geworfen, andere organisierten sich. Wir sind wohl einer der letzten Orte für günstiges Bier. Unsere Werte dabei sind: keine Diskriminierung, alle sollten sich wohlfühlen können und stetig arbeiten wir daran, dies auch umzusetzen.

Wenn Geld und Realismus keine Rolle spielen würden: Was ist das Ideale Zukunftsbild der «Carambolage»?
Das ist eine tolle Frage, denn weder Geld noch Realismus herrschen in der «Carambi», vielmehr deren Gegenteil: Ohne Idealismus würde bei uns nicht viel laufen und was wir an Geld nicht haben, machen wir mit kreativen Ideen und einem tollen Netzwerk engagierter Menschen wett. Das macht die «Carambi» wohl auch aus. Es ist schön zu merken, dass es so funktioniert, auch wenn wir immer wieder in Kapazitätsengpässe kommen. Das wäre also ein Wunsch: noch mehr Menschen und mehr Kapazitäten.

Was braucht es in Basel mehr, was weniger?
Weniger Aufwertung, mehr beständige, selbstverwaltete Orte, mehr günstigen Wohnraum. Weniger rassistische Polizeikontrollen, mehr Raum für alle.

Wenn ihr als Kollektiv ein Getränk wärt, welches?
Prosecco in allen Varianten; mit Sprudel, mit Immer, mit Gin, mit Eis.
Was macht ihr, wenn ihr nicht in der «Carambolage» seid?
Lohnarbeiten, Schule geben, Arbeitskämpfe unterstützen, Schnitzen, Bücher verkaufen, Kinder betreuen, Räume verwalten, Ausschlafen, Kaffee trinken, andere tolle Bars besuchen und dem Patriarchat die Kniescheibe rauswummern.
Wie wärs mal mit...
...einem Getränk in deiner netten Bar ums Eck?

Danke Sarah, Leo, Viola, Meret, Rabea und Jules, dass ihr unsere Fragen beantwortet habt!
_
von Nina Hurni
am 21.10.2024
Fotos
© Christina Cattelani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«They Performed What They Promised»
Basel: Im Gespräch mit Ness, Saturne, Sebi und Yann
Prostitution, Maischips, t4t, trans* Mystik und $exchanges sind Inspirationsquellen für die Performer*innen Ness, Saturne, Sebi und Yann aus Basel. In ihrem gemeinsamen Debüt «They Performed What They Promised» boten sie gemeinsam beim Container am Hafen Basel im Sommer 2024 eine öffentliche Show. Wo in Basel sie sich am liebsten rumtreiben und was ihre Praxis ausmacht, erzählen sie uns im Gespräch.
English version below
![]()
Hey Ness, Saturne, Sebi und Yann, wer seid ihr? Erzählt mir etwas über euch.
Saturne: Ich bin Performer*in mit einem Hintergrund im Ballett und derzeit spezialisiere ich mich auf Stripping und Pole Dance. Meine Forschung konzentriert sich auf das Konzept des Wertes, untersucht transaktionale Dynamiken, Arbeitsvorstellungen und Vergeltung.
Ness: Aus der klassischen Musik kommend, experimentiere ich nun mit neuen Formen des Performens. Meine aktuelle Forschung befasst sich damit, wie ich Musik in Performances neu kontextualisiere und wie Aktivismus mit mythischen Geschichten zusammenhängt.
Yann: Zurzeit interessiere ich mich für die Emotionalitäten des gemeinsamen Tanzens. Einem anderen Menschen einen Tanz anzubieten, sehe ich als eine Form der Fürsorge.
Sebi: Ich bin Künstler*in aus Kanada mit Sitz in Basel. Ich habe viele Jahre lang als Cembalist*in gearbeitet. Heute arbeite ich mit Performance, Text, Video und Malerei.
![]()
![]()
«They Performed What They Promised» – Worum geht es in der Performance und warum dieser Titel?
Der Titel bezieht sich auf einen Satz, der den Mythos von Iphis und Ianthe abschliesst, den wir in der Performance lose adaptieren: «Iphis erfüllte als Junge, was sie als Mädchen versprach». Es ist zugleich eine Anspielung auf performative Erwartungen in den Welten des Strippings und der klassischen Musik, die wir im Laufe dieses Stücks untersucht haben. In «They Performed What They Promised» befinden sich Iphis und Ianthe irgendwo zwischen vier Bräuten, Loops, Pole Dance, Pergolesi, einem Strip-Club, der Versteigerung von menschlichen Pferden und einer Skulptur des schlafenden Hermaphroditen. Wir bewegen uns spielerisch durch das Publikum, schaffen Dynamiken und navigieren durch Spannungen. Während der gesamten Performance werden Blicke kontrolliert, Erwartungen erfüllt oder gebrochen und Höhepunkte werden hinausgezögert.
![]()
![]()
Wie seid ihr mit Performance in Berührung gekommen? Wie habt ihr zusammen gefunden?
Bei «They Performed What They Promised» war es das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation zusammen aufgetreten sind. Saturne und Yann teilen eine gemeinsame Strip-Praxis und treten zusammen in ihrem Format «Money$exchange» @jin.xclub auf. Sebi und Ness haben sich über ihre frühere gemeinsame musikalische Praxis kennengelernt. Unser Interesse, zusammenzuarbeiten, fand seinen Ursprung in einem gemeinsamen Drang und der Erfahrung, unsere jeweiligen institutionellen und akademischen Praktiken zu dekonstruieren. Wir hatten die Möglichkeit, durch das Förderprogramm des Sparx Studio des Migros-Kulturprozent gemeinsam zu arbeiten und zu forschen.
Was macht ihr sonst so im Leben? Was inspiriert euch?
Prostitution, Maischips, t4t, trans* Mystik und $exchanges.
![]()
Öffentlicher Auftritt beim Hafen Container: Wie habt ihr das erlebt? Welche Fragen stellten Passant*innen und Besuchende?
Während der Proben wurden wir mit verschiedenen Reaktionen von Passanten konfrontiert, wobei uns größtenteils Neugier entgegen schlug, während die unterschiedlichen Realitäten und Nutzungen des Raums ständig präsent waren. «Was macht ihr hier? Verkauft ihr diese Dinge? Ist das ein Flohmarkt?» Die meisten Interaktionen blieben jedoch nonverbal, mit neugierigen, verwirrten Blicken. Es war manchmal eine Herausforderung, aber trotzdem hat es Spass gemacht, in und um den Container herum zu arbeiten.
![]()
Was liebt ihr an Basel? Wo hängt ihr am liebsten rum und warum dort?
Es ist schwer, unsere Gefühle gegenüber Basel in Worte zu fassen, aber hier eine Auswahl unserer Lieblingsorte: Der Keller von La Perla, Sultan, Johanniterbar Café (um Karten zu spielen und drinnen zu rauchen), Margarethenpark (um die Kühe zu sehen), Schützenmattpark, Friends Bar, Don’t Worry Be Happy Bar.
![]()
Wie wär’s mal mit...
...einem freien Palästina, Sudan, Kongo, Kurdistan, Libanon und Jemen
...d em Ende von weißer Vorherrschaft und Imperialismus
...der Entfinanzierung der Polizei
...Respekt gegenüber Sexarbeiter*innen
...Inter$exionalität
![]()
Danke Ness, Saturne, Sebi und Yann.
English version
Prostitution, corn chips, t4t, trans* mysticism and $exchanges are sources of inspiration for the performers Ness, Saturne, Sebi and Yann from Basel. In their joint debut “They Performed What They Promised”, they put on a public show together at Container at Basel’s Harbor in summer 2024. In this interview, they tell us where they like to hang out in Basel and what their practice is all about.
![]()
Hey Ness, Saturne, Sebi and Yann, who are you? Tell me something about yourselves.
Saturne: I am a performer with a ballet background, currently developing a practice in stripping and pole dancing. My research focuses on the concept of value, exploring transactional dynamics, notions of labor, and retribution.
Ness: Coming from a background in classical music, I am now branching out into experimenting with new forms of performance. My current research centers around recontextualizing how I use music in performances and the relationship between activism and mythical stories.
Yann: At the moment, I am interested in the emotional aspects of dancing together, viewing the act of offering someone a dance as a form of care.
Sebi: I am a Canadian artist based in Basel. I trained and worked as a harpsichordist for many years, but now I work with performance, text, video, and painting.
![]()
“They Performed What They Promised” – What is the performance about, and why the title?
The title refers to a sentence concluding the myth of Iphis and Ianthe, which we are loosely adapting in the performance: “Iphis performed as a boy what he promised as a girl.” It also connects to performative expectations in the worlds of stripping and classical music, two areas we explored during the creation of this piece. In “They Performed What They Promised”, Iphis and Ianthe are situated somewhere between four brides, loops, pole dancing, Pergolesi, a strip club, the auctioning of human horses, and a sculpture of the sleeping hermaphrodite. We interact with the audience, playfully creating dynamics and navigating tensions. Throughout the performance, gazes are controlled, expectations are met or disrupted, and climaxes are edged.
![]()
How did you get into performance together?
This was the first time we performed together in this specific constellation. Saturne and Yann share a strip practice, performing together under the format “Money$exchange” @jin.xclub. Sebi and Ness met through their former shared musical practice. Our shared interest in working together arose from a mutual desire to deconstruct the institutional and academic practices we had each learned. We were able to work and research together thanks to the Sparx Studio funding program from the Migros Cultural Percentage.
![]()
What do you do outside of performing? What drives or inspires you?
Being a whore, corn chips, t4t, trans mysticism, and $exchanges.
![]()
Performing in public at the container: What was your experience? What questions did passersby and visitors ask?
While rehearsing, we encountered various reactions from passersby, mostly curiosity, though the clash of different realities and uses of the space was always apparent. “What are you doing? Are you selling these things? Is this a Flohmi (flea market)?” Most interactions remained non-verbal, marked by curious and confused looks. It was sometimes challenging, but still fun to work in and around the container space.
![]()
![]()
What do you love about Basel? Where do you like to hang out?
It’s hard to put our feelings about Basel into words, but here are some of our favorite spots: The basement of La Perla, Sultan, Johanniterbar Café (for playing cards and smoking inside), Margaretenpark (to see the cows), Schützenmattpark, Friends Bar, Don’t Worry Be Happy Bar.
![]()
How about...
...a free Palestine, Sudan, Congo, Kurdistan, Lebanon, and Yemen
...ending white supremacy and imperialism
...defunding the police
...respecting sex workers
...inter$exionality
![]()
Thank you Ness, Saturne, Sebi and Yann.
_
von Ana Brankovic
am 14.10.2024
Fotos / Video
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Zum Projekt ︎
English version below
Hey Ness, Saturne, Sebi und Yann, wer seid ihr? Erzählt mir etwas über euch.
Saturne: Ich bin Performer*in mit einem Hintergrund im Ballett und derzeit spezialisiere ich mich auf Stripping und Pole Dance. Meine Forschung konzentriert sich auf das Konzept des Wertes, untersucht transaktionale Dynamiken, Arbeitsvorstellungen und Vergeltung.
Ness: Aus der klassischen Musik kommend, experimentiere ich nun mit neuen Formen des Performens. Meine aktuelle Forschung befasst sich damit, wie ich Musik in Performances neu kontextualisiere und wie Aktivismus mit mythischen Geschichten zusammenhängt.
Yann: Zurzeit interessiere ich mich für die Emotionalitäten des gemeinsamen Tanzens. Einem anderen Menschen einen Tanz anzubieten, sehe ich als eine Form der Fürsorge.
Sebi: Ich bin Künstler*in aus Kanada mit Sitz in Basel. Ich habe viele Jahre lang als Cembalist*in gearbeitet. Heute arbeite ich mit Performance, Text, Video und Malerei.
«They Performed What They Promised» – Worum geht es in der Performance und warum dieser Titel?
Der Titel bezieht sich auf einen Satz, der den Mythos von Iphis und Ianthe abschliesst, den wir in der Performance lose adaptieren: «Iphis erfüllte als Junge, was sie als Mädchen versprach». Es ist zugleich eine Anspielung auf performative Erwartungen in den Welten des Strippings und der klassischen Musik, die wir im Laufe dieses Stücks untersucht haben. In «They Performed What They Promised» befinden sich Iphis und Ianthe irgendwo zwischen vier Bräuten, Loops, Pole Dance, Pergolesi, einem Strip-Club, der Versteigerung von menschlichen Pferden und einer Skulptur des schlafenden Hermaphroditen. Wir bewegen uns spielerisch durch das Publikum, schaffen Dynamiken und navigieren durch Spannungen. Während der gesamten Performance werden Blicke kontrolliert, Erwartungen erfüllt oder gebrochen und Höhepunkte werden hinausgezögert.
Wie seid ihr mit Performance in Berührung gekommen? Wie habt ihr zusammen gefunden?
Bei «They Performed What They Promised» war es das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation zusammen aufgetreten sind. Saturne und Yann teilen eine gemeinsame Strip-Praxis und treten zusammen in ihrem Format «Money$exchange» @jin.xclub auf. Sebi und Ness haben sich über ihre frühere gemeinsame musikalische Praxis kennengelernt. Unser Interesse, zusammenzuarbeiten, fand seinen Ursprung in einem gemeinsamen Drang und der Erfahrung, unsere jeweiligen institutionellen und akademischen Praktiken zu dekonstruieren. Wir hatten die Möglichkeit, durch das Förderprogramm des Sparx Studio des Migros-Kulturprozent gemeinsam zu arbeiten und zu forschen.
Was macht ihr sonst so im Leben? Was inspiriert euch?
Prostitution, Maischips, t4t, trans* Mystik und $exchanges.
Öffentlicher Auftritt beim Hafen Container: Wie habt ihr das erlebt? Welche Fragen stellten Passant*innen und Besuchende?
Während der Proben wurden wir mit verschiedenen Reaktionen von Passanten konfrontiert, wobei uns größtenteils Neugier entgegen schlug, während die unterschiedlichen Realitäten und Nutzungen des Raums ständig präsent waren. «Was macht ihr hier? Verkauft ihr diese Dinge? Ist das ein Flohmarkt?» Die meisten Interaktionen blieben jedoch nonverbal, mit neugierigen, verwirrten Blicken. Es war manchmal eine Herausforderung, aber trotzdem hat es Spass gemacht, in und um den Container herum zu arbeiten.
Was liebt ihr an Basel? Wo hängt ihr am liebsten rum und warum dort?
Es ist schwer, unsere Gefühle gegenüber Basel in Worte zu fassen, aber hier eine Auswahl unserer Lieblingsorte: Der Keller von La Perla, Sultan, Johanniterbar Café (um Karten zu spielen und drinnen zu rauchen), Margarethenpark (um die Kühe zu sehen), Schützenmattpark, Friends Bar, Don’t Worry Be Happy Bar.
Wie wär’s mal mit...
...einem freien Palästina, Sudan, Kongo, Kurdistan, Libanon und Jemen
...d em Ende von weißer Vorherrschaft und Imperialismus
...der Entfinanzierung der Polizei
...Respekt gegenüber Sexarbeiter*innen
...Inter$exionalität
Danke Ness, Saturne, Sebi und Yann.
English version
Prostitution, corn chips, t4t, trans* mysticism and $exchanges are sources of inspiration for the performers Ness, Saturne, Sebi and Yann from Basel. In their joint debut “They Performed What They Promised”, they put on a public show together at Container at Basel’s Harbor in summer 2024. In this interview, they tell us where they like to hang out in Basel and what their practice is all about.
Hey Ness, Saturne, Sebi and Yann, who are you? Tell me something about yourselves.
Saturne: I am a performer with a ballet background, currently developing a practice in stripping and pole dancing. My research focuses on the concept of value, exploring transactional dynamics, notions of labor, and retribution.
Ness: Coming from a background in classical music, I am now branching out into experimenting with new forms of performance. My current research centers around recontextualizing how I use music in performances and the relationship between activism and mythical stories.
Yann: At the moment, I am interested in the emotional aspects of dancing together, viewing the act of offering someone a dance as a form of care.
Sebi: I am a Canadian artist based in Basel. I trained and worked as a harpsichordist for many years, but now I work with performance, text, video, and painting.
“They Performed What They Promised” – What is the performance about, and why the title?
The title refers to a sentence concluding the myth of Iphis and Ianthe, which we are loosely adapting in the performance: “Iphis performed as a boy what he promised as a girl.” It also connects to performative expectations in the worlds of stripping and classical music, two areas we explored during the creation of this piece. In “They Performed What They Promised”, Iphis and Ianthe are situated somewhere between four brides, loops, pole dancing, Pergolesi, a strip club, the auctioning of human horses, and a sculpture of the sleeping hermaphrodite. We interact with the audience, playfully creating dynamics and navigating tensions. Throughout the performance, gazes are controlled, expectations are met or disrupted, and climaxes are edged.
How did you get into performance together?
This was the first time we performed together in this specific constellation. Saturne and Yann share a strip practice, performing together under the format “Money$exchange” @jin.xclub. Sebi and Ness met through their former shared musical practice. Our shared interest in working together arose from a mutual desire to deconstruct the institutional and academic practices we had each learned. We were able to work and research together thanks to the Sparx Studio funding program from the Migros Cultural Percentage.
What do you do outside of performing? What drives or inspires you?
Being a whore, corn chips, t4t, trans mysticism, and $exchanges.
Performing in public at the container: What was your experience? What questions did passersby and visitors ask?
While rehearsing, we encountered various reactions from passersby, mostly curiosity, though the clash of different realities and uses of the space was always apparent. “What are you doing? Are you selling these things? Is this a Flohmi (flea market)?” Most interactions remained non-verbal, marked by curious and confused looks. It was sometimes challenging, but still fun to work in and around the container space.
What do you love about Basel? Where do you like to hang out?
It’s hard to put our feelings about Basel into words, but here are some of our favorite spots: The basement of La Perla, Sultan, Johanniterbar Café (for playing cards and smoking inside), Margaretenpark (to see the cows), Schützenmattpark, Friends Bar, Don’t Worry Be Happy Bar.
How about...
...a free Palestine, Sudan, Congo, Kurdistan, Lebanon, and Yemen
...ending white supremacy and imperialism
...defunding the police
...respecting sex workers
...inter$exionality
Thank you Ness, Saturne, Sebi and Yann.
_
von Ana Brankovic
am 14.10.2024
Fotos / Video
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Zum Projekt ︎
«Plankton» Basel: Im Gespräch mit Livia Matthäus
Gleich an der Grenze zu Riehen liegt das wohl urbanste Gemüsefeld Basels. Hier ist die grösste Anbaufläche von
«Plankton», einer Gemüsekooperative, die ihre Produkte mit Abos vertreibt. Weitere Gemüsebeete von
«Plankton»
finden sich auf Grünflächen bei Wohnsiedlungen oder in Vorgärten von Altersheimen, über Basel verteilt. Livia Matthäus vom
«Plankton» Projekt kommt uns in Gummistiefeln entgegen, da sie die Kefen geerntet und dort drüben gerade neuen Kohl angesetzt hat. Wir setzen uns unter einen Baum, um zusammen über urbane Landwirtschaft, wahre Produktepreise und den echten Geschmack von Rüebli zu sprechen.
![]()
Hey Livia, wer bist du und was ist deine grösste Macke?
Ich komme aus dem Projekt- und Kulturmanagement. Ich habe vor allem im inklusiven Kulturbereich gearbeitet, zum Beispiel beim Wildwuchsfestival. Ausserdem habe ich das Hyperwerk an der Kunsthochschule abgeschlossen. Dort habe ich mich vertieft mit solidarischen Wirtschaftsmodellen auseinandergesetzt. Von da war es dann nicht mehr so weit zu solidarischer Landwirtschaft. Das bewegt mich seither. Und meine grösste Macke... ich versuche meinen Perfektionismus abzubauen. Landwirtschaft lehrt mich das sehr gut, da kann Perfektion nie erreicht werden. Man könnte immer noch mehr machen.
![]()
Was ist «Plankton» und wie ist das Projekt entstanden?
Tilla und ich, wir haben das Projekt zu zweit gegründet, und es war Anfangs auch noch stark von uns geprägt. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Tilla hat sich viel mit Urban Agricultures auseinandergesetzt vorher, also mit Landwirtschaft im Stadtraum. Wir sind auf dieses Projekt in Vancouver gestossen, bei dem sie in Vorgärten Gemüse angebaut haben. Wir dachten: diese Idee wollen wir nach Basel bringen. Das ist einerseits eine Möglichkeit für uns als Nicht-Landwirtinnen, an Land zu kommen, und bietet ausserdem einen anderen Zugang zu landwirtschaftlicher Produktion, der sich inklusiver gestalten lässt. Und dann haben wir dieses Konzept geschrieben und angefangen – und vieles unterschätzt.
![]()
Welche Ansätze sind für dich beim Anbau zentral?
Wir arbeiten nach dem regenerativen Ansatz, das heisst: wir möchten Hummus aufbauen. Gerade beim Gemüse ist es so, dass man normalerweise Hummus abbaut, weil es eine sehr intensive Bodenbewirtschaftung beinhaltet. Gemüse regenerativ anzubauen ist schwierig, wir wenden deswegen verschiedene Methoden an: Gründüngungen zum Beispiel und Zwischenbegrünungen und wir schauen, dass der Boden immer bedeckt ist, weil das Erosion vermidet. Das ist unser Herzensanliegen: Menschen ernähren, und trotzdem Hummus aufbauen.
![]()
Welche gesellschaftlichen Werte liegen dir bei der Arbeit für «Plankton» am Herzen?
Wir sehen uns als feministisches Landwirtschaftsprojekt, das ist uns sehr wichtig. Nicht um zu sagen, dass wir da alles perfekt machen, aber wir versuchen es und thematisieren im Team, wie wir Landwirtschaft feministisch gestalten können. Und auch der solidarische Aspekt: dass also die Community dieses Projekt trägt, mit den Beiträgen an das Gemüseabo, aber auch durch die Mitarbeit. Die Idee ist, dass die Abonnent*innen auch mitarbeiten auf dem Feld.
![]()
Gibt es bei dieser Mitarbeit der Community Momente oder Anekdoten, die dir besondere Freude bereitet haben?
Lustigerweise haben die Momente, die mir in den Sinn kommen gerade alle mit den Rüebli zu tun. Die kommen einfach gut an. Letzte Woche hat mir zum Beispiel jemand erzählt, dass seine Kinder nie Rüebli gegessen haben – bis sie die «Plankton»-Rüebli entdeckt haben. Dann mussten sie grad ein Abo abschliessen. Und vor Kurzem hat mir auch jemand gesagt, dass es unglaublich sei, zu sehen, wie viel Arbeit in so einem Rüebli steckt. Diese Person war beim Säen dabei und beim Ernten, Rüsten, Einlagern. Dieses Erkennen, was eigentlich drinsteckt in einem Produkt, das finde ich sehr wichtig.
![]()
Welches Gemüse darf für dich auf keinen Fall auf einem Feld fehlen?
Ich verbinde mit dem Kardy sehr viel Schönes. Das ist ein Artischockengewächs, bei dem aber die Stiele gegessen werden und es war das erste spezielle Gemüse, das wir angebaut haben. Der Kardy steht für mich dafür, dass wir neben Rüebli und Co. auch wirklich aussergewöhnliche Sachen im Angebot haben.
![]()
Was ist die grössten Herausforderung bei deiner Arbeit?
Die richtigen Menschen zu finden. Es gibt uns jetzt schon eine Weile und wir hatten immer viele Teamwechsel. Es ist sehr schwierig, ein Team aufzubauen, welches das Projekt auch trägt, das Bock hat, zu diesen landwirtschaftlichen Bedingungen so viel zu investieren. Wir versuchen vieles besser zu machen, wir haben weniger Wochenarbeitszeit als in der klassischen Landwirtschaft und mehr Ferien, aber wir können uns diesen Arbeitsbedingungen natürlich auch nicht ganz entziehen, bei den Lohnansätzen zum Beispiel. Leute zu finden, die Lust haben, langfristig dabei zu sein und sich mit dem Projekt verbinden können, ist nicht so einfach, wie ich das erst gedacht habe.
![]()
Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in einer Gesellschaft deiner Idealvorstellung?
Für mich ist sehr wichtig, dass die Landwirtschaft sichtbar wird, näher zu den Menschen kommt und wieder mehr im Stadtraum stattfindet. Denn wir erfahren in unserer Arbeit immer wieder, dass die Wertschätzung ganz eine andere ist, wenn die Menschen auch sehen können, welche Arbeit hinter ihrem Essen steht. Die Leute sind dann auch eher bereit, den wahren Preis zu zahlen. Das, was wir im Laden sehen, bildet nicht den eigentlichen Produktepreis ab. Diese ganze Produktionskette muss also wieder transparenter werden, dass man sehen kann, was es wirklich bedeutet, Lebensmittel herzustellen.
![]()
Wo bist du wenn nicht auf dem Gemüsefeld?
Das ist jetzt gerade eine fiese Frage, denn es ist gerade Hochsaison. Von Mai bis Juni bin ich sehr viel da. Ich habe aber auch noch ein anderes Gärtli in den Langen Erlen und habe jetzt auch mit dem Schnitzen begonnen, so als Ausgleich.
Wie wär’s mal mit...
...Menschen nachhaltig ernähren und gleichzeitig Ökosysteme regenerieren?
![]()
Vielen liegen Dank für das spannende Gespräch, Livia!
_
von Nina Hurni
am 07.10.2024
Fotos
© Christina Cattelani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hey Livia, wer bist du und was ist deine grösste Macke?
Ich komme aus dem Projekt- und Kulturmanagement. Ich habe vor allem im inklusiven Kulturbereich gearbeitet, zum Beispiel beim Wildwuchsfestival. Ausserdem habe ich das Hyperwerk an der Kunsthochschule abgeschlossen. Dort habe ich mich vertieft mit solidarischen Wirtschaftsmodellen auseinandergesetzt. Von da war es dann nicht mehr so weit zu solidarischer Landwirtschaft. Das bewegt mich seither. Und meine grösste Macke... ich versuche meinen Perfektionismus abzubauen. Landwirtschaft lehrt mich das sehr gut, da kann Perfektion nie erreicht werden. Man könnte immer noch mehr machen.

Was ist «Plankton» und wie ist das Projekt entstanden?
Tilla und ich, wir haben das Projekt zu zweit gegründet, und es war Anfangs auch noch stark von uns geprägt. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Tilla hat sich viel mit Urban Agricultures auseinandergesetzt vorher, also mit Landwirtschaft im Stadtraum. Wir sind auf dieses Projekt in Vancouver gestossen, bei dem sie in Vorgärten Gemüse angebaut haben. Wir dachten: diese Idee wollen wir nach Basel bringen. Das ist einerseits eine Möglichkeit für uns als Nicht-Landwirtinnen, an Land zu kommen, und bietet ausserdem einen anderen Zugang zu landwirtschaftlicher Produktion, der sich inklusiver gestalten lässt. Und dann haben wir dieses Konzept geschrieben und angefangen – und vieles unterschätzt.

Welche Ansätze sind für dich beim Anbau zentral?
Wir arbeiten nach dem regenerativen Ansatz, das heisst: wir möchten Hummus aufbauen. Gerade beim Gemüse ist es so, dass man normalerweise Hummus abbaut, weil es eine sehr intensive Bodenbewirtschaftung beinhaltet. Gemüse regenerativ anzubauen ist schwierig, wir wenden deswegen verschiedene Methoden an: Gründüngungen zum Beispiel und Zwischenbegrünungen und wir schauen, dass der Boden immer bedeckt ist, weil das Erosion vermidet. Das ist unser Herzensanliegen: Menschen ernähren, und trotzdem Hummus aufbauen.

Welche gesellschaftlichen Werte liegen dir bei der Arbeit für «Plankton» am Herzen?
Wir sehen uns als feministisches Landwirtschaftsprojekt, das ist uns sehr wichtig. Nicht um zu sagen, dass wir da alles perfekt machen, aber wir versuchen es und thematisieren im Team, wie wir Landwirtschaft feministisch gestalten können. Und auch der solidarische Aspekt: dass also die Community dieses Projekt trägt, mit den Beiträgen an das Gemüseabo, aber auch durch die Mitarbeit. Die Idee ist, dass die Abonnent*innen auch mitarbeiten auf dem Feld.

Gibt es bei dieser Mitarbeit der Community Momente oder Anekdoten, die dir besondere Freude bereitet haben?
Lustigerweise haben die Momente, die mir in den Sinn kommen gerade alle mit den Rüebli zu tun. Die kommen einfach gut an. Letzte Woche hat mir zum Beispiel jemand erzählt, dass seine Kinder nie Rüebli gegessen haben – bis sie die «Plankton»-Rüebli entdeckt haben. Dann mussten sie grad ein Abo abschliessen. Und vor Kurzem hat mir auch jemand gesagt, dass es unglaublich sei, zu sehen, wie viel Arbeit in so einem Rüebli steckt. Diese Person war beim Säen dabei und beim Ernten, Rüsten, Einlagern. Dieses Erkennen, was eigentlich drinsteckt in einem Produkt, das finde ich sehr wichtig.

Welches Gemüse darf für dich auf keinen Fall auf einem Feld fehlen?
Ich verbinde mit dem Kardy sehr viel Schönes. Das ist ein Artischockengewächs, bei dem aber die Stiele gegessen werden und es war das erste spezielle Gemüse, das wir angebaut haben. Der Kardy steht für mich dafür, dass wir neben Rüebli und Co. auch wirklich aussergewöhnliche Sachen im Angebot haben.

Was ist die grössten Herausforderung bei deiner Arbeit?
Die richtigen Menschen zu finden. Es gibt uns jetzt schon eine Weile und wir hatten immer viele Teamwechsel. Es ist sehr schwierig, ein Team aufzubauen, welches das Projekt auch trägt, das Bock hat, zu diesen landwirtschaftlichen Bedingungen so viel zu investieren. Wir versuchen vieles besser zu machen, wir haben weniger Wochenarbeitszeit als in der klassischen Landwirtschaft und mehr Ferien, aber wir können uns diesen Arbeitsbedingungen natürlich auch nicht ganz entziehen, bei den Lohnansätzen zum Beispiel. Leute zu finden, die Lust haben, langfristig dabei zu sein und sich mit dem Projekt verbinden können, ist nicht so einfach, wie ich das erst gedacht habe.

Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in einer Gesellschaft deiner Idealvorstellung?
Für mich ist sehr wichtig, dass die Landwirtschaft sichtbar wird, näher zu den Menschen kommt und wieder mehr im Stadtraum stattfindet. Denn wir erfahren in unserer Arbeit immer wieder, dass die Wertschätzung ganz eine andere ist, wenn die Menschen auch sehen können, welche Arbeit hinter ihrem Essen steht. Die Leute sind dann auch eher bereit, den wahren Preis zu zahlen. Das, was wir im Laden sehen, bildet nicht den eigentlichen Produktepreis ab. Diese ganze Produktionskette muss also wieder transparenter werden, dass man sehen kann, was es wirklich bedeutet, Lebensmittel herzustellen.

Wo bist du wenn nicht auf dem Gemüsefeld?
Das ist jetzt gerade eine fiese Frage, denn es ist gerade Hochsaison. Von Mai bis Juni bin ich sehr viel da. Ich habe aber auch noch ein anderes Gärtli in den Langen Erlen und habe jetzt auch mit dem Schnitzen begonnen, so als Ausgleich.
Wie wär’s mal mit...
...Menschen nachhaltig ernähren und gleichzeitig Ökosysteme regenerieren?

Vielen liegen Dank für das spannende Gespräch, Livia!
_
von Nina Hurni
am 07.10.2024
Fotos
© Christina Cattelani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Fotolabor «développe derrière» Bern: Im Gespräch mit Franca Wenk und Raffaela Sansoni
Seit 2021 ist das Fotolabor «développe derrière» aka «déde» an der Monbijoustrasse zu finden. Ein Gemeinschaftsprojekt, das Raffaela Sansoni und Franca Wenk mit viel Freude und Engagement führen. In ihrem Minilab entwickeln und digitalisieren sie C41-Filmrollen und sind eine wichtige Anlaufstelle für die analoge Fotografie Community in Bern. Wir haben hinter die Kulissen von «déde» geblicktund geben einen Einblick in eines der schönsten Ateliers in Bern.
![]()
Hallo Franca, hallo Raffaela, wer seid ihr?
Wir sind zwei Freundinnen aus Bern und kennen uns schon seit fast zehn Jahren. Neben der Arbeit beim «déde» sind wir beide sowohl selbstständig als auch in festen Anstellungsverhältnissen tätig.
Franca: Ich arbeite im Bereich der Retrodigitalisierung, bin gleichzeitig als selbstständige Fotografin tätig und Mutter von drei Kindern.
Raffaela: Ich arbeite in der Integrationsförderung beim Bund. Zusätzlich führe ich mein eigenes Schmucklabel «NANA».
![]()
Was ist das «développe derrière» und wie kam es dazu?
Das Fotolabor «déde» haben wir während der Pandemie im Jahr 2020 gegründet und im Februar 2021 eröffnet. «déde» steht kurz für «développe derrière». Unsere Arbeitsplätze befinden sich im «atelier derrière», was ein Gemeinschaftsatelier ist, das Raffaela im Jahr 2018 mit ein paar anderen kreativen Köpfen zur Ausübung ihrer selbständigen Tätigkeit gegründet hat. Franca kam etwas später dazu.
Die Idee vom «développe derrière» entstand während der Pandemie im Jahr 2020, als gleich mehrere Ateliergspänli auszogen und wir vor der Herausforderung standen, die Mietkosten mit reduzierter Besetzung tragen zu müssen. Das Fotolabor «déde» erfüllte sowohl unseren Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt und ermöglichte uns zudem, mit den Einnahmen die Ateliermiete zu decken. Das «déde» ist nun fester Bestandteil unseres Ateliers. Es befindet sich im Hinterhof der Monbijoustrasse – daher auch der Name.
![]()
Was zeichnet «développe derrière» aus?
Unsere Kernkompetenz liegt natürlich in der Entwicklung und Digitalisierung von Analogfilmen. Besonders gut sind wir mittlerweile aber auch im Lösen von Problemen: Unsere Maschinen sind nicht nur sehr alt, es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Entsprechend sind wir immer wieder aufs Neue mit Herausforderungen konfrontiert und gezwungen, Probleme zuerst zu lösen, bevor wir uns wieder dem Tagesgeschäft widmen können. Im Laufe Jahre haben wir uns zu Profis im Improvisieren und Optimieren von Prozessen entwickelt.
«déde» in 3 Worten?
Persönlich, engagiert, transparent.
Was wünscht ihr euch in Sachen Analogfotografie?
Ein Ersatzteillager für unsere Entwicklungsmaschine und den Scanner. Und vielleicht ein Betriebssystem, das neuer als Windows 2000 und trotzdem mit unserem Scanner kompatibel ist.
![]()
Was bedeutet es für euch zusammen zu arbeiten?
Das «déde» gäbe es ohne unsere Freundschaft nicht. Und unsere Freundschaft ist durchs «déde» sehr gewachsen. Was uns verbindet, reicht weit über unsere berufliche Zusammenarbeit hinaus. Zusammenzuarbeiten bedeutet für uns in erster Linie die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Ohne das «déde» würden wir uns nicht halb so oft sehen. Das «déde» ist quasi ein Produkt unserer Freundschaft. Wir sind ein eingespieltes Team, deshalb funktioniert es nur so und nicht anders.
![]()
Was ist euer Lieblingsschritt beim Entwickeln von Filmen und warum?
Franca: Am meisten mag ich das Ausfädeln der Filme. Es hat eine beruhigende und fast meditative Wirkung auf mich.
Raffaela: Das Ausfädeln mag ich auch, aus demselben Grund wie Franca. Die Arbeit fürs déde beinhaltet aber nicht nur das Entwickeln und Digitalisieren. Was mich auch stark trägt, sind die wertschätzenden Rückmeldungen unserer Kund:innen. Ab und zu bekommen wir auch Postkarten und Zeichnungen. Sogar einen Teppich mit dem déde-Logo haben wir geschenkt bekommen. Am wenigsten mögen wir es beide, wenn die Entwicklungsmaschine nicht aufhört zu piepsen und eine Fehlermeldung anzeigt. Dieser Fehler muss jeweils zuerst identifiziert werden, bevor wir mit dem Prozess weiterfahren können. Da wir die Maschine aber sehr gut kennen, wissen wir, wie mit solchen Situationen umzugehen ist. In all den Jahren wurde noch nie ein Film beschädigt.
![]()
![]()
Wie sieht ein ganz normaler Arbeitsalltag im «déde» aus?
Im «déde» gibt es eigentlich keinen typischen Arbeitsalltag, da wir ja noch anderen Verpflichtungen nachgehen und voll ausgelastet sind. Wir teilen uns die Arbeit auf. Am Montagnachmittag haben wir geöffnet, da nimmt Raffaela die Filme entgegen, plaudert mit den Kund*innen, verschickt die digitalisierten Bilder und kümmert sich um alle restlichen administrativen Belangen. Am Dienstagabend widmet sich Franca der Entwicklung und Digitalisierung. Oftmals in Gesellschaft von Raffaela. Den Dienstagabend nutzen wir nicht nur, um über unsere Arbeit zu sprechen, sondern vor allem auch für unseren privaten Austausch. Ab und zu gibts auch ein Glas Wein. Und meist wird es recht spät. Das ist mittlerweile schon fast Tradition.
![]()
Welchen Film benutzt ihr selber am meisten?
Kodak Portra 400 und Ilford XP2 Super 400
Wenn ihr nicht Filme entwickelt und scannt, wo verbringt ihr am liebsten eure Zeit in Bern?
Wir beide sind gerne an und in der Aare. Franca ziehts zudem wöchentlich ins Dählhölzli zu den Babysöilis. Raffaela täglich auf ihren Balkon. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, holen wir am liebsten eine Pizza bei «Da Nino» und essen sie im Monbijoupark.
Beschreibt die typische «déde» Besucher*innen in 4 Worten.
Jung, interessiert, aufgeschlossen und wertschätzend.
![]()
Analog fotografiert ist ein Trend. Wie geht ihr mit dieser Aussage um?
Das stimmt. Der Grund dafür liegt für viele sicher in der Faszination für die Materialität der fotografischen Prozesse. Aber wohl auch im allgemeinen Bedürfnis nach Entschleunigung. Das ist auch unser Bedürfnis. Deshalb machen wir diesen Trend gerne mit.
Ergänzt den Satz: Liebe Kund*innen bitte...
...gebt uns keine präparierten Filme ab. Also keine Filme, die ihr in einer Filmsuppe gekocht habt. Rückstände von Seife oder anderen zusätzlichen Substanzen machen unsere Chemie kaputt. Dadurch wird es für uns schwierig, unsere Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
Wie wär’s mal mit...
...einen Gang runterschalten. Die Analogfotografie hilft dabei.
![]()
Vielen Dank Raffaela und Franca für das spannende Gespräch.
Als Filmliebhaber*innen sind wir froh, dass es euch gibt. Bis bald.
_
von Leila Ruru Ogbon
am 23.09.2024
Fotos
© Leila Ruru Ogbon für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Hallo Franca, hallo Raffaela, wer seid ihr?
Wir sind zwei Freundinnen aus Bern und kennen uns schon seit fast zehn Jahren. Neben der Arbeit beim «déde» sind wir beide sowohl selbstständig als auch in festen Anstellungsverhältnissen tätig.
Franca: Ich arbeite im Bereich der Retrodigitalisierung, bin gleichzeitig als selbstständige Fotografin tätig und Mutter von drei Kindern.
Raffaela: Ich arbeite in der Integrationsförderung beim Bund. Zusätzlich führe ich mein eigenes Schmucklabel «NANA».
Was ist das «développe derrière» und wie kam es dazu?
Das Fotolabor «déde» haben wir während der Pandemie im Jahr 2020 gegründet und im Februar 2021 eröffnet. «déde» steht kurz für «développe derrière». Unsere Arbeitsplätze befinden sich im «atelier derrière», was ein Gemeinschaftsatelier ist, das Raffaela im Jahr 2018 mit ein paar anderen kreativen Köpfen zur Ausübung ihrer selbständigen Tätigkeit gegründet hat. Franca kam etwas später dazu.
Die Idee vom «développe derrière» entstand während der Pandemie im Jahr 2020, als gleich mehrere Ateliergspänli auszogen und wir vor der Herausforderung standen, die Mietkosten mit reduzierter Besetzung tragen zu müssen. Das Fotolabor «déde» erfüllte sowohl unseren Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt und ermöglichte uns zudem, mit den Einnahmen die Ateliermiete zu decken. Das «déde» ist nun fester Bestandteil unseres Ateliers. Es befindet sich im Hinterhof der Monbijoustrasse – daher auch der Name.
Was zeichnet «développe derrière» aus?
Unsere Kernkompetenz liegt natürlich in der Entwicklung und Digitalisierung von Analogfilmen. Besonders gut sind wir mittlerweile aber auch im Lösen von Problemen: Unsere Maschinen sind nicht nur sehr alt, es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Entsprechend sind wir immer wieder aufs Neue mit Herausforderungen konfrontiert und gezwungen, Probleme zuerst zu lösen, bevor wir uns wieder dem Tagesgeschäft widmen können. Im Laufe Jahre haben wir uns zu Profis im Improvisieren und Optimieren von Prozessen entwickelt.
«déde» in 3 Worten?
Persönlich, engagiert, transparent.
Was wünscht ihr euch in Sachen Analogfotografie?
Ein Ersatzteillager für unsere Entwicklungsmaschine und den Scanner. Und vielleicht ein Betriebssystem, das neuer als Windows 2000 und trotzdem mit unserem Scanner kompatibel ist.
Was bedeutet es für euch zusammen zu arbeiten?
Das «déde» gäbe es ohne unsere Freundschaft nicht. Und unsere Freundschaft ist durchs «déde» sehr gewachsen. Was uns verbindet, reicht weit über unsere berufliche Zusammenarbeit hinaus. Zusammenzuarbeiten bedeutet für uns in erster Linie die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Ohne das «déde» würden wir uns nicht halb so oft sehen. Das «déde» ist quasi ein Produkt unserer Freundschaft. Wir sind ein eingespieltes Team, deshalb funktioniert es nur so und nicht anders.
Was ist euer Lieblingsschritt beim Entwickeln von Filmen und warum?
Franca: Am meisten mag ich das Ausfädeln der Filme. Es hat eine beruhigende und fast meditative Wirkung auf mich.
Raffaela: Das Ausfädeln mag ich auch, aus demselben Grund wie Franca. Die Arbeit fürs déde beinhaltet aber nicht nur das Entwickeln und Digitalisieren. Was mich auch stark trägt, sind die wertschätzenden Rückmeldungen unserer Kund:innen. Ab und zu bekommen wir auch Postkarten und Zeichnungen. Sogar einen Teppich mit dem déde-Logo haben wir geschenkt bekommen. Am wenigsten mögen wir es beide, wenn die Entwicklungsmaschine nicht aufhört zu piepsen und eine Fehlermeldung anzeigt. Dieser Fehler muss jeweils zuerst identifiziert werden, bevor wir mit dem Prozess weiterfahren können. Da wir die Maschine aber sehr gut kennen, wissen wir, wie mit solchen Situationen umzugehen ist. In all den Jahren wurde noch nie ein Film beschädigt.
Wie sieht ein ganz normaler Arbeitsalltag im «déde» aus?
Im «déde» gibt es eigentlich keinen typischen Arbeitsalltag, da wir ja noch anderen Verpflichtungen nachgehen und voll ausgelastet sind. Wir teilen uns die Arbeit auf. Am Montagnachmittag haben wir geöffnet, da nimmt Raffaela die Filme entgegen, plaudert mit den Kund*innen, verschickt die digitalisierten Bilder und kümmert sich um alle restlichen administrativen Belangen. Am Dienstagabend widmet sich Franca der Entwicklung und Digitalisierung. Oftmals in Gesellschaft von Raffaela. Den Dienstagabend nutzen wir nicht nur, um über unsere Arbeit zu sprechen, sondern vor allem auch für unseren privaten Austausch. Ab und zu gibts auch ein Glas Wein. Und meist wird es recht spät. Das ist mittlerweile schon fast Tradition.
Welchen Film benutzt ihr selber am meisten?
Kodak Portra 400 und Ilford XP2 Super 400
Wenn ihr nicht Filme entwickelt und scannt, wo verbringt ihr am liebsten eure Zeit in Bern?
Wir beide sind gerne an und in der Aare. Franca ziehts zudem wöchentlich ins Dählhölzli zu den Babysöilis. Raffaela täglich auf ihren Balkon. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, holen wir am liebsten eine Pizza bei «Da Nino» und essen sie im Monbijoupark.
Beschreibt die typische «déde» Besucher*innen in 4 Worten.
Jung, interessiert, aufgeschlossen und wertschätzend.
Analog fotografiert ist ein Trend. Wie geht ihr mit dieser Aussage um?
Das stimmt. Der Grund dafür liegt für viele sicher in der Faszination für die Materialität der fotografischen Prozesse. Aber wohl auch im allgemeinen Bedürfnis nach Entschleunigung. Das ist auch unser Bedürfnis. Deshalb machen wir diesen Trend gerne mit.
Ergänzt den Satz: Liebe Kund*innen bitte...
...gebt uns keine präparierten Filme ab. Also keine Filme, die ihr in einer Filmsuppe gekocht habt. Rückstände von Seife oder anderen zusätzlichen Substanzen machen unsere Chemie kaputt. Dadurch wird es für uns schwierig, unsere Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
Wie wär’s mal mit...
...einen Gang runterschalten. Die Analogfotografie hilft dabei.
Vielen Dank Raffaela und Franca für das spannende Gespräch.
Als Filmliebhaber*innen sind wir froh, dass es euch gibt. Bis bald.
_
von Leila Ruru Ogbon
am 23.09.2024
Fotos
© Leila Ruru Ogbon für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Kiosk Allschwilerplatz: Im Gespräch mit Niklaus Fäh
An der Tramhaltestelle am Allschwilerplatz hat es einen Kiosk. Doch anstelle der Bravo, Mentos oder Zigaretten wird da Gemüse und Obst verkauft. Seit 2020 steht Niklaus Fäh hinter dem Tresen und bringt saisonales und regionales Gemüse an die Menschen im Quartier. Wer er ist und was hinter den Ladenrollos steckt wollten wir herausfinden.
![]()
Nik, wer bist du? Wie stellst du dich vor?
Ich bin eigentlich ein Gemüsekiosk Betreiber, hier vom Gemüsekiosk auf dem Allschwilerplatz. Wir hatten gerade vor zwei Wochen ein Treffen hier im Quartier, mit den Anwohner*innen die ebenfalls ein Interesse haben, dass der Kiosk hier bestehen bleibt. Dafür habe ich mich natürlich vorbereitet und als ich mich da vorgestellt habe, habe ich gesagt, dass ich eigentlich Dienstleister bin – Dienstleister fürs Quartier.
Am Kiosk verkauft ihr auch Essen und Trinken, siehst du dich entsprechend auch als Gastronom?
Gastronom weiss ich nicht, aber Gastgeber, ja, das bin ich. Ob jetzt jemand einen Kaffee trinken kommt oder Erdbeeren kaufen kommt, in dem Moment sind wir Gastgeber. Aber für Gastronomie, so hochgestochen sehen wir uns nicht. Obwohl wir mit der Freitags-Küche schon was auf die Beine gestellt haben.
Am Freitag haben wir ein drei Gänge-Menü mit hausgemachtem Hummus und Salat, halt immer saisonal aber nicht hochgestochen. Das schöne ist es doch Gastgeber zu sein, die Gäste zu informieren, von wo was kommt – die Erdbeeren kommen etwa vom Hansruedi oder die Spargeln von der Daniela, also das ist einfach etwas sehr Spezielles.
![]()
Wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Kiosk betreibst?
Ich bin noch 50% im internationalen Uhrengeschäft tätig. Ich hatte vorher gerade noch einen Call mit Timberland. Auf der einen Seite produzieren wir [Timberland] Uhren und Schmuck [Nik zeigt auf das Logo auf seinem Pullover und sein Armband mit einer Gravur, er liest vor:] «Leave only Footprints» – naja, das ist so ein bisschen Timberland. Ich bin jetzt seit 30 Jahre im Uhrengeschäft tätig und habe dann ab 2015 stückweise reduziert. Ich werde Ende Monat 60 und dachte: so als Arbeitnehmer bin ich schon bald nicht mehr so gefragt und so bin ich in die Fussreflextherapie gekommen. In der Ausbildung hatte es ein Modul über gesunde Ernährung, welches ich enorm interessant fand und ich dachte ja auch schon immer: eine gesunde Ernährung ist die beste Medizin!
Dann ist Covid gekommen und der Kiosk auf dem Allschwilerplatz ist da bereits zwei Jahre leer gestanden. Schon immer dachte ich mir, dass das eine mega tolle Location ist. Ich meine: ich komme ja von der Wirtschaft und an dieser Tramhaltestelle hat man einfach unglaublich viel Frequenz. Während der Kurzarbeit dachte ich mich endlich, dass das doch eine Möglichkeit wäre, um etwas zu machen. Ich habe auch vorher schon immer wieder mal was gesucht, fand es aber immer zu risikobehaftet. Eigentlich hatte ich immer Angst.
Während der Pandemie bin ich öfters wieder raus zu den Höfen direkt die Produkte holen gegangen. Im Gespräch erzählte mir eine Bäuerin, wie sie kleine Dorfläden in der Umgebung beliefert und da ist es passiert: an einem Samstagmorgen bin ich also nach Hause gekommen und traf meine Partnerin zusammen mit einer Freundin beim Kaffee an und da meinte ich: «weisst du was, wir machen einen Gemüsekiosk!» Sechs Wochen später haben wir diesen Kiosk aufgemacht.
Als wir das erste Mal die Rollläden des Kiosks öffneten, stürmten die Menschen zu uns und meinten: «Oh was macht ihr? Oh, geht der Kiosk wieder auf?» Vom Balkon haben sie runter gerufen: «Ah was? Geht der Kiosk wieder auf? Hey, was macht ihr, ich komme auch!» Es war extrem speziell dieser 25. August 2020. In diesen ersten drei Wochen habe ich mehr Wertschätzung erlebt als in meinen 30 Jahren im Uhrengeschäft. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Ja, du siehst, es ist eine etwas längere Geschichte.
![]()
In deinen Jobs hast du sehr starke Kontraste – internationales Uhrengeschäft und lokaler Gemüsekiosk, wie beeinflussen sich diese gegenseitig?
Sie beeinflussen sich schon stark. Vom Geschäftlichen habe ich natürlich eine Know-how, jetzt hier am Kiosk handelt es sich halt einfach um Himbeeren statt um Uhren. Das vom Internationalen kann ich hier auf das Lokale übertragen: vom Umgang mit dem Sortiment bis zur Dienstleistung. Ich denke es hat vieles miteinander zu tun und bringt eine gute Balance. Manchmal kann es passieren, dass ich etwa eine Mail schreibe für die Rechtsabteilung in Dubai und gleichzeitig kommt jemand und kauft ein Brot und Erdbeeren. Ja, die Gegensätze sind gross, aber auch schön.
![]()
Du bist lokal im Quartier engagiert und legst Wert auf regionale, saisonale Produkte, was ist dir sonst noch wichtig für den Kiosk?
Ursprung war der Aspekt der Gesundheit. Wir holen am Morgen die frischen Sachen und bringen die hier her und wer davon profitieren möchte soll, und wer nicht, nicht. Und dann kam die Begegnung und die Begrünung – der Stadtgarten. Aber ganz wichtig, für eigentlich alles in meinem Leben, war immer die Freude. Wenn du etwas mit Freude machst, dann wird es und ist es toll. Am Anfang kam mir der Kiosk auch vor wie ein Verkaufslädeli wo man als Kind damit spielte, irgendwie ist es ja immer noch so. Ich bin bald 60 und habe noch immer Freude daran. Wenn du jemandem etwas schenken möchtest, schenke Freude. Am Kiosk passiert mir das 100-mal am Tag. Die Leute können sich freuen über die Qualität der Produkte, dass sie jemanden treffen, den sie schon lange nicht mehr gesehen haben, an der Ästhetik, den Farben: eine Gurke neben einem Brot.
...also etwas sehr Sinnliches auch?
Absolut!
![]()
Ihr holt eure Produkte an verschiedenen Orten, wie bist du zu diesen Kontakten gekommen?
Der «Haupt-Bauernhof» ist der Maiehof. Bei ihm habe ich in den Jahren zuvor immer schon auf dem Markt eingekauft. Ich fand seine Produkte einfach immer super, also habe ich ihn sehr bald mal angefragt. Das andere ist auch eine schöne Geschichte. Der Haunsruedi ist der Bauer von den Brunner Beeren und seine Mutter und meine Mutter hatten sich gekannt. Das Mami vom Hansruedi ist damals am Morgen früh jeweils mit einer Schubkarre voller frischem Gemüse von Therwil nach Basel gelaufen und meine Mutter, vor ca. 60 Jahren muss das gewesen sein, hat von ihr das Gemüse gekauft. Diese Geschichte von unseren Müttern fand ich so schön, dass ich ihn einfach anfragte. Ich meine, ich habe ihn nicht gut gekannt aber habe mich so gut an diese Geschichte erinnert.
Sonst bin ich einfach auf die Leute zugegangen und am Anfang dachten halt die meisten, was für ein komischer Spinner ich sei.
Wie viele Menschen seid ihr im Team?
Ich bin am Freitag und Samstag hier vor Ort. Mittwoch und Donnerstag ist Daniel, Heike und Margarethe da. Dann gibt es noch René, meinen Kollegen, mit dem ich vor 45 Jahren gemeinsam von der Handelsschule geflogen bin.
...immerhin nicht alleine?
Ja, wahrscheinlich wenn wir nicht gemeinsam unterwegs gewesen wären, wäre ich nicht geflogen aber naja, das ist eine andere Geschichte. Also wir sind fünf und meine Partnerin ist immer wieder eine wichtige Quelle für Ideen. Das Team ist mir sehr wichtig, denn als Einzelperson bist du nie so stark wie in einem Team und dann kommt noch dazu, dass jeder seine Stärken ausüben kann und hier haben wir es wieder, wenn jeder seine Stärken ausspielen kann, ist jeder motiviert und hat Freude.
![]()
Nun zu einer sehr wichtigen Frage, wenn du ein Gemüse wärst, welches Gemüse wärst du?
Wirklich, eine sehr wichtige Frage. [Nik schmunzelt.] Von der Schönheit her, was könnte es sein – was ist etwas Schönes? Eine Erdbeere. Sie ist gut sichtbar, hat vielleicht einen gewissen Geltungsdrang.
Hast du denn einen Geltungsdrang?
Also ich glaube schon. Am Anfang ist mal jemand gekommen und meinte: «du bist imfall nur Gemüseverkäufer.» Wahrscheinlich hat er das gemeint, weil ich mit so stolzer Brust hinter dem Tresen stand. Also eine Erdbeere: sie ist fein und die Menschen haben Freude. Aber die Kombination ist mir wichtig, nur eine Erdbeere zu sein ist fast wieder langweilig, aber neben einer Zucchetti, oder einem Salat – das rot und grün in dieser Kombination! Wenn ich den Gästen die Produkte einpacke, muss ich schon oft sagen: «schau mal, dass sieht doch so schön aus.»
...also bist du Verkäufer durch und durch?
Nein, ich finde es dann einfach ästhetisch: eine Kartoffel mit dem Braun und dann dazu eine Aubergine und eine Erdbeere.
Kochst du auch gerne, also vom Gemüse zum Gericht?
Ja, das mach ich schon gerne, wobei ich jetzt nicht so variantenreich bin aber ich finde es schön jemanden zu bekochen, das hat dann ja schon auch wieder etwas mit dem Gastgeberischen zu tun.
![]()
Auf Google hat der Kiosk nur fünf-Sterne-Bewertungen, was machen die positiven Rückmeldungen mit dir?
Also für mich ist Dienstleistung das A und O und ist Teil unseres Produktes. Wenn ich sehe, dass wir gutes Feedback bekommen, freut uns das natürlich unglaublich. Letzte Woche war jemand da und meinte, dass die Kirschen, die er gekauft hatte, schlecht waren. Ich war sehr froh, dass er mir das gesagt hat und nicht frustriet uns nicht mehr besuchen kommt. Das kann es halt einfach geben. Er hat dann natürlich ein neues Körbchen Kirschen bekommen – die Qualität ist das wichtigste.
Ihr seid ja ein Kiosk und nicht ein regulärer Laden. Was waren deine ersten Erfahrungen als Kind an einem Kiosk? Was kommt dir dabei in den Sinn?
Carambar! Gibt es das noch?
Natürlich, klebt immer noch überall!
Aber ist immer so fein gewesen. Und sonst hatte ich nicht so eine starke Beziehung zum Kiosk, kennengelernt habe ich den Kiosk dann erst später, durch unseren Gemüsekiosk.
Wie wär’s mal mit...
...einem Gemüsekiosk?
![]()
Vielen Dank an Niklaus Fäh für das Gespräch.
_
von Xena Paloma Stucki
am 16.09.2024
Fotos
© Paula Beck für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Nik, wer bist du? Wie stellst du dich vor?
Ich bin eigentlich ein Gemüsekiosk Betreiber, hier vom Gemüsekiosk auf dem Allschwilerplatz. Wir hatten gerade vor zwei Wochen ein Treffen hier im Quartier, mit den Anwohner*innen die ebenfalls ein Interesse haben, dass der Kiosk hier bestehen bleibt. Dafür habe ich mich natürlich vorbereitet und als ich mich da vorgestellt habe, habe ich gesagt, dass ich eigentlich Dienstleister bin – Dienstleister fürs Quartier.
Am Kiosk verkauft ihr auch Essen und Trinken, siehst du dich entsprechend auch als Gastronom?
Gastronom weiss ich nicht, aber Gastgeber, ja, das bin ich. Ob jetzt jemand einen Kaffee trinken kommt oder Erdbeeren kaufen kommt, in dem Moment sind wir Gastgeber. Aber für Gastronomie, so hochgestochen sehen wir uns nicht. Obwohl wir mit der Freitags-Küche schon was auf die Beine gestellt haben.
Am Freitag haben wir ein drei Gänge-Menü mit hausgemachtem Hummus und Salat, halt immer saisonal aber nicht hochgestochen. Das schöne ist es doch Gastgeber zu sein, die Gäste zu informieren, von wo was kommt – die Erdbeeren kommen etwa vom Hansruedi oder die Spargeln von der Daniela, also das ist einfach etwas sehr Spezielles.

Wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Kiosk betreibst?
Ich bin noch 50% im internationalen Uhrengeschäft tätig. Ich hatte vorher gerade noch einen Call mit Timberland. Auf der einen Seite produzieren wir [Timberland] Uhren und Schmuck [Nik zeigt auf das Logo auf seinem Pullover und sein Armband mit einer Gravur, er liest vor:] «Leave only Footprints» – naja, das ist so ein bisschen Timberland. Ich bin jetzt seit 30 Jahre im Uhrengeschäft tätig und habe dann ab 2015 stückweise reduziert. Ich werde Ende Monat 60 und dachte: so als Arbeitnehmer bin ich schon bald nicht mehr so gefragt und so bin ich in die Fussreflextherapie gekommen. In der Ausbildung hatte es ein Modul über gesunde Ernährung, welches ich enorm interessant fand und ich dachte ja auch schon immer: eine gesunde Ernährung ist die beste Medizin!
Dann ist Covid gekommen und der Kiosk auf dem Allschwilerplatz ist da bereits zwei Jahre leer gestanden. Schon immer dachte ich mir, dass das eine mega tolle Location ist. Ich meine: ich komme ja von der Wirtschaft und an dieser Tramhaltestelle hat man einfach unglaublich viel Frequenz. Während der Kurzarbeit dachte ich mich endlich, dass das doch eine Möglichkeit wäre, um etwas zu machen. Ich habe auch vorher schon immer wieder mal was gesucht, fand es aber immer zu risikobehaftet. Eigentlich hatte ich immer Angst.
Während der Pandemie bin ich öfters wieder raus zu den Höfen direkt die Produkte holen gegangen. Im Gespräch erzählte mir eine Bäuerin, wie sie kleine Dorfläden in der Umgebung beliefert und da ist es passiert: an einem Samstagmorgen bin ich also nach Hause gekommen und traf meine Partnerin zusammen mit einer Freundin beim Kaffee an und da meinte ich: «weisst du was, wir machen einen Gemüsekiosk!» Sechs Wochen später haben wir diesen Kiosk aufgemacht.
Als wir das erste Mal die Rollläden des Kiosks öffneten, stürmten die Menschen zu uns und meinten: «Oh was macht ihr? Oh, geht der Kiosk wieder auf?» Vom Balkon haben sie runter gerufen: «Ah was? Geht der Kiosk wieder auf? Hey, was macht ihr, ich komme auch!» Es war extrem speziell dieser 25. August 2020. In diesen ersten drei Wochen habe ich mehr Wertschätzung erlebt als in meinen 30 Jahren im Uhrengeschäft. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Ja, du siehst, es ist eine etwas längere Geschichte.

In deinen Jobs hast du sehr starke Kontraste – internationales Uhrengeschäft und lokaler Gemüsekiosk, wie beeinflussen sich diese gegenseitig?
Sie beeinflussen sich schon stark. Vom Geschäftlichen habe ich natürlich eine Know-how, jetzt hier am Kiosk handelt es sich halt einfach um Himbeeren statt um Uhren. Das vom Internationalen kann ich hier auf das Lokale übertragen: vom Umgang mit dem Sortiment bis zur Dienstleistung. Ich denke es hat vieles miteinander zu tun und bringt eine gute Balance. Manchmal kann es passieren, dass ich etwa eine Mail schreibe für die Rechtsabteilung in Dubai und gleichzeitig kommt jemand und kauft ein Brot und Erdbeeren. Ja, die Gegensätze sind gross, aber auch schön.

Du bist lokal im Quartier engagiert und legst Wert auf regionale, saisonale Produkte, was ist dir sonst noch wichtig für den Kiosk?
Ursprung war der Aspekt der Gesundheit. Wir holen am Morgen die frischen Sachen und bringen die hier her und wer davon profitieren möchte soll, und wer nicht, nicht. Und dann kam die Begegnung und die Begrünung – der Stadtgarten. Aber ganz wichtig, für eigentlich alles in meinem Leben, war immer die Freude. Wenn du etwas mit Freude machst, dann wird es und ist es toll. Am Anfang kam mir der Kiosk auch vor wie ein Verkaufslädeli wo man als Kind damit spielte, irgendwie ist es ja immer noch so. Ich bin bald 60 und habe noch immer Freude daran. Wenn du jemandem etwas schenken möchtest, schenke Freude. Am Kiosk passiert mir das 100-mal am Tag. Die Leute können sich freuen über die Qualität der Produkte, dass sie jemanden treffen, den sie schon lange nicht mehr gesehen haben, an der Ästhetik, den Farben: eine Gurke neben einem Brot.
...also etwas sehr Sinnliches auch?
Absolut!

Ihr holt eure Produkte an verschiedenen Orten, wie bist du zu diesen Kontakten gekommen?
Der «Haupt-Bauernhof» ist der Maiehof. Bei ihm habe ich in den Jahren zuvor immer schon auf dem Markt eingekauft. Ich fand seine Produkte einfach immer super, also habe ich ihn sehr bald mal angefragt. Das andere ist auch eine schöne Geschichte. Der Haunsruedi ist der Bauer von den Brunner Beeren und seine Mutter und meine Mutter hatten sich gekannt. Das Mami vom Hansruedi ist damals am Morgen früh jeweils mit einer Schubkarre voller frischem Gemüse von Therwil nach Basel gelaufen und meine Mutter, vor ca. 60 Jahren muss das gewesen sein, hat von ihr das Gemüse gekauft. Diese Geschichte von unseren Müttern fand ich so schön, dass ich ihn einfach anfragte. Ich meine, ich habe ihn nicht gut gekannt aber habe mich so gut an diese Geschichte erinnert.
Sonst bin ich einfach auf die Leute zugegangen und am Anfang dachten halt die meisten, was für ein komischer Spinner ich sei.
Wie viele Menschen seid ihr im Team?
Ich bin am Freitag und Samstag hier vor Ort. Mittwoch und Donnerstag ist Daniel, Heike und Margarethe da. Dann gibt es noch René, meinen Kollegen, mit dem ich vor 45 Jahren gemeinsam von der Handelsschule geflogen bin.
...immerhin nicht alleine?
Ja, wahrscheinlich wenn wir nicht gemeinsam unterwegs gewesen wären, wäre ich nicht geflogen aber naja, das ist eine andere Geschichte. Also wir sind fünf und meine Partnerin ist immer wieder eine wichtige Quelle für Ideen. Das Team ist mir sehr wichtig, denn als Einzelperson bist du nie so stark wie in einem Team und dann kommt noch dazu, dass jeder seine Stärken ausüben kann und hier haben wir es wieder, wenn jeder seine Stärken ausspielen kann, ist jeder motiviert und hat Freude.

Nun zu einer sehr wichtigen Frage, wenn du ein Gemüse wärst, welches Gemüse wärst du?
Wirklich, eine sehr wichtige Frage. [Nik schmunzelt.] Von der Schönheit her, was könnte es sein – was ist etwas Schönes? Eine Erdbeere. Sie ist gut sichtbar, hat vielleicht einen gewissen Geltungsdrang.
Hast du denn einen Geltungsdrang?
Also ich glaube schon. Am Anfang ist mal jemand gekommen und meinte: «du bist imfall nur Gemüseverkäufer.» Wahrscheinlich hat er das gemeint, weil ich mit so stolzer Brust hinter dem Tresen stand. Also eine Erdbeere: sie ist fein und die Menschen haben Freude. Aber die Kombination ist mir wichtig, nur eine Erdbeere zu sein ist fast wieder langweilig, aber neben einer Zucchetti, oder einem Salat – das rot und grün in dieser Kombination! Wenn ich den Gästen die Produkte einpacke, muss ich schon oft sagen: «schau mal, dass sieht doch so schön aus.»
...also bist du Verkäufer durch und durch?
Nein, ich finde es dann einfach ästhetisch: eine Kartoffel mit dem Braun und dann dazu eine Aubergine und eine Erdbeere.
Kochst du auch gerne, also vom Gemüse zum Gericht?
Ja, das mach ich schon gerne, wobei ich jetzt nicht so variantenreich bin aber ich finde es schön jemanden zu bekochen, das hat dann ja schon auch wieder etwas mit dem Gastgeberischen zu tun.

Auf Google hat der Kiosk nur fünf-Sterne-Bewertungen, was machen die positiven Rückmeldungen mit dir?
Also für mich ist Dienstleistung das A und O und ist Teil unseres Produktes. Wenn ich sehe, dass wir gutes Feedback bekommen, freut uns das natürlich unglaublich. Letzte Woche war jemand da und meinte, dass die Kirschen, die er gekauft hatte, schlecht waren. Ich war sehr froh, dass er mir das gesagt hat und nicht frustriet uns nicht mehr besuchen kommt. Das kann es halt einfach geben. Er hat dann natürlich ein neues Körbchen Kirschen bekommen – die Qualität ist das wichtigste.
Ihr seid ja ein Kiosk und nicht ein regulärer Laden. Was waren deine ersten Erfahrungen als Kind an einem Kiosk? Was kommt dir dabei in den Sinn?
Carambar! Gibt es das noch?
Natürlich, klebt immer noch überall!
Aber ist immer so fein gewesen. Und sonst hatte ich nicht so eine starke Beziehung zum Kiosk, kennengelernt habe ich den Kiosk dann erst später, durch unseren Gemüsekiosk.
Wie wär’s mal mit...
...einem Gemüsekiosk?

Vielen Dank an Niklaus Fäh für das Gespräch.
_
von Xena Paloma Stucki
am 16.09.2024
Fotos
© Paula Beck für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Apartment25» Basel: Im Gespräch mit Julian Lenzin
Outfits müssen nicht teuer sein, um gut auszusehen! Wie aus einem Kindheitstraum «Apartment25» in Basel wurde, was das ist und weshalb der Name, erzählt uns Gründer Julian Lenzin im Gespräch.
![]()
Lieber Julian, wer bist du und was ist deine grösste Macke?
Ich heisse Julian. 27 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Basel. Meine grösste Macke ist mein Perfektionismus. Wenn etwas nicht genau so rauskommt wie ich mir das Vorgestellt habe bin ich schon ziemlich unflexibel und komme aus dem Konzept.
![]()
«Apartment25» – was ist das und wie kam es dazu?
«Apartment25» ist mein Kindheitstraum. So lange ich zurück denke wollte ich etwas eigenes aufbauen und habe dann mit meinem Kindheitsfreund Nicolas Keller den Laden auf die Beine gestellt. Es ist ein Ort um abzuhängen, sich zu unterhalten und nebenbei die angesagtesten Klamotten und Sneaker zu kaufen.
![]()
«Apartment25» – weshalb der Name?
Wir haben nach einem Namen gesucht, der cool klingt und Sinn macht. Da der Laden auch ein weiteres Zimmer und eine Küche bietet, könnte es durchaus auch eine Wohnung sein, deshalb «Apartment». Die 25 ist der Hausnummer zu verdanken.
![]()
Welche Werte in Sachen Mode, Materialismus und Konsum vertretet ihr?
In Sachen Mode sind wir klar der Meinung, dass ein Outfit nicht teuer sein muss, um gut auszusehen. Brocki und Flohmi Funde sind oft viel cooler als die neuesten und teuersten Trends. Deshalb haben wir auch für jedes Budget etwas im Sortiment. Wir selbst tragen 90% Second Hand Kleidungund legen das auch allen Leuten nahe. Vintage Klamotten sind zeitlos und die Qualität ist meist viel besser als die neu produzierte Massenware.
![]()
![]()
Wenn «Apartment25» ein Song wäre, welcher Song wäre es und weshalb?
Ich höre gerne verschiedene Musik Genres aber immer Songs die für einen guten «Vibe» im Laden sorgen. Momentan höre ich gerne «Guilty» von Lady Wray und «Love is the Way» von Thee Sacred Souls. Von der neueren Generation höre ich viele Songs von Kid Cudi und Frank Ocean. Die Stimmung muss einfach passen und man soll sich wohl fühlen im Laden.
Beschreibe das «Apartment25» Sortiment in 3 Worten.
Zeitlos, einzigartig, crazy.
![]()
Dein absolutes Lieblingsstück, was je bei «Apartment25» über den Tisch ging?
Das müsste die Louis Vuitton Amazone Sling Bag in der Kollaboration mit dem japanischen Designer «Nigo» gewesen sein. Ich hätte die Tasche am liebsten selbst behalten und tat mich schwer sie gehen zu lassen.
«Apartment25» Store Vibes in 3 Worten.
Gemütlich, freundlich, offen.
Wie wär's mal mit...
...einem leckeren Cappuccino oder Espresso im Garten vom «Apartment25»?
![]()
Vielen Dank für die Zeit und Einblicke, Julian!
_
von Ana Brankovic
am 19.06.2023
Fotos
© Christina Catellani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Lieber Julian, wer bist du und was ist deine grösste Macke?
Ich heisse Julian. 27 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Basel. Meine grösste Macke ist mein Perfektionismus. Wenn etwas nicht genau so rauskommt wie ich mir das Vorgestellt habe bin ich schon ziemlich unflexibel und komme aus dem Konzept.
«Apartment25» – was ist das und wie kam es dazu?
«Apartment25» ist mein Kindheitstraum. So lange ich zurück denke wollte ich etwas eigenes aufbauen und habe dann mit meinem Kindheitsfreund Nicolas Keller den Laden auf die Beine gestellt. Es ist ein Ort um abzuhängen, sich zu unterhalten und nebenbei die angesagtesten Klamotten und Sneaker zu kaufen.
«Apartment25» – weshalb der Name?
Wir haben nach einem Namen gesucht, der cool klingt und Sinn macht. Da der Laden auch ein weiteres Zimmer und eine Küche bietet, könnte es durchaus auch eine Wohnung sein, deshalb «Apartment». Die 25 ist der Hausnummer zu verdanken.
Welche Werte in Sachen Mode, Materialismus und Konsum vertretet ihr?
In Sachen Mode sind wir klar der Meinung, dass ein Outfit nicht teuer sein muss, um gut auszusehen. Brocki und Flohmi Funde sind oft viel cooler als die neuesten und teuersten Trends. Deshalb haben wir auch für jedes Budget etwas im Sortiment. Wir selbst tragen 90% Second Hand Kleidungund legen das auch allen Leuten nahe. Vintage Klamotten sind zeitlos und die Qualität ist meist viel besser als die neu produzierte Massenware.
Wenn «Apartment25» ein Song wäre, welcher Song wäre es und weshalb?
Ich höre gerne verschiedene Musik Genres aber immer Songs die für einen guten «Vibe» im Laden sorgen. Momentan höre ich gerne «Guilty» von Lady Wray und «Love is the Way» von Thee Sacred Souls. Von der neueren Generation höre ich viele Songs von Kid Cudi und Frank Ocean. Die Stimmung muss einfach passen und man soll sich wohl fühlen im Laden.
Beschreibe das «Apartment25» Sortiment in 3 Worten.
Zeitlos, einzigartig, crazy.
Dein absolutes Lieblingsstück, was je bei «Apartment25» über den Tisch ging?
Das müsste die Louis Vuitton Amazone Sling Bag in der Kollaboration mit dem japanischen Designer «Nigo» gewesen sein. Ich hätte die Tasche am liebsten selbst behalten und tat mich schwer sie gehen zu lassen.
«Apartment25» Store Vibes in 3 Worten.
Gemütlich, freundlich, offen.
Wie wär's mal mit...
...einem leckeren Cappuccino oder Espresso im Garten vom «Apartment25»?
Vielen Dank für die Zeit und Einblicke, Julian!
_
von Ana Brankovic
am 19.06.2023
Fotos
© Christina Catellani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«BelleVue» Fotografie Basel: Im Gespräch mit Marina Woodtli
Schöne Aussichten in Basel! «BelleVue» Fotografie in Basel bietet mindestens genauso schöne Ansichten wie das Berliner Schloss Bellevue in den umliegenden Park. Wir sprachen mit Marina Woodtli, weshalb es Fotografie braucht, wie sie zu Kunst und Kultur steht und über den Ort «BelleVue».
![]()
Hallo Marina Woodtli, beschreibe dich in 3 Worten.
Hallo ich bin Marina Woodtli und in drei Worten: bunt, verträumt, inspiriert.
![]()
«BelleVue» Fotografie – wie kamst du dazu, was machst du da und was hast du davor gemacht?
Nach Abschluss des Masters in Fine Arts and Art Teaching in Luzern 2014, arbeitete ich an einem langfristigen Kunst-am-Bau Projekt als freischaffende Künstlerin im Bereich Video. Aktuell studiere ich in Berlin an der Ostkreuzschule für Fotografie und schliesse diesen Herbst die Ausbildung als Fotografin ab. Seit 2021 teile ich mit Regine Flury die Koordinationsstelle im «BelleVue» – Ort für Fotografie in Basel. Seit ich den Ausstellungsort kenne, bin ich in unterschiedlichen Formaten tätig. So z.B. bin ich mit Christian Flierl in der Projektleitung, wo wir Fotografien auf grossformatigen Ausstellungsständern im öffentlichen Raum zeigen. Im Herbst 2022 fand der Auftakt eines wiederkehrenden Ausstellungskonzeptes statt. Wir möchten Fotografien für alle zugänglich machen und ortsspezifische Arbeiten zeigen mit der Vision ein Fotoerbe für Basel aufzubauen.
Welche Werte in Sachen Kultur, Kunst und Fotografie in der Schweiz vertrittst du?
Kunst und Kultur für alle zugänglich machen.
![]()
Was bedeutet es für dich in der Kreativbranche zu arbeiten im 2023, wie hat sich der Begriff und die Wahrnehmung geändert?
Diese Frage kann ich aus persönlicher Perspektive beantworten. Nach Umzug aus Berlin nach Basel setzte ich mein Studium online weiter. Diese Flexibilität kam mir mit Familie sehr entgegen. Dennoch ist die Möglichkeit remote anwesend zu sein kein Ersatz im Vergleich zur Besprechung mit Menschen und physischen Bildern vor Ort. Diese Wahrnehmung hat sich bestärkt und schätze ich heute sehr fest.
![]()
Wenn «BelleVue» Fotografie ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
«BelleVue» wäre ein Biber. Unser Verein ist fleissig und arbeitsam. Es stecken so viele Mitglieder in diesem Prozess, ohne die es nicht möglich wäre diesen Ort zu betreiben. Wir warten also nur auf den Moment, wo jemand, die Stadt Basel, unseren wahnsinnigen Bau entdeckt und ihn mitfinanziert.
![]()
Dein persönliches Highlight bei «BelleVue» Fotografie bisher?
Als ich mit Dominique Labhardt die Ausstellung von Luca Zanetti «Colombia – On the Brink of Paradise» zusammen kuratieren durfte. Das war sehr berührend, lustvoll und lehrreich für mich. Im «BelleVue» darf man eintauchen und voneinander lernen und austauschen, einer unter vielen Gründen, weshalb ich diesen Ort schätze.
![]()
Wo in Basel hältst du dich am liebsten auf?
Ich bin sehr viel unterwegs und pendle zwischen Berlin und Basel. Zudem bin ich mit einem Fuss in den Bündner Bergen verankert. Meine Kinder lernen also wie man aus dem Rucksack lebt.
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Bei dieser Frage, wüsste ich gerade nicht wo ansetzen – so vieles!
Wie wär’s mal mit...
...Frühling?
![]()
Vielen Dank Marina für das inspirierende Gespräch.
_
von Ana Brankovic
am 05.06.2023
Fotos
© Ketty Bertossi für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hallo Marina Woodtli, beschreibe dich in 3 Worten.
Hallo ich bin Marina Woodtli und in drei Worten: bunt, verträumt, inspiriert.

«BelleVue» Fotografie – wie kamst du dazu, was machst du da und was hast du davor gemacht?
Nach Abschluss des Masters in Fine Arts and Art Teaching in Luzern 2014, arbeitete ich an einem langfristigen Kunst-am-Bau Projekt als freischaffende Künstlerin im Bereich Video. Aktuell studiere ich in Berlin an der Ostkreuzschule für Fotografie und schliesse diesen Herbst die Ausbildung als Fotografin ab. Seit 2021 teile ich mit Regine Flury die Koordinationsstelle im «BelleVue» – Ort für Fotografie in Basel. Seit ich den Ausstellungsort kenne, bin ich in unterschiedlichen Formaten tätig. So z.B. bin ich mit Christian Flierl in der Projektleitung, wo wir Fotografien auf grossformatigen Ausstellungsständern im öffentlichen Raum zeigen. Im Herbst 2022 fand der Auftakt eines wiederkehrenden Ausstellungskonzeptes statt. Wir möchten Fotografien für alle zugänglich machen und ortsspezifische Arbeiten zeigen mit der Vision ein Fotoerbe für Basel aufzubauen.
Welche Werte in Sachen Kultur, Kunst und Fotografie in der Schweiz vertrittst du?
Kunst und Kultur für alle zugänglich machen.

Was bedeutet es für dich in der Kreativbranche zu arbeiten im 2023, wie hat sich der Begriff und die Wahrnehmung geändert?
Diese Frage kann ich aus persönlicher Perspektive beantworten. Nach Umzug aus Berlin nach Basel setzte ich mein Studium online weiter. Diese Flexibilität kam mir mit Familie sehr entgegen. Dennoch ist die Möglichkeit remote anwesend zu sein kein Ersatz im Vergleich zur Besprechung mit Menschen und physischen Bildern vor Ort. Diese Wahrnehmung hat sich bestärkt und schätze ich heute sehr fest.

Wenn «BelleVue» Fotografie ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
«BelleVue» wäre ein Biber. Unser Verein ist fleissig und arbeitsam. Es stecken so viele Mitglieder in diesem Prozess, ohne die es nicht möglich wäre diesen Ort zu betreiben. Wir warten also nur auf den Moment, wo jemand, die Stadt Basel, unseren wahnsinnigen Bau entdeckt und ihn mitfinanziert.

Dein persönliches Highlight bei «BelleVue» Fotografie bisher?
Als ich mit Dominique Labhardt die Ausstellung von Luca Zanetti «Colombia – On the Brink of Paradise» zusammen kuratieren durfte. Das war sehr berührend, lustvoll und lehrreich für mich. Im «BelleVue» darf man eintauchen und voneinander lernen und austauschen, einer unter vielen Gründen, weshalb ich diesen Ort schätze.

Wo in Basel hältst du dich am liebsten auf?
Ich bin sehr viel unterwegs und pendle zwischen Berlin und Basel. Zudem bin ich mit einem Fuss in den Bündner Bergen verankert. Meine Kinder lernen also wie man aus dem Rucksack lebt.
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Bei dieser Frage, wüsste ich gerade nicht wo ansetzen – so vieles!
Wie wär’s mal mit...
...Frühling?

Vielen Dank Marina für das inspirierende Gespräch.
_
von Ana Brankovic
am 05.06.2023
Fotos
© Ketty Bertossi für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Junges Theater Basel»: Im Gespräch mit Uwe Heinrich
Theaterpädagoge Uwe Heinrich gab uns spannende Einblicke hinter die Kulissen von «Junges Theater Basel» und erzählt uns unter anderem, weshalb das Theater keine Einbahnstrasse ist.
![]()
Hallo Uwe! Beschreibe dich in 3 Worten.
Boah! Das könnte jede*r besser als ich selbst. Ich halte mich doch für viel komplexer, als dass 3 Wörter reichen könnten. Mein Versuch liest sich darum eher wie eine To-do- Liste und dazu noch alles irgendwie im Zustand unterwegs. Also eher eine wortreiche Reisebeschreibung als die Benennung fester Ziele:
– aufmerksam bis nervös
– ungeduldig, aber meistens gewissenhaft
– verbindlich, aber selten stur
– neugierig, aber trotzdem schnell gelangweilt
– streng, am meisten zu mir selbst
– grosszügig, wenngleich eher geizig zu mir selbst
– wertschätzend, aber eher heimlich
– treu – wer oder was über die Schwelle meines Herzens oder Hauses gelangt, kann ziemlich sicher sein, von mir nicht wieder rausgeschmissen zu werden
![]()
«Junges Theater Basel» – wie kamst du dazu, was machst du da und was hast du davor gemacht?
Noch ganz neu in Basel war ich als Besucher im jungen Theater völlig überrascht, welche besondere Lebendigkeit diese unausgebildeten Spieler*innen auf die Bühne bringen. Theater für Jugendliche hatte ich bisher oft als leicht peinlich empfunden. Das Base-Cap umdrehen und mit lockerem Gang über die Bühne schlurfen, macht aus Mitte zwanzigjährigen Schauspieler*innen keine glaubhaften jugendlichen Figuren. Dass viele jugendliche Spieler*innen jugendliche Figuren schon nach dem Besuch eines Theaterkurses glaubhafter spielen können als ihre professionellen Kolleg*innen hat mich letztlich bewogen, am «Jungen Theater Basel» anzufangen. Ein Theater, welches Jugendliche so ernst nimmt, kannte ich aus meiner bisherigen Arbeit in Deutschland nicht. Als Theaterpädagoge wollte und will ich Jugendliche auf dem Weg zu solch professionellen Produktionen begleiten.
![]()
Welche Werte in Sachen Kultur und Kunst in der Schweiz vertrittst du?
Ich betrachte Kunst als den besten Anlass, um mit mir selbst oder anderen in Kontakt zu treten. Ich lasse mich darum gern irritieren. Je rätselhafter, umso mehr muss ich mich anstrengen und das aktiviert meine Fantasie. Ehrlich gesagt, gehe ich darum fast lieber in Ausstellungen, da gibt es immer viel zu tun für mich. Im «Jungen Theater Basel» sollten die Irritationen allerdings nicht zu krass ausfallen, denn die Besucher*innen dieses Hauses haben weniger Seherfahrungen und glauben oft noch, dass sie etwas «verstehen müssen». Darüber bin ich schon eine Weile hinaus und versuche, jüngeren Besucher*innen diese Befürchtung zu nehmen und Lust auf die eigenen Gedanken zu machen.
![]()
Was bedeutet Theater für dich heute im 2023, wie haben sich der Begriff und die Wahrnehmung geändert?
Theater im Jahre 2023 wird genau wie alle Theater seit ihrer Entstehung darum bemüht sein, den aktuellen Diskurs anzuregen, zu reflektieren, zu kommentieren und die Diskussion zwischen Individuen und der Gesellschaft anzuregen. Als Leiter des «Jungen Theater Basels» habe ich eine diebische Freude daran, dass Jugendliche nach dem Besuch der Vorstellungen oft verwundert feststellen, dass Theater doch nicht so schlimm wie erwartet ist, ja sogar etwas bei ihnen auslösen kann – aber das ist dann schon etwas sehr Tolles. Ich finde es schon grossartig, wenn Theater überhaupt zugelassen wird. So ne Einbahnstrassen-Veranstaltung ist nicht zeitgemäss. Alle haben doch eigentlich zu allem etwas zu sagen und das geht im Theater ja erst mal nicht. da Kann ich als Besucher*in nur im Kopf mitspielen und ob dieses Mitspiel gelingt, hängt natürlich auch davon ab, welche Angebote zum Aktivwerden gemacht werden, was sie mit den Leuten und der Zeit zu tun haben.
Wenn das «Junge Theater Basel» ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
Das «Junge Theater Basel» wäre wohl irgendwas Fluides zwischen einem Einhorn und einem Brauereipferd: versponnen und leistungsfähig.
![]()
![]()
Dein persönliches Highlight beim «Jungen Theater Basel»?
Das ist eine gemeine Frage. Ich bin dem Jetzt verpflichtet, aber das jetztige Jetzt zu benennen, wäre ungerecht allen vergangenen Jetzt gegenüber. Ich habe da keinen Abstand, um das absolute «Highlight» zu erkennen. Vielmehr ist das Leben am «Jungen Theater Basel» immer gut beleuchtet. Aber selbst wenn eine Premiere besonders gelingt, verblasst das Leuchten der dazugehörigen Premierenparty schnell, wenn nicht viele gelungene Vorstellungen danach folgen. Aber zum Glück gibt es immer ein neues Jetzt.
Wo in Basel hältst du dich am liebsten auf?
Das «Rheinboard» zu benennen ist wenig originell, aber es gibt keinen besseren Ort in der Stadt, um mit Verabredungen jeglicher Art unterwegs zu sein. Und da kein Gespräch zu Ende ist, bevor man im Hafen ist, kann man sich sogar einreden, an einem Freiraum vorbeizuspazieren.
![]()
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Der Schweiz stünde es gut zu Gesicht, die unglaublichen Ressourcen gerechter zu verteilen, gewissermassen von vielen Worten zu vielen Taten zu gelangen.
Wie wär’s mal mit...
...ein paar eigenen Schritten auf die Bühne? Es muss ja nicht gleich jemand zuschauen. In Theaterkursen kannst du ausprobieren, wie es dir damit geht, zu spielen.
![]()
Vielen Dank, Uwe, für die inspirierenden Worte und den Einblick ins «Junge Theater Basel».
_
von Ana Brankovic
am 29.05.2023
Fotos
© Lucie Anderrüti für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hallo Uwe! Beschreibe dich in 3 Worten.
Boah! Das könnte jede*r besser als ich selbst. Ich halte mich doch für viel komplexer, als dass 3 Wörter reichen könnten. Mein Versuch liest sich darum eher wie eine To-do- Liste und dazu noch alles irgendwie im Zustand unterwegs. Also eher eine wortreiche Reisebeschreibung als die Benennung fester Ziele:
– aufmerksam bis nervös
– ungeduldig, aber meistens gewissenhaft
– verbindlich, aber selten stur
– neugierig, aber trotzdem schnell gelangweilt
– streng, am meisten zu mir selbst
– grosszügig, wenngleich eher geizig zu mir selbst
– wertschätzend, aber eher heimlich
– treu – wer oder was über die Schwelle meines Herzens oder Hauses gelangt, kann ziemlich sicher sein, von mir nicht wieder rausgeschmissen zu werden

«Junges Theater Basel» – wie kamst du dazu, was machst du da und was hast du davor gemacht?
Noch ganz neu in Basel war ich als Besucher im jungen Theater völlig überrascht, welche besondere Lebendigkeit diese unausgebildeten Spieler*innen auf die Bühne bringen. Theater für Jugendliche hatte ich bisher oft als leicht peinlich empfunden. Das Base-Cap umdrehen und mit lockerem Gang über die Bühne schlurfen, macht aus Mitte zwanzigjährigen Schauspieler*innen keine glaubhaften jugendlichen Figuren. Dass viele jugendliche Spieler*innen jugendliche Figuren schon nach dem Besuch eines Theaterkurses glaubhafter spielen können als ihre professionellen Kolleg*innen hat mich letztlich bewogen, am «Jungen Theater Basel» anzufangen. Ein Theater, welches Jugendliche so ernst nimmt, kannte ich aus meiner bisherigen Arbeit in Deutschland nicht. Als Theaterpädagoge wollte und will ich Jugendliche auf dem Weg zu solch professionellen Produktionen begleiten.

Welche Werte in Sachen Kultur und Kunst in der Schweiz vertrittst du?
Ich betrachte Kunst als den besten Anlass, um mit mir selbst oder anderen in Kontakt zu treten. Ich lasse mich darum gern irritieren. Je rätselhafter, umso mehr muss ich mich anstrengen und das aktiviert meine Fantasie. Ehrlich gesagt, gehe ich darum fast lieber in Ausstellungen, da gibt es immer viel zu tun für mich. Im «Jungen Theater Basel» sollten die Irritationen allerdings nicht zu krass ausfallen, denn die Besucher*innen dieses Hauses haben weniger Seherfahrungen und glauben oft noch, dass sie etwas «verstehen müssen». Darüber bin ich schon eine Weile hinaus und versuche, jüngeren Besucher*innen diese Befürchtung zu nehmen und Lust auf die eigenen Gedanken zu machen.

Was bedeutet Theater für dich heute im 2023, wie haben sich der Begriff und die Wahrnehmung geändert?
Theater im Jahre 2023 wird genau wie alle Theater seit ihrer Entstehung darum bemüht sein, den aktuellen Diskurs anzuregen, zu reflektieren, zu kommentieren und die Diskussion zwischen Individuen und der Gesellschaft anzuregen. Als Leiter des «Jungen Theater Basels» habe ich eine diebische Freude daran, dass Jugendliche nach dem Besuch der Vorstellungen oft verwundert feststellen, dass Theater doch nicht so schlimm wie erwartet ist, ja sogar etwas bei ihnen auslösen kann – aber das ist dann schon etwas sehr Tolles. Ich finde es schon grossartig, wenn Theater überhaupt zugelassen wird. So ne Einbahnstrassen-Veranstaltung ist nicht zeitgemäss. Alle haben doch eigentlich zu allem etwas zu sagen und das geht im Theater ja erst mal nicht. da Kann ich als Besucher*in nur im Kopf mitspielen und ob dieses Mitspiel gelingt, hängt natürlich auch davon ab, welche Angebote zum Aktivwerden gemacht werden, was sie mit den Leuten und der Zeit zu tun haben.
Wenn das «Junge Theater Basel» ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
Das «Junge Theater Basel» wäre wohl irgendwas Fluides zwischen einem Einhorn und einem Brauereipferd: versponnen und leistungsfähig.


Dein persönliches Highlight beim «Jungen Theater Basel»?
Das ist eine gemeine Frage. Ich bin dem Jetzt verpflichtet, aber das jetztige Jetzt zu benennen, wäre ungerecht allen vergangenen Jetzt gegenüber. Ich habe da keinen Abstand, um das absolute «Highlight» zu erkennen. Vielmehr ist das Leben am «Jungen Theater Basel» immer gut beleuchtet. Aber selbst wenn eine Premiere besonders gelingt, verblasst das Leuchten der dazugehörigen Premierenparty schnell, wenn nicht viele gelungene Vorstellungen danach folgen. Aber zum Glück gibt es immer ein neues Jetzt.
Wo in Basel hältst du dich am liebsten auf?
Das «Rheinboard» zu benennen ist wenig originell, aber es gibt keinen besseren Ort in der Stadt, um mit Verabredungen jeglicher Art unterwegs zu sein. Und da kein Gespräch zu Ende ist, bevor man im Hafen ist, kann man sich sogar einreden, an einem Freiraum vorbeizuspazieren.

Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Der Schweiz stünde es gut zu Gesicht, die unglaublichen Ressourcen gerechter zu verteilen, gewissermassen von vielen Worten zu vielen Taten zu gelangen.
Wie wär’s mal mit...
...ein paar eigenen Schritten auf die Bühne? Es muss ja nicht gleich jemand zuschauen. In Theaterkursen kannst du ausprobieren, wie es dir damit geht, zu spielen.

Vielen Dank, Uwe, für die inspirierenden Worte und den Einblick ins «Junge Theater Basel».
_
von Ana Brankovic
am 29.05.2023
Fotos
© Lucie Anderrüti für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Rework» Store Basel: Im Gespräch mit Leonie Staub und Marcos Pérez
Aus Alt mach Neu! «Rework» macht aus Alttextilien neue Kleidungsstücke, um Fast Fashion entgegenzuwirken, denn Mode gibt es wie Sand am Meer. Wie und weshalb die Marke entstand, erzählen uns Mitgründer Marcos Pérez und Store Managerin Leonie Staub.
![]()
Hallo Leonie und Marcos, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Leonie Staub: Ich bin Leonie, die Store Managerin vom «Rework» in Basel. Meine grösste Macke, dass ich mir von Schokolade nie schlecht wird und ich zu viel davon esse.
Marcos Pérez: Mein Name ist Marcos und ich bin Mitgründer, Chief Marketing Officer und Art Director bei «Rework». Ich habe eine breite Palette an Interessen und Fähigkeiten, was es manchmal schwierig macht, mich selbst zufriedenzustellen.
![]()
«Rework» – wie kam es dazu?
Marcos: Rework entstand aus einer Idee des Kleiderladens «Fizzen», der bereits vor 20 Jahren begann, Secondhand Lederjacken in Taschen und Laptop Hüllen umzunähen. Dabei stand stets die Ästhetik im Fokus. Unsere Motivation, «Rework» als eigenständige Marke zu gründen, lag darin, aus Alttextilien neue Kleidungsstücke zu kreieren und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Modeindustrie zu leisten. Wir sind seit 2019 als eigenständige Marke tätig und bieten Frauen-, Herren-, Unisex- und Kinder-Kollektionen, sowie eine kleine Homewear-Kollektion an.
«Rework» – weshalb der Name?
«Re-Work», etwas umarbeiten, umformen, ändern, erneuern.
![]()
Welche Werte in Sachen Fast Fashion und Nachhaltigkeit vertretet ihr?
Fast Fashion ist ein Konzept aus der Vergangenheit. Schnelle Käufe von schneller Mode führen zu schneller Befriedigung, die sich genauso schnell wieder verflüchtigt. Wir stellen uns vor, dass sich die Menschen weiterentwickeln und das Gefühl schätzen lernen, etwas Nachhaltiges zu kaufen, dass nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt – für uns selbst und für unseren Planeten.
![]()
Eure Produktionsstätten sind in Indien oder Thailand. Ihr müsst also Transporte meist via Flugzeug in die Schweiz bringen und dort verdienen nach euren Aussagen eure Schneider*innen ca. 145 CHF im Monat. Weshalb betreibt ihr Upcycling nicht lokaler z.B. in der Schweiz oder Europa?
Ein Teil unserer Produktion wird in Bern und in unseren Shops hergestellt. «Rework» ist keine Luxusmarke, wir wollen eine bezahlbare Alternative zu Fast Fashion sein. Deshalb produzieren wir auch in Tieflohnländern und nehmen die langen Transportwege in Kauf. Dazu kommt, dass unsere eigenen Geschichten viel mit diesen Ländern zu tun haben, wir haben dort gelebt und unsere Produktion ist dort verwurzelt, es sind unsere eigenen Mitarbeiter*innen in unseren eigenen Nähateliers, die wir nicht einfach im Stich lassen, weil plötzlich alles «aus der Region» sein muss. Wir glauben weiterhin an das Gute einer globalisierten Welt.
![]()
Fashion gibt es wie Sand am Meer. Upcycling sind meist auch Einzelstücke, ihr bietet aber verschiedene Grössen und Mengen an, weshalb? Was macht euch einzigartig?
Upcycling ist in unserem Verständnis das Beste aus zwei Welten. Wie bei konventionell hergestellter Mode können wir Kollektionen gestalten und unterschiedliche Grössen anbieten. Jedoch bleibt wie bei Vintage jedes Stück ein Einzelstück, weil die Stoffbeschaffenheit stets unterschiedlich ist.
Wenn «Rework» ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
«Rework» ist wie ein neugieriges und verspieltes Schweinchen, das beharrlich durch den Abfall der anderen wühlt, um seine Chancen zu nutzen. Statt auf dem Schlachthof zu landen, hofft es darauf, eines Tages zu einer prächtigen, starken Sau heranzuwachsen.
![]()
Beschreibe die typischen «Rework» Kund*innen in 3 Worten.
Am Leben interessiert.
Wo in Basel hält ihr euch am liebsten auf?
Leonie: Überall, wo es leckeres veganes Esssen gibt und am Rhein.
Marcos: Bei Anna und Marco im «Wild Wines» an einem Tasting und wegen den unkomplizierten Gespräche über Weine und das Leben. Gegenüber bei Miron im Café «Flore» für die tolle Atmosphäre und wegen der möglicherweise besten Weinauswahl in Basel. Im neu eröffneten Thai Restaurant «Nam», wenn ich Fernweh (oder Heimweh) habe und meine Lieblingssuppe brauche (Khao Soi). In eines dieser Museen Fondation Beyeler, Kunstmuseum Basel und momentan am meisten im Naturhistorischen, wegen den Interessen meiner Kinder. Ansonsten einen Donut von Mystifry oder alternativ einen Schoggiwegli mit einem Kaffee am Rheinufer geniessen.
![]()
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger? Marcos: Mehr Wochenende, weniger Montage.
Leonie: Mehr vegane Restaurants und weniger Baustellen.
Wie wär’s mal mit...
...einem vierundzwanzigeinhalb Stunden Tag?
![]()
Vielen Dank, Leonie und Marcos, für die spannenden Einblicke.
_
von Ana Brankovic
am 22.05.2023
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hallo Leonie und Marcos, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Leonie Staub: Ich bin Leonie, die Store Managerin vom «Rework» in Basel. Meine grösste Macke, dass ich mir von Schokolade nie schlecht wird und ich zu viel davon esse.
Marcos Pérez: Mein Name ist Marcos und ich bin Mitgründer, Chief Marketing Officer und Art Director bei «Rework». Ich habe eine breite Palette an Interessen und Fähigkeiten, was es manchmal schwierig macht, mich selbst zufriedenzustellen.

«Rework» – wie kam es dazu?
Marcos: Rework entstand aus einer Idee des Kleiderladens «Fizzen», der bereits vor 20 Jahren begann, Secondhand Lederjacken in Taschen und Laptop Hüllen umzunähen. Dabei stand stets die Ästhetik im Fokus. Unsere Motivation, «Rework» als eigenständige Marke zu gründen, lag darin, aus Alttextilien neue Kleidungsstücke zu kreieren und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Modeindustrie zu leisten. Wir sind seit 2019 als eigenständige Marke tätig und bieten Frauen-, Herren-, Unisex- und Kinder-Kollektionen, sowie eine kleine Homewear-Kollektion an.
«Rework» – weshalb der Name?
«Re-Work», etwas umarbeiten, umformen, ändern, erneuern.

Welche Werte in Sachen Fast Fashion und Nachhaltigkeit vertretet ihr?
Fast Fashion ist ein Konzept aus der Vergangenheit. Schnelle Käufe von schneller Mode führen zu schneller Befriedigung, die sich genauso schnell wieder verflüchtigt. Wir stellen uns vor, dass sich die Menschen weiterentwickeln und das Gefühl schätzen lernen, etwas Nachhaltiges zu kaufen, dass nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt – für uns selbst und für unseren Planeten.

Eure Produktionsstätten sind in Indien oder Thailand. Ihr müsst also Transporte meist via Flugzeug in die Schweiz bringen und dort verdienen nach euren Aussagen eure Schneider*innen ca. 145 CHF im Monat. Weshalb betreibt ihr Upcycling nicht lokaler z.B. in der Schweiz oder Europa?
Ein Teil unserer Produktion wird in Bern und in unseren Shops hergestellt. «Rework» ist keine Luxusmarke, wir wollen eine bezahlbare Alternative zu Fast Fashion sein. Deshalb produzieren wir auch in Tieflohnländern und nehmen die langen Transportwege in Kauf. Dazu kommt, dass unsere eigenen Geschichten viel mit diesen Ländern zu tun haben, wir haben dort gelebt und unsere Produktion ist dort verwurzelt, es sind unsere eigenen Mitarbeiter*innen in unseren eigenen Nähateliers, die wir nicht einfach im Stich lassen, weil plötzlich alles «aus der Region» sein muss. Wir glauben weiterhin an das Gute einer globalisierten Welt.

Fashion gibt es wie Sand am Meer. Upcycling sind meist auch Einzelstücke, ihr bietet aber verschiedene Grössen und Mengen an, weshalb? Was macht euch einzigartig?
Upcycling ist in unserem Verständnis das Beste aus zwei Welten. Wie bei konventionell hergestellter Mode können wir Kollektionen gestalten und unterschiedliche Grössen anbieten. Jedoch bleibt wie bei Vintage jedes Stück ein Einzelstück, weil die Stoffbeschaffenheit stets unterschiedlich ist.
Wenn «Rework» ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
«Rework» ist wie ein neugieriges und verspieltes Schweinchen, das beharrlich durch den Abfall der anderen wühlt, um seine Chancen zu nutzen. Statt auf dem Schlachthof zu landen, hofft es darauf, eines Tages zu einer prächtigen, starken Sau heranzuwachsen.

Beschreibe die typischen «Rework» Kund*innen in 3 Worten.
Am Leben interessiert.
Wo in Basel hält ihr euch am liebsten auf?
Leonie: Überall, wo es leckeres veganes Esssen gibt und am Rhein.
Marcos: Bei Anna und Marco im «Wild Wines» an einem Tasting und wegen den unkomplizierten Gespräche über Weine und das Leben. Gegenüber bei Miron im Café «Flore» für die tolle Atmosphäre und wegen der möglicherweise besten Weinauswahl in Basel. Im neu eröffneten Thai Restaurant «Nam», wenn ich Fernweh (oder Heimweh) habe und meine Lieblingssuppe brauche (Khao Soi). In eines dieser Museen Fondation Beyeler, Kunstmuseum Basel und momentan am meisten im Naturhistorischen, wegen den Interessen meiner Kinder. Ansonsten einen Donut von Mystifry oder alternativ einen Schoggiwegli mit einem Kaffee am Rheinufer geniessen.

Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger? Marcos: Mehr Wochenende, weniger Montage.
Leonie: Mehr vegane Restaurants und weniger Baustellen.
Wie wär’s mal mit...
...einem vierundzwanzigeinhalb Stunden Tag?

Vielen Dank, Leonie und Marcos, für die spannenden Einblicke.
_
von Ana Brankovic
am 22.05.2023
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Enotéka Wild Wines» Basel: Im Gespräch mit Anna und Marco Gräni
Wein muss sein! In Basel wimmelt es nur so von neuen lecker Naturweinen und Prosecco Angeboten. «Enotéka Wild Wines» an der Klybeckstrasse ist für Weinliebhaber*innen definitiv einen Besuch wert. Was es dort gibt und wie es zur Eröffnung kam, erzählen uns Anna und Marco Gräni.
![]() Hallo Anna und Marco, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Hallo Anna und Marco, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Marco: Hoi zämme ich bin Marco. Weinfreak, Hobbytaucher, Vater, Mensch. Seit 2021 Besitzer von «Wild Wines» an der Klybeckstrasse und seit diesem Jahr auch Mitbegründer des neuen Restaurant «Concordia». Ursprünglich bin ich übrigens Luzerner, genauer Wauwiler – wegen der Liebe lebe ich seit bald zehn Jahren im Kleinbasel. Meine Luzerner Freund*innen würden wohl sagen, dass meine grösste Macke ist, dass ich hier bin und nicht mehr dort, aber mir gefällt es hier einfach so verdammt gut.
Anna: Ich bin Marcos Frau und Mitbegründerin von «Wild Wines». Ich liebe Bubbles und freue mich, Teil von Wild Wines zu sein. Meine Macke ist: Ich bin ein sehr visueller Mensch und deshalb merke ich sofort, wenn im Laden das Preisschild an der Weinflasche links anstatt rechts hängt.
![]() «Enotéka Wild Wines» – Wie kam es dazu?
«Enotéka Wild Wines» – Wie kam es dazu?
Marco: Die Liebe zu gutem, handwerklich gemachten Wein, die war schon lange da. Es gibt eine unglaubliche Dynamik in der Region, von Winzer*innen, die mutig sind, neue Wege gehen und innovative Konzepte umsetzen. Beispiele dafür sind Martin Schrader, oder auch Severin und Sabeth vom Weingut Gebrüder Mathis, Ina Wihler oder Maximilian Greiner. Ich könnte noch viele weitere nennen. Dafür wollten wir einen Raum bieten – das wollten wir in die Stadt bringen, an die Weintrinker*innen und Gastronom*innen einer neuen Generation. Und wir wollten einen Laden machen, in welchem wir auch gerne einkaufen wollen würden, unkompliziert, zugänglich und mit Freude am Ganzen.
Anna: Uns ist und war besonders wichtig, dass wir einen Ort schaffen, an dem sich die Leute wohl fühlen und auch ohne Weinwissen, guten Wein kaufen können. Also Spass am guten Wein haben und wenn man will, auch etwas über den Wein oder die Winzer*innen dahinter lernen kann.
![]()
«Enotéka Wild Wines» – weshalb der Name?
Marco: Wild, weil bei uns Weine mit Charakter im Zentrum stehen. Weine, die Tiefe haben – Ecken, Kanten. Die oft auch eine wilde, ungestüme Seite haben. Die Lust auf mehr machen. Klar, klassisch Rot Weiss Rosé – aber auch Orange, Pét-Nats, Experimente von mutigen Winzer*innen, handwerklichen Wermut, sogar Dosenwein - Wir möchten die ungewohnte, innovative, junge, wilde Seite der ganzen Weinkultur zeigen. Und den jungen Winzer*innen eine Plattform bieten. Darum veranstalten wir auch regelmässig kostenlose Degustationen bei uns im Laden, wo wir Winzer*innen und Kund*innen unkompliziert und direkt zusammenbringen.
![]()
![]()
Welche Werte in Sachen Gastronomie und Trinkkultur vertritt ihr?
Anna: Wir lieben lokale, innovative Projekte, bei welchen Qualität im Vordergrund steht. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn im Kleinbasel ein neues Gastroprojekt startet.
Marco: Mir ist enorm wichtig, dass wir mit Produkten arbeiten, die ehrlich sind und die den Charakter des Ortes zeigen, wo sie herkommen. Die geprägt sind vom Handwerk, von den Menschen, die sie geschaffen haben. Und die mit Respekt gegenüber Natur und Mensch hergestellt worden sind.
![]()
Wenn «Enotéka Wild Wines» ein fiktiver oder realer Urlaubsort wäre, welcher wäre es und weshalb?
Anna: Im Idealfall wäre «Wild Wines» zusätzlich eine Bar, an der die Weine mit unseren Stammkund*innen gemeinsam auch getrunken werden können. Z.B. wie das alte «Grenzwert» an der Rheingasse einfach als «Wild Wines» Bar.
Beschreibt die typischen Enotéka Wild Wines Besucher*innen in 3 Worten.
Marco: Jung, divers, stilvoll.
Anna: Neugierig, Qualitätsbewusst und Lebensfroh.
![]()
Wo in Basel hält ihr euch am liebsten auf?
Marco: Am allerliebsten bin ich draussen in der Natur, am Wandern. Aber natürlich habe ich auch Lieblingsorte in der Stadt: «Herz», «Blaupause», «Irrsinn» kommen mir dabei spontan in den Sinn. Und natürlich das «Astro Fries». Und wenn ich mal eine Pause brauche, bin ich am liebsten auf einer der Rheinfähren.
Anna: Die alte «Flora Buvette» war einer meiner Lieblingsorte. Jetzt, wo es wärmer wird, bin ich öfters auf der Kaserne Wiese und in der «Kabar». Hier können sich die Kids austoben und ich gemütlich einen Kaffee oder Mimosa trinken. Zum Essen gehe ich gerne ins «La Fourchette» oder Restaurant «Concordia».
![]()
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Marco: Mehr Naturweine! Da haben wir in der Schweiz noch Potential, vor allem verglichen mit anderen Regionen in Europa. Weniger langweilig gemachte, banale Chasselas.
Anna: Mehr echte kinderfreundliche Restaurants und etwas weniger Ernsthaftigkeit wäre manchmal auch gut.
![]()
Wie wär’s mal mit...
Marco: ...Bubbles?
Anna: ...einem Pétnat anstatt dem klassischen Prosecco?
![]()
Vielen Dank an Anna und Marco – auch für den leckeren Wein und Prösi!
_
von Ana Brankovic
am 08.05.2023
Fotos
© Christina Cattelani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Marco: Hoi zämme ich bin Marco. Weinfreak, Hobbytaucher, Vater, Mensch. Seit 2021 Besitzer von «Wild Wines» an der Klybeckstrasse und seit diesem Jahr auch Mitbegründer des neuen Restaurant «Concordia». Ursprünglich bin ich übrigens Luzerner, genauer Wauwiler – wegen der Liebe lebe ich seit bald zehn Jahren im Kleinbasel. Meine Luzerner Freund*innen würden wohl sagen, dass meine grösste Macke ist, dass ich hier bin und nicht mehr dort, aber mir gefällt es hier einfach so verdammt gut.
Anna: Ich bin Marcos Frau und Mitbegründerin von «Wild Wines». Ich liebe Bubbles und freue mich, Teil von Wild Wines zu sein. Meine Macke ist: Ich bin ein sehr visueller Mensch und deshalb merke ich sofort, wenn im Laden das Preisschild an der Weinflasche links anstatt rechts hängt.
Marco: Die Liebe zu gutem, handwerklich gemachten Wein, die war schon lange da. Es gibt eine unglaubliche Dynamik in der Region, von Winzer*innen, die mutig sind, neue Wege gehen und innovative Konzepte umsetzen. Beispiele dafür sind Martin Schrader, oder auch Severin und Sabeth vom Weingut Gebrüder Mathis, Ina Wihler oder Maximilian Greiner. Ich könnte noch viele weitere nennen. Dafür wollten wir einen Raum bieten – das wollten wir in die Stadt bringen, an die Weintrinker*innen und Gastronom*innen einer neuen Generation. Und wir wollten einen Laden machen, in welchem wir auch gerne einkaufen wollen würden, unkompliziert, zugänglich und mit Freude am Ganzen.
Anna: Uns ist und war besonders wichtig, dass wir einen Ort schaffen, an dem sich die Leute wohl fühlen und auch ohne Weinwissen, guten Wein kaufen können. Also Spass am guten Wein haben und wenn man will, auch etwas über den Wein oder die Winzer*innen dahinter lernen kann.
«Enotéka Wild Wines» – weshalb der Name?
Marco: Wild, weil bei uns Weine mit Charakter im Zentrum stehen. Weine, die Tiefe haben – Ecken, Kanten. Die oft auch eine wilde, ungestüme Seite haben. Die Lust auf mehr machen. Klar, klassisch Rot Weiss Rosé – aber auch Orange, Pét-Nats, Experimente von mutigen Winzer*innen, handwerklichen Wermut, sogar Dosenwein - Wir möchten die ungewohnte, innovative, junge, wilde Seite der ganzen Weinkultur zeigen. Und den jungen Winzer*innen eine Plattform bieten. Darum veranstalten wir auch regelmässig kostenlose Degustationen bei uns im Laden, wo wir Winzer*innen und Kund*innen unkompliziert und direkt zusammenbringen.

Welche Werte in Sachen Gastronomie und Trinkkultur vertritt ihr?
Anna: Wir lieben lokale, innovative Projekte, bei welchen Qualität im Vordergrund steht. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn im Kleinbasel ein neues Gastroprojekt startet.
Marco: Mir ist enorm wichtig, dass wir mit Produkten arbeiten, die ehrlich sind und die den Charakter des Ortes zeigen, wo sie herkommen. Die geprägt sind vom Handwerk, von den Menschen, die sie geschaffen haben. Und die mit Respekt gegenüber Natur und Mensch hergestellt worden sind.
Wenn «Enotéka Wild Wines» ein fiktiver oder realer Urlaubsort wäre, welcher wäre es und weshalb?
Anna: Im Idealfall wäre «Wild Wines» zusätzlich eine Bar, an der die Weine mit unseren Stammkund*innen gemeinsam auch getrunken werden können. Z.B. wie das alte «Grenzwert» an der Rheingasse einfach als «Wild Wines» Bar.
Beschreibt die typischen Enotéka Wild Wines Besucher*innen in 3 Worten.
Marco: Jung, divers, stilvoll.
Anna: Neugierig, Qualitätsbewusst und Lebensfroh.

Wo in Basel hält ihr euch am liebsten auf?
Marco: Am allerliebsten bin ich draussen in der Natur, am Wandern. Aber natürlich habe ich auch Lieblingsorte in der Stadt: «Herz», «Blaupause», «Irrsinn» kommen mir dabei spontan in den Sinn. Und natürlich das «Astro Fries». Und wenn ich mal eine Pause brauche, bin ich am liebsten auf einer der Rheinfähren.
Anna: Die alte «Flora Buvette» war einer meiner Lieblingsorte. Jetzt, wo es wärmer wird, bin ich öfters auf der Kaserne Wiese und in der «Kabar». Hier können sich die Kids austoben und ich gemütlich einen Kaffee oder Mimosa trinken. Zum Essen gehe ich gerne ins «La Fourchette» oder Restaurant «Concordia».
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Marco: Mehr Naturweine! Da haben wir in der Schweiz noch Potential, vor allem verglichen mit anderen Regionen in Europa. Weniger langweilig gemachte, banale Chasselas.
Anna: Mehr echte kinderfreundliche Restaurants und etwas weniger Ernsthaftigkeit wäre manchmal auch gut.
Wie wär’s mal mit...
Marco: ...Bubbles?
Anna: ...einem Pétnat anstatt dem klassischen Prosecco?
Vielen Dank an Anna und Marco – auch für den leckeren Wein und Prösi!
_
von Ana Brankovic
am 08.05.2023
Fotos
© Christina Cattelani für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
DOCK Ausleihe: Im Gespräch mit Künstler*innen und Mieter*innen
Regionale Kunst erobert neue Orte! In einer Kooperation zwischen Kulturverein Wie wär’s mal mit und DOCK Ausleihe zeigen wir vom DOCK geliehene originale Kunstwerke an neuen Orten in Basel. Einer der Orte war auch der Vereinscontainer von Wie wär’s mal mit an der Uferstrasse 40. Wir sprachen mit weiteren Künstler*innen und Mieter*innen über ihre Erfahrungen.
![]()
Parvez’ Werk «Suspended Brevity» (2015) wurde von Jan Schudel privat geliehen. Wie es dazu kam? Das erzählen uns beide.
Lieber Parvez, 3 Worte, die dich und deine Arbeit beschreiben.
Conceptual, non-conformist, trans-cultural
Weshalb hast du dich entschieden deine Werke für die Ausleihe zur Verfügung zu stellen?
Ich schätze das Konzept der DOCK Ausleihe. Sie ist wie eine Brücke zwischen Menschen und Kunst, ohne den Druck, Kunst kaufen zu müssen und macht Kunstwerke verfügbar und für jeden zugänglich. Als Künstler schätze ich die Tatsache, dass jemand, der mich weder kennt noch eine Ahnung von meiner Kunstpraxis hat, ein Werk tatsächlich mögen kann, einfach wegen des Werks. Das ist schön und äusserst befriedigend.
Was war dein besonderes Erlebnis mit Menschen, die dein Werk gemietet haben?
Ich sass mit meiner Familie im Zug nach Basel. Direkt gegenüber von uns sass eine andere Familie mit zwei Kindern. Bald fingen unsere beiden Kinder an, mit den anderen beiden zu spielen, und ihre Eltern begannen, sich mit meiner Partnerin zu unterhalten. Ich blieb für mich, da ich dem Schweizerdeutsch immer noch nicht gut folgen kann. Nach einer Weile fragte mich der Herr etwas und wir tauschten bald unsere Namen aus. Plötzlich fragte er mich, ob ich Künstler sei. Ich war etwas überrascht, aber es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Herrn um Jan Schudel handelte, der durch die DOCK Ausleihe auf meine Arbeit aufmerksam geworden war. Wir sind uns vorher nie begegnet, da ein Kurier das Werk in meinem Atelier abgeholt hat. Es war eine grosse Freude, ihn kennenzulernen. Er und seine Partnerin erzählten, wie und warum sie meine Arbeit mögen und dass sie es gerne in ihrem Haus haben.
Wie wär’s mal mit...
...Kunst?
![]()
Hey Jan Schudel, 3 Worte, die den Ort beschreiben.
Wohnzimmer, daheim, zwischen zwei Fenstern
Kurz zu dir, weshalb hast du Parvez’ Werk gemietet und wie findest du das Konzept der Kunstausleihe?
Ich bin Jan Schudel, habe Geschichte und Volkswirtschaft studiert, arbeite seit 14 Jahren bei der Binding Stiftung im Bereich der Finanzierung von Umwelt- und Sozialprojekten. Die Binding Stiftung hat DOCK mitfinanziert und so lernte ich das Konzept kennen, war aber noch nie da. Ich hatte mir privat seit langem mehr Kunst in unserer Wohnung gewünscht und Dank der Kunstausleihe muss man ein Werk nicht auf ewig kaufen und lernt zudem unterschiedliche Künstler*innen aus der Region kennen. Das Werk haben wir aus einem sehr persönlichen Grund gemietet. Die von Parvez fotografierte Seifenblase signalisiert Zerbrechlichkeit, die Brüchigkeit des Moments. Uns hat diese Symbolik an den Tod unseres Sohnes Valentin erinnert, der 2015 bei der Geburt gestorben ist.
Was war ein besonderes Erlebnis mit dem gemieteten Werk?
Lustig war, dass wir im Zug eine Kollegin meiner Frau getroffen haben und es stellte sich heraus, dass ihr Mann Parvez ist, der Künstler, dessen Werk jetzt bei uns zuhause hängt. Parvez und ich haben uns dann auch mal persönlich getroffen mit unseren Töchtern an einem “Papi-Morgen”, und ich habe viel über die Entstehung des Bildes, die Biographie und die künstlerische Arbeit von Parvez erfahren.
Wie wär’s mal mit...
...einem weiteren Werk von der DOCK Ausleihe?
![]()
Anina Müllers Werk «Pretty Little Things» (2019) sind Porzellanrosen, die physisch nicht viel Raum einnehmen und somit schnell übersehen werden, was sie mit frustriertem, lautem Fluchen kompensieren. Wer die Künstlerin ist und warum Verein Wie wär’s mal mit ihr Werk geliehen hat?
Liebe Anina, 3 Worte, die dich und deine Arbeit beschreiben.
Kitschig, deep, humorvoll
Weshalb hast du dich entschieden deine Werke für die Ausleihe zur Verfügung zu stellen?
Ich freue mich, wenn sich andere über meine Arbeiten freuen und durch die Ausleihe können sich unendlich viele Menschen freuen und das freut mich.
Was war dein besonderes Erlebnis mit Menschen, die dein Werk gemietet haben?
Bis anhin wurden meine Werke noch nicht gemietet, aber ich stelle mir das Szenario vor, dass während der Art Basel Leonardo DiCaprio oder Cardi B ins DOCK stolpern, um sich vor Paparazzis zu schützen und da mein Werk entdecken. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Mein Kunstwerk und Cardi DiCaprio turteln die restliche Woche über beide Ohren verliebt durch die Stadt.
Wie wär’s mal mit...
...no Frontex!
![]()
Hey Verein Wie wär’s mal mit, 3 Worte, die den Ort beschreiben.
Roh, industriell, Container
Kurz zu euch, weshalb habt ihr Anina’s Werk gemietet und wie findet ihr das Konzept der Kunstausleihe?
Ich bin Ana Brankovic, Kulturschaffende und Leiterin vom Kulturverein Wie wär’s mal mit. Durch verschiedene Kooperationen kam ich vor Jahren in Kontakt mit DOCK. Dass man dort Werke regionaler Künstler*innen mieten kann, ermöglicht Flexibilität und bringt Kunst in verschiedene, spannende Kontexte, statt es an einem fixen Ort oder in einer Institution zu verankern.
Was war ein besonderes Erlebnis mit dem gemieteten Werk?
Zusätzlich zum geliehenen Werk «Pretty Little Things» (2019) hatte Anina Müller im September 2022 die Performance Premiere «GRWM» (2022) im Container. Super humorvoll, super grandios!
Wie wär’s mal mit...
...leihen statt besitzen?
![]()
Statt in Museen und Ausstellungsräumen kommen Kunstwerke an unübliche Orte. So kam Anjuli Theis Werk «Himmel und Erde» ins Geburtshaus Matthea in Basel.
Liebe Anjuli, 3 Worte, die dich und deine Arbeit beschreiben.
Sinnlich, stofflich, genussvoll
Weshalb hast du dich entschieden deine Werke für die Ausleihe zur Verfügung zu stellen?
Ich finde die Ausleihe wunderbar, weil sie einen niederschwelligen Zugang zu lokaler Kunst ermöglicht. Die Werke bleiben in Bewegung, werden gesehen, werden genutzt.
Was war dein besonderes Erlebnis mit Menschen, die dein Werk gemietet haben?
Ich kann nicht ein Erlebnis hervorheben. Die Begegnungen, mit Mieter*innen waren bis jetzt alle sehr bereichernd und sehr verschieden. Es kommen interessierte und interessante Menschen zu mir ins Atelier. Das ist inspirierend.
Wie wär’s mal mit...
...Sinnlichkeit.
![]()
Hey Regina vom Geburtshaus Matthea, 3 Worte, die den Ort beschreiben.
Oben, unten, Reisebeginn.
Kurz zu dir, weshalb hast du für das Geburtshaus Matthea das Werk von Anjuli Theis’ gemietet und wie findest du das Konzept der Kunstausleihe?
Ich bin Regina, Mitbegründerin und Geschäftsführerin im Geburtshaus Matthea und Hebamme aus Leidenschaft. Ich finde das Konzept der Kunstausleihe super, da so die Kunst unter Menschen kommt, die sonst damit wenig Berührungspunkte haben. Kunst ist dadurch dort, wo das Leben spielt und kommt durch die Ausleihe in Bewegung. Wir haben uns lange besprochen ob wir ein Bild aussuchen, welches direkt thematisch mit dem Geburtshaus in Zusammenhang steht z.B. Motive mit Vagina oder Nachtkerzenöl und haben uns dann dagegen und für ein Himmelbild entschieden. Uns hat die Leichtigkeit und Frische der Farbe Blau gefallen und der Himmel als Zusammenhang zu dem, was in einem Geburtshaus passiert: Leben, Neugeborene, die von weit her reisen, Verbundenheit mit der Natur und dem Universum.
Was war ein besonderes Erlebnis mit dem gemieteten Werk?
Das Bild heisst «Himmel und Erde», aber wir haben bis jetzt die Erde noch nicht gefunden (lacht). Da müssen wir uns wohl mit der Künstlerin austauschen.
Wie wär’s mal mit...
...der Ausleihe eines weiteren Werkes, wir wären dabei!
_
von Ana Brankovic
am 31.Oktober 2022
Fotos
© Wie wär’s mal mit, DOCK, Jan Schudel, Parvez
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Parvez’ Werk «Suspended Brevity» (2015) wurde von Jan Schudel privat geliehen. Wie es dazu kam? Das erzählen uns beide.
Lieber Parvez, 3 Worte, die dich und deine Arbeit beschreiben.
Conceptual, non-conformist, trans-cultural
Weshalb hast du dich entschieden deine Werke für die Ausleihe zur Verfügung zu stellen?
Ich schätze das Konzept der DOCK Ausleihe. Sie ist wie eine Brücke zwischen Menschen und Kunst, ohne den Druck, Kunst kaufen zu müssen und macht Kunstwerke verfügbar und für jeden zugänglich. Als Künstler schätze ich die Tatsache, dass jemand, der mich weder kennt noch eine Ahnung von meiner Kunstpraxis hat, ein Werk tatsächlich mögen kann, einfach wegen des Werks. Das ist schön und äusserst befriedigend.
Was war dein besonderes Erlebnis mit Menschen, die dein Werk gemietet haben?
Ich sass mit meiner Familie im Zug nach Basel. Direkt gegenüber von uns sass eine andere Familie mit zwei Kindern. Bald fingen unsere beiden Kinder an, mit den anderen beiden zu spielen, und ihre Eltern begannen, sich mit meiner Partnerin zu unterhalten. Ich blieb für mich, da ich dem Schweizerdeutsch immer noch nicht gut folgen kann. Nach einer Weile fragte mich der Herr etwas und wir tauschten bald unsere Namen aus. Plötzlich fragte er mich, ob ich Künstler sei. Ich war etwas überrascht, aber es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Herrn um Jan Schudel handelte, der durch die DOCK Ausleihe auf meine Arbeit aufmerksam geworden war. Wir sind uns vorher nie begegnet, da ein Kurier das Werk in meinem Atelier abgeholt hat. Es war eine grosse Freude, ihn kennenzulernen. Er und seine Partnerin erzählten, wie und warum sie meine Arbeit mögen und dass sie es gerne in ihrem Haus haben.
Wie wär’s mal mit...
...Kunst?

Hey Jan Schudel, 3 Worte, die den Ort beschreiben.
Wohnzimmer, daheim, zwischen zwei Fenstern
Kurz zu dir, weshalb hast du Parvez’ Werk gemietet und wie findest du das Konzept der Kunstausleihe?
Ich bin Jan Schudel, habe Geschichte und Volkswirtschaft studiert, arbeite seit 14 Jahren bei der Binding Stiftung im Bereich der Finanzierung von Umwelt- und Sozialprojekten. Die Binding Stiftung hat DOCK mitfinanziert und so lernte ich das Konzept kennen, war aber noch nie da. Ich hatte mir privat seit langem mehr Kunst in unserer Wohnung gewünscht und Dank der Kunstausleihe muss man ein Werk nicht auf ewig kaufen und lernt zudem unterschiedliche Künstler*innen aus der Region kennen. Das Werk haben wir aus einem sehr persönlichen Grund gemietet. Die von Parvez fotografierte Seifenblase signalisiert Zerbrechlichkeit, die Brüchigkeit des Moments. Uns hat diese Symbolik an den Tod unseres Sohnes Valentin erinnert, der 2015 bei der Geburt gestorben ist.
Was war ein besonderes Erlebnis mit dem gemieteten Werk?
Lustig war, dass wir im Zug eine Kollegin meiner Frau getroffen haben und es stellte sich heraus, dass ihr Mann Parvez ist, der Künstler, dessen Werk jetzt bei uns zuhause hängt. Parvez und ich haben uns dann auch mal persönlich getroffen mit unseren Töchtern an einem “Papi-Morgen”, und ich habe viel über die Entstehung des Bildes, die Biographie und die künstlerische Arbeit von Parvez erfahren.
Wie wär’s mal mit...
...einem weiteren Werk von der DOCK Ausleihe?
Anina Müllers Werk «Pretty Little Things» (2019) sind Porzellanrosen, die physisch nicht viel Raum einnehmen und somit schnell übersehen werden, was sie mit frustriertem, lautem Fluchen kompensieren. Wer die Künstlerin ist und warum Verein Wie wär’s mal mit ihr Werk geliehen hat?
Liebe Anina, 3 Worte, die dich und deine Arbeit beschreiben.
Kitschig, deep, humorvoll
Weshalb hast du dich entschieden deine Werke für die Ausleihe zur Verfügung zu stellen?
Ich freue mich, wenn sich andere über meine Arbeiten freuen und durch die Ausleihe können sich unendlich viele Menschen freuen und das freut mich.
Was war dein besonderes Erlebnis mit Menschen, die dein Werk gemietet haben?
Bis anhin wurden meine Werke noch nicht gemietet, aber ich stelle mir das Szenario vor, dass während der Art Basel Leonardo DiCaprio oder Cardi B ins DOCK stolpern, um sich vor Paparazzis zu schützen und da mein Werk entdecken. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Mein Kunstwerk und Cardi DiCaprio turteln die restliche Woche über beide Ohren verliebt durch die Stadt.
Wie wär’s mal mit...
...no Frontex!
Hey Verein Wie wär’s mal mit, 3 Worte, die den Ort beschreiben.
Roh, industriell, Container
Kurz zu euch, weshalb habt ihr Anina’s Werk gemietet und wie findet ihr das Konzept der Kunstausleihe?
Ich bin Ana Brankovic, Kulturschaffende und Leiterin vom Kulturverein Wie wär’s mal mit. Durch verschiedene Kooperationen kam ich vor Jahren in Kontakt mit DOCK. Dass man dort Werke regionaler Künstler*innen mieten kann, ermöglicht Flexibilität und bringt Kunst in verschiedene, spannende Kontexte, statt es an einem fixen Ort oder in einer Institution zu verankern.
Was war ein besonderes Erlebnis mit dem gemieteten Werk?
Zusätzlich zum geliehenen Werk «Pretty Little Things» (2019) hatte Anina Müller im September 2022 die Performance Premiere «GRWM» (2022) im Container. Super humorvoll, super grandios!
Wie wär’s mal mit...
...leihen statt besitzen?
Statt in Museen und Ausstellungsräumen kommen Kunstwerke an unübliche Orte. So kam Anjuli Theis Werk «Himmel und Erde» ins Geburtshaus Matthea in Basel.
Liebe Anjuli, 3 Worte, die dich und deine Arbeit beschreiben.
Sinnlich, stofflich, genussvoll
Weshalb hast du dich entschieden deine Werke für die Ausleihe zur Verfügung zu stellen?
Ich finde die Ausleihe wunderbar, weil sie einen niederschwelligen Zugang zu lokaler Kunst ermöglicht. Die Werke bleiben in Bewegung, werden gesehen, werden genutzt.
Was war dein besonderes Erlebnis mit Menschen, die dein Werk gemietet haben?
Ich kann nicht ein Erlebnis hervorheben. Die Begegnungen, mit Mieter*innen waren bis jetzt alle sehr bereichernd und sehr verschieden. Es kommen interessierte und interessante Menschen zu mir ins Atelier. Das ist inspirierend.
Wie wär’s mal mit...
...Sinnlichkeit.

Hey Regina vom Geburtshaus Matthea, 3 Worte, die den Ort beschreiben.
Oben, unten, Reisebeginn.
Kurz zu dir, weshalb hast du für das Geburtshaus Matthea das Werk von Anjuli Theis’ gemietet und wie findest du das Konzept der Kunstausleihe?
Ich bin Regina, Mitbegründerin und Geschäftsführerin im Geburtshaus Matthea und Hebamme aus Leidenschaft. Ich finde das Konzept der Kunstausleihe super, da so die Kunst unter Menschen kommt, die sonst damit wenig Berührungspunkte haben. Kunst ist dadurch dort, wo das Leben spielt und kommt durch die Ausleihe in Bewegung. Wir haben uns lange besprochen ob wir ein Bild aussuchen, welches direkt thematisch mit dem Geburtshaus in Zusammenhang steht z.B. Motive mit Vagina oder Nachtkerzenöl und haben uns dann dagegen und für ein Himmelbild entschieden. Uns hat die Leichtigkeit und Frische der Farbe Blau gefallen und der Himmel als Zusammenhang zu dem, was in einem Geburtshaus passiert: Leben, Neugeborene, die von weit her reisen, Verbundenheit mit der Natur und dem Universum.
Was war ein besonderes Erlebnis mit dem gemieteten Werk?
Das Bild heisst «Himmel und Erde», aber wir haben bis jetzt die Erde noch nicht gefunden (lacht). Da müssen wir uns wohl mit der Künstlerin austauschen.
Wie wär’s mal mit...
...der Ausleihe eines weiteren Werkes, wir wären dabei!
_
von Ana Brankovic
am 31.Oktober 2022
Fotos
© Wie wär’s mal mit, DOCK, Jan Schudel, Parvez
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Morris Manser»: Im Gespräch mit dem Modedesigner
Ein «Morris Manser» Kleidungsstück entsteht von A-Z im Atelier von Morris in Basel. Fashion gibt’s wie Sand am Meer, warum also ein eigenes Modelabel gründen? Was der Unterschied zwischen Bekleidung und Mode ist und noch einiges mehr erzählt uns Morris Manser im Gespräch.
![]()
Lieber Morris, wer bist du und was ist deine grösste Macke?
Ich bin Morris Manser und werde vom Eigenartigen angezogen.
«Morris Manser» – wie kam es du zu deinem eigenen Modelabel?
Durch meinen natürlichen Drang mich kreativ und handwerklich auszudrücken, entstanden und entstehen laufend Projekte mit visuellem Output. So gründete ich relativ früh eine Art Herkunftsbezeichnung, wie es bei Käse, Wein und anderen Spezialitäten mit Abkürzungen wie DOP, DOC etc. üblich ist. «Morris Manser» bezeichnet somit jeglichen Output meinerseits, kommt in Begleitung einer Arbeit und zeichnet diese als die Meine aus. Mode bestimmt den Grossteil dieser Arbeit.
![]()
Erzähl uns mehr über dich.
Eine kurze Übersicht über meine Entwicklung: Ich bin mit meinen beiden Geschwistern aufgewachsen, habe viel Zeit in der Natur und mit der Familie geniessen dürfen. Besuchte das Gymnasium, dann den Vorkurs für Gestaltung und Kunst in Basel. Zwischen Matura und Vorkurs war ich für 300 Tage in der Schweizer Armee, als Führungsstaffelsoldat. Die ganzen zwischenmenschlichen Fragen des visuellen Erscheinungsbildes von Menschen faszinieren mich, so begann ich das Modedesign Studium in Genf an der Haute École d’Art et du Design. Noch vor dem Bachelor arbeitete ich entscheidend an der Spring/Summer 21 Main Collection bei dem Pariser Modelabel Y/PROJECT mit. Im Sommer 2021 habe ich meinen Bachelorabschluss in Modedesign gemacht und arbeite seitdem selbstständig und als Freelancer an Projekten und Produktionen im Bereich Modedesign. Weitere Bereiche, welche meine Arbeit umfassen, sind Kostümbild, Merch-Design, Coaching und Kreative Direktion für Musiker*innen. Momentan arbeite ich an meiner eigenen Modekollektion, welche ich voraussichtlich im Herbst an der Mode Suisse Edition 2022 in Zürich präsentiere.
![]()
Wie kommt ein Morris Manser Kleidungsstück zustande?
Ein «Morris Manser» Kleidungsstück wird von A-Z von mir in meinem Atelier in Basel entwickelt. Jedes Kleidungsstück macht einen eigenen Entstehungsprozess durch, aber folgende Schritte sind bei allen dieselben, wenn auch oft in unterschiedlicher Reihenfolge: Idee, Reifung der Idee mit Zeichnungen, Recherche zu Referenzen und Möglichkeiten zur Umsetzung, Impuls der Umsetzung auslöst, Schnittmuster zeichnen, Prototyp 1 nähen, Fitting auf Model und Anpassungen vornehmen, Anpassungen auf Schnittmuster übertragen, Prototyp 2 nähen und fitten, all diese Schritte bis der Schnitt perfekt passt, dann die zweite Recherche zu Details und Materialbearbeitungstechniken, Stoffe und Nähaccessoires organisieren (nahezu alle aus Deadstock-Quellen), Stoff waschen, Stoff zuschneiden, jedes Stoffstück zur Verarbeitung vorbereiten (Einlagen etc.), Nähen, Bügeln.
Was inspiriert dich im Leben?
Mich inspirieren Menschen, die mit einer unermüdlichen Energie und Neugierde leben.
![]() Fashion gibt's wie Sand am Meer. Weshalb braucht die Welt deine Mode? Was macht diese einzigartig?
Fashion gibt's wie Sand am Meer. Weshalb braucht die Welt deine Mode? Was macht diese einzigartig?
Fashion gibt es tatsächlich wie Sand am Meer. An dieser Stelle würde ich gerne den Unterschied von Bekleidung und Mode nennen. Mode entsteht aus einem kreativen Konzept und erschafft ein Image, welches viel weiter reicht als das der Kleidung an sich. Meine Arbeit beruht auf tief durchdachten Gedanken und Konzepten. So hat jedes Detail ein Grund so zu sein, wie es ist. Durchdachte Modepraxis ist vergleichbar mit Kunst und besitzt so die Fähigkeit im Menschen Emotionen auszulösen und somit positiv zu beeinflussen. Meine Mode weckt Neugierde und zeigt den Leuten, wie viel mehr in einem Kleidungsstück steckt als auf den ersten Blick sichtbar ist. Der zweite Blick ist jener, der mich interessiert. Dieser passiert oft auch erst später in Gedanken.
![]()
Beschreibe einen ganz normalen Arbeitstag im Atelier.
Jeder Tag ist anders. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Oft beginnt der Tag mit Bügeleisen anstellen, Bialetti Kaffee, 2B Bleistift und Papier. Zeichnen oder auch nur notieren, was heute ansteht. Dann gehts auch schon schnell ans arbeiten. Mittagspause wird draussen verbracht und am Nachmittag wird die begonnene Arbeit fortgesetzt. Musik läuft durchgehend, kein präzises Genre sondern eine umfangreiche Vielfalt. Es kommt oft vor, dass ich die Musik der Art der Arbeit anpasse. Je nach vorhandener Energie wird es 18 Uhr oder 23 Uhr.
Ein lustiges Erlebnis bisher als Modedesigner?
Ich denke auf Nadeln geschlafen haben schon viele, deshalb eine andere Anekdote. Wir waren eine grosse Gruppe, so 20 Personen, ich kannte nur um die 5 Personen. Es wurde nach Sicherheitsnadeln gefragt, solche trage ich stets in meiner linken Hosentasche mit. Drei Personen haben sich gemeldet, Nadeln dabei zu haben. So erfuhr ich von den anderen beiden, dass sie auch Modedesigner sind.
![]()
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte was wäre das?
Zeit, denn mehr Zeit verträgt es immer.
Wo in Basel bist du am liebsten und weshalb?
Ich bin sehr gerne in meinem Atelier, im Pizza Point an der Elsässerstrasse und im Gärtli am Rhein, denn dort habe ich meine Ruhe und kann in Gedanken versinken.
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Die Schweiz braucht mehr Durchmischung.
Die Schweiz braucht weniger Stolz.
Wie wär's mal mit…
…Hallo sagen?
![]()
Vielen Dank Morris für den spannenden Einblick in sein kreatives Schaffen in Basel.
_
von Ana Brankovic
am 11.07.2022
Fotos
© Sina Sauro für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Lieber Morris, wer bist du und was ist deine grösste Macke?
Ich bin Morris Manser und werde vom Eigenartigen angezogen.
«Morris Manser» – wie kam es du zu deinem eigenen Modelabel?
Durch meinen natürlichen Drang mich kreativ und handwerklich auszudrücken, entstanden und entstehen laufend Projekte mit visuellem Output. So gründete ich relativ früh eine Art Herkunftsbezeichnung, wie es bei Käse, Wein und anderen Spezialitäten mit Abkürzungen wie DOP, DOC etc. üblich ist. «Morris Manser» bezeichnet somit jeglichen Output meinerseits, kommt in Begleitung einer Arbeit und zeichnet diese als die Meine aus. Mode bestimmt den Grossteil dieser Arbeit.

Erzähl uns mehr über dich.
Eine kurze Übersicht über meine Entwicklung: Ich bin mit meinen beiden Geschwistern aufgewachsen, habe viel Zeit in der Natur und mit der Familie geniessen dürfen. Besuchte das Gymnasium, dann den Vorkurs für Gestaltung und Kunst in Basel. Zwischen Matura und Vorkurs war ich für 300 Tage in der Schweizer Armee, als Führungsstaffelsoldat. Die ganzen zwischenmenschlichen Fragen des visuellen Erscheinungsbildes von Menschen faszinieren mich, so begann ich das Modedesign Studium in Genf an der Haute École d’Art et du Design. Noch vor dem Bachelor arbeitete ich entscheidend an der Spring/Summer 21 Main Collection bei dem Pariser Modelabel Y/PROJECT mit. Im Sommer 2021 habe ich meinen Bachelorabschluss in Modedesign gemacht und arbeite seitdem selbstständig und als Freelancer an Projekten und Produktionen im Bereich Modedesign. Weitere Bereiche, welche meine Arbeit umfassen, sind Kostümbild, Merch-Design, Coaching und Kreative Direktion für Musiker*innen. Momentan arbeite ich an meiner eigenen Modekollektion, welche ich voraussichtlich im Herbst an der Mode Suisse Edition 2022 in Zürich präsentiere.

Wie kommt ein Morris Manser Kleidungsstück zustande?
Ein «Morris Manser» Kleidungsstück wird von A-Z von mir in meinem Atelier in Basel entwickelt. Jedes Kleidungsstück macht einen eigenen Entstehungsprozess durch, aber folgende Schritte sind bei allen dieselben, wenn auch oft in unterschiedlicher Reihenfolge: Idee, Reifung der Idee mit Zeichnungen, Recherche zu Referenzen und Möglichkeiten zur Umsetzung, Impuls der Umsetzung auslöst, Schnittmuster zeichnen, Prototyp 1 nähen, Fitting auf Model und Anpassungen vornehmen, Anpassungen auf Schnittmuster übertragen, Prototyp 2 nähen und fitten, all diese Schritte bis der Schnitt perfekt passt, dann die zweite Recherche zu Details und Materialbearbeitungstechniken, Stoffe und Nähaccessoires organisieren (nahezu alle aus Deadstock-Quellen), Stoff waschen, Stoff zuschneiden, jedes Stoffstück zur Verarbeitung vorbereiten (Einlagen etc.), Nähen, Bügeln.
Was inspiriert dich im Leben?
Mich inspirieren Menschen, die mit einer unermüdlichen Energie und Neugierde leben.
 Fashion gibt's wie Sand am Meer. Weshalb braucht die Welt deine Mode? Was macht diese einzigartig?
Fashion gibt's wie Sand am Meer. Weshalb braucht die Welt deine Mode? Was macht diese einzigartig?Fashion gibt es tatsächlich wie Sand am Meer. An dieser Stelle würde ich gerne den Unterschied von Bekleidung und Mode nennen. Mode entsteht aus einem kreativen Konzept und erschafft ein Image, welches viel weiter reicht als das der Kleidung an sich. Meine Arbeit beruht auf tief durchdachten Gedanken und Konzepten. So hat jedes Detail ein Grund so zu sein, wie es ist. Durchdachte Modepraxis ist vergleichbar mit Kunst und besitzt so die Fähigkeit im Menschen Emotionen auszulösen und somit positiv zu beeinflussen. Meine Mode weckt Neugierde und zeigt den Leuten, wie viel mehr in einem Kleidungsstück steckt als auf den ersten Blick sichtbar ist. Der zweite Blick ist jener, der mich interessiert. Dieser passiert oft auch erst später in Gedanken.

Beschreibe einen ganz normalen Arbeitstag im Atelier.
Jeder Tag ist anders. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Oft beginnt der Tag mit Bügeleisen anstellen, Bialetti Kaffee, 2B Bleistift und Papier. Zeichnen oder auch nur notieren, was heute ansteht. Dann gehts auch schon schnell ans arbeiten. Mittagspause wird draussen verbracht und am Nachmittag wird die begonnene Arbeit fortgesetzt. Musik läuft durchgehend, kein präzises Genre sondern eine umfangreiche Vielfalt. Es kommt oft vor, dass ich die Musik der Art der Arbeit anpasse. Je nach vorhandener Energie wird es 18 Uhr oder 23 Uhr.
Ein lustiges Erlebnis bisher als Modedesigner?
Ich denke auf Nadeln geschlafen haben schon viele, deshalb eine andere Anekdote. Wir waren eine grosse Gruppe, so 20 Personen, ich kannte nur um die 5 Personen. Es wurde nach Sicherheitsnadeln gefragt, solche trage ich stets in meiner linken Hosentasche mit. Drei Personen haben sich gemeldet, Nadeln dabei zu haben. So erfuhr ich von den anderen beiden, dass sie auch Modedesigner sind.

Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte was wäre das?
Zeit, denn mehr Zeit verträgt es immer.
Wo in Basel bist du am liebsten und weshalb?
Ich bin sehr gerne in meinem Atelier, im Pizza Point an der Elsässerstrasse und im Gärtli am Rhein, denn dort habe ich meine Ruhe und kann in Gedanken versinken.
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Die Schweiz braucht mehr Durchmischung.
Die Schweiz braucht weniger Stolz.
Wie wär's mal mit…
…Hallo sagen?

Vielen Dank Morris für den spannenden Einblick in sein kreatives Schaffen in Basel.
_
von Ana Brankovic
am 11.07.2022
Fotos
© Sina Sauro für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«I_LAND» Basel: Im Gespräch mit 11 Projekten auf dem Hafenareal
Der Verein «I_LAND» ist seit 2012 Trägerverein aller Zwischennutzungen auf der Promenade und auf ExEsso beim Hafen Basel und feiert im Juli 2022 sein 10 jähriges Bestehen. «Wie wär’s mal mit» hat seit 2021 seinen Vereinssitz am Hafen und ist somit auch Projekt. Hier stellen wir unsere Hafennachbar*innen und von «I_LAND» nach aussen vertretenen Projekte vor, denen wir Fragen gestellt haben.
Programm 1. & 2. Juli 2022 ︎
![]()
A. Marina Bar (2011, Caroline Rouine)
Nah am Wasser, schöne Sommertage und ein belebter Hafen. Das Wort Marine ist vom lateinischen Wort marinus, zum Meer gehörig, abgeleitet.
B. I_LAND (2012, Trägerverein)
“Wir sind seit 2012 der Trägerverein aller Zwischennutzungen auf der Promenade und auf ExEsso und koordinieren und organisieren die verschiedenen Projekte.”
C. Port Land (2012, Verein Betonfreunde beider Basel)
“Port Land ist ein Betonparadies, gebaut von Skateboarder*Innen für Skateboarder*Innen.”
D. Frame (2012, Dominik Ziliotis, Mat Branger)
“Wir gestalten soziale Freiräume für kollektive Entfaltung (Musik, Sport, Kochen, Kunst, Kultur etc.) und bauen eine mobile, offene zugängliche Open-Space Plattform als Begegnungsort der anderen Art.”
![]()
E. Landestelle (2013, Christian Lorenz, Simone Fuchs, Klaus Bernhard)
“Die LANDESTELLE ist ein Freiluft-Gastronomiebetrieb mit kulturellem Charme
direkt am Rhein, Feriengefühle sind inklusive. Die improvisierten Holzhütten
sind gezimmert aus recycelten Favelas – die Infrastruktur des Kunstwerks «Favela Café» Art Basel.”
F. Freisitz (2012, Willi Moch, Dino Gysin)
“Beste Zwischennutzung hat der Wagenplatz gesagt.“
G. Hafeschweissi (2013, Dino Gysin)
“Hier finden Workshops wie Veloflicken und Bienenhaus bauen statt, es werden aus alten Boilern Pizzaöfen oder Pflanztöpfe gebaut und kreative Auftragsarbeiten nach Mass gefertigt.“
![]()
H. Karawanserei (2015, Fabian Müller)
“Der Trägerverein Karawanserei ist ein Verein der Vereine, die in und um den Containerturm neben der Landestelle angesiedelt sind. Er ist seit 2015 am Hafen zuhause und wurde von einer Gruppe um Fabian Müller ins Leben gerufen.”
I. Trendsport (2016, Verein Trendsport Basel)
“Der Verein Trendsport Basel hat für die rollende Trendsportarten wie Skateboard, BMX, Scooter, Inline etc. im April 2016 ihr Zwischennutzungszelt im Hafen aufgestellt.“
J. Quarterdeck (2019, Michel Löffler)
“Das Quarterdeck ist eine Sommerbar am Hafen.”
K. FISK&ØL (2021, Christopher Duschl)
“Wir veredeln seid 2021 Schweizer Fisch auf nordische Art vor Ort am Hafen – und den kann man dann mit Blick auf die “Küste” geniessen. Dazu ein frisches nordisches Bier - skål!“
![]()
Weshalb zog es dich mit deinem Projekt zum Hafen?
A. Für mich ist das Klybeck eine Piraten-Insel. Es gibt Platz für Alle - das soll auch so bleiben.
B. Der Kanton Basel-Stadt und die Schweizerischen Rheinhäfen als unsere Vertragspartner auf dem Areal wünschen sich einen Ansprechpartner für alle Nutzungen. Diese Rolle übernimmt der Verein gegen aussen.
C. Der Do It Yourself Geist ist seit jeher Teil der Skateboard DNA und die Fläche auf der ExEsso Parzelle im Hafen war der ideale Standort für einen Neuanfang nach dem Ende des Blackcrossbowls auf dem nt Areal.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
D. Wir brauchten einen Ort, an dem wir uns frei entfalten und gemeinsam Musik, Video, Kunst, Sport, Kultur, etc. erschaffen können. Gleichzeitig wollen wir herausfinden und lernen, wie wir gemeinsam unsere eigene Infratruktur bauen, gestalten und unterhalten können.
E. Der zu Beginn durch die Hafenwirtschaft geprägte, grösstenteils leere Platz am Wasser mit Abendsonne, ist einer der schönsten der Stadt! Diesen mit unseren Ideen zu beleben und zu prägen war und ist grossartig.
F. Einen Gemeinschaftsgarten entstehen zu lassen für alle*.
G. Die Werkstatt entstand aus dem Freisitz heraus. Die Möglichkeiten die durch dies Umfeld geschaffen wurden, machten es zu einem wundervollen und inspirierendem Platz, um sich stets weiter zu entwickeln.
![]()
![]()
H. Der Containerturm der Karawanserei war ursprünglich eine Design-Arbeit des Architekten Otto Fröhlich. Als er nach einem schönen Platz dafür suchte, wurde er im Hafenareal fündig. Was für ein Glück!
I. Ein Standorte für unsere provisoriische Halle war sehr schwierig zu finden und da kam die Gelegenheit mit dem ExEsso perfekt gelegen.
J. Wir hatten die Möglichkeit ein bereits bestehendes Projekt (Sonnendeck) zu übernehmen. Dies taten wir gerne, um das Hafenareal, durch unsere langjährige Barerfahrung und das dadurch erlernte Wissen, mit feinen Cocktails zu bereichern. Das Quarterdeck bietet zudem einen perfekten Ausgleich zum kulturellen Mainstream.
K. Fisch und Wasser. Das ist wie “A auf Eimer” – das passt einfach!
![]()
Wenn die Persönlichkeit vom Hafengebiet ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
A. Shrimp.
B. Ein Oktopus. Sensibel, anpassungsfähig, intelligent und bedroht.
C. Der Kopf einer Schlange. Skaten ist selten geradlinig und beisst auch gerne mal.
D. Eine Krähe: clever, frei und manchmal etwas laut.
E. Eine Eidechse. Sie wird oft übersehen, aber wenn man genauer hinschaut, schimmert und glänzt sie im Sonnenlicht wie eine Discokugel.
F. Kakerlaken, hat man sie einmal, bekommt man sie fast nicht mehr los.
G. Hier wird fleissig gewerkt, repariert und gebaut - wie bei den Ameisen.
H. Ein Chamäleon, kein anderes Tier ist so vielfältig.
I. Eine Ratte, dieses Tier passt sich hier überall an.
J. Das Quarterdeck wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Eule. Da unsere Bar mit Einbruch der Dämmerung zu leben beginnt und wir durch unsere erhöhte Lage sowie dem 360’ Panorama eine nahezu perfekte Aussicht haben.
K. Oktopus, weil er mega wandelbar ist.
![]()
![]()
Rückblick! Die Entwicklung am Hafen damals – dazwischen und heute in drei treffenden Worten.
A. Hafen ahoi! – Sommer, Konzerte – Ausbau und weiter
B. Aufbrechen – schaffen – ernten
C. Gruppendynamik – Turbulezen – Jetzt
D. Familiär – Turbulent – Progressiv
E. Verhandeln – intensiv – eingespielt aber verträumt
F. Geil – Geiler – am Geilsten
G. Freiluft Werkstatt - Wellblechdach - Dachterrasse
H. Brachland - Farbexplosion - Leben
I. Unbekannt – bekannt – sehr bekannt
J. Entwicklung - Pandemie – Hoffnung
K. So lange sind wir noch gar nicht dabei.
![]()
Ausblick! Ergänze den Satz: Liebes Hafenareal, wie wär’s mal mit…
A. ...wieder Konzerten am Hafen?
B. …anständigen WC, die das ganze Jahr offen haben?
C. ...einem Besuch von Tony Hawk?
D. ...mobiler Architektur?
E. …einer Vereinnahmung der in der Ausschreibung 2011 versprochenen Wasserflächen mit selbstgezimmerten Inseln?
F. ...99 Luftballons?
G. ...einer Freiluft Ausstellung für Kreativschaffende?
H. ...noch 10 weiteren Jahren Wildwuchs?
I. ...einem Pumptrack?
J. ...einem gemeinsamen Strassenfest?
K. ...wieder mehr Veranstaltungen erlauben?
![]()
_
von Ana Brankovic
am 06.06.2022
Fotos
© Verein Wie wär’s mal mit, Simone Fuchs, Staatsarchiv Basel-Stadt und diverse I_LAND Projekte für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei den genannten Parteien einholen.
Der Verein «I_LAND» ist seit 2012 Trägerverein aller Zwischennutzungen auf der Promenade und auf ExEsso beim Hafen Basel und feiert im Juli 2022 sein 10 jähriges Bestehen. «Wie wär’s mal mit» hat seit 2021 seinen Vereinssitz am Hafen und ist somit auch Projekt. Hier stellen wir unsere Hafennachbar*innen und von «I_LAND» nach aussen vertretenen Projekte vor, denen wir Fragen gestellt haben.
Programm 1. & 2. Juli 2022 ︎

A. Marina Bar (2011, Caroline Rouine)
Nah am Wasser, schöne Sommertage und ein belebter Hafen. Das Wort Marine ist vom lateinischen Wort marinus, zum Meer gehörig, abgeleitet.
B. I_LAND (2012, Trägerverein)
“Wir sind seit 2012 der Trägerverein aller Zwischennutzungen auf der Promenade und auf ExEsso und koordinieren und organisieren die verschiedenen Projekte.”
C. Port Land (2012, Verein Betonfreunde beider Basel)
“Port Land ist ein Betonparadies, gebaut von Skateboarder*Innen für Skateboarder*Innen.”
D. Frame (2012, Dominik Ziliotis, Mat Branger)
“Wir gestalten soziale Freiräume für kollektive Entfaltung (Musik, Sport, Kochen, Kunst, Kultur etc.) und bauen eine mobile, offene zugängliche Open-Space Plattform als Begegnungsort der anderen Art.”
E. Landestelle (2013, Christian Lorenz, Simone Fuchs, Klaus Bernhard)
“Die LANDESTELLE ist ein Freiluft-Gastronomiebetrieb mit kulturellem Charme
direkt am Rhein, Feriengefühle sind inklusive. Die improvisierten Holzhütten
sind gezimmert aus recycelten Favelas – die Infrastruktur des Kunstwerks «Favela Café» Art Basel.”
F. Freisitz (2012, Willi Moch, Dino Gysin)
“Beste Zwischennutzung hat der Wagenplatz gesagt.“
G. Hafeschweissi (2013, Dino Gysin)
“Hier finden Workshops wie Veloflicken und Bienenhaus bauen statt, es werden aus alten Boilern Pizzaöfen oder Pflanztöpfe gebaut und kreative Auftragsarbeiten nach Mass gefertigt.“

H. Karawanserei (2015, Fabian Müller)
“Der Trägerverein Karawanserei ist ein Verein der Vereine, die in und um den Containerturm neben der Landestelle angesiedelt sind. Er ist seit 2015 am Hafen zuhause und wurde von einer Gruppe um Fabian Müller ins Leben gerufen.”
I. Trendsport (2016, Verein Trendsport Basel)
“Der Verein Trendsport Basel hat für die rollende Trendsportarten wie Skateboard, BMX, Scooter, Inline etc. im April 2016 ihr Zwischennutzungszelt im Hafen aufgestellt.“
J. Quarterdeck (2019, Michel Löffler)
“Das Quarterdeck ist eine Sommerbar am Hafen.”
K. FISK&ØL (2021, Christopher Duschl)
“Wir veredeln seid 2021 Schweizer Fisch auf nordische Art vor Ort am Hafen – und den kann man dann mit Blick auf die “Küste” geniessen. Dazu ein frisches nordisches Bier - skål!“

Weshalb zog es dich mit deinem Projekt zum Hafen?
A. Für mich ist das Klybeck eine Piraten-Insel. Es gibt Platz für Alle - das soll auch so bleiben.
B. Der Kanton Basel-Stadt und die Schweizerischen Rheinhäfen als unsere Vertragspartner auf dem Areal wünschen sich einen Ansprechpartner für alle Nutzungen. Diese Rolle übernimmt der Verein gegen aussen.
C. Der Do It Yourself Geist ist seit jeher Teil der Skateboard DNA und die Fläche auf der ExEsso Parzelle im Hafen war der ideale Standort für einen Neuanfang nach dem Ende des Blackcrossbowls auf dem nt Areal.






D. Wir brauchten einen Ort, an dem wir uns frei entfalten und gemeinsam Musik, Video, Kunst, Sport, Kultur, etc. erschaffen können. Gleichzeitig wollen wir herausfinden und lernen, wie wir gemeinsam unsere eigene Infratruktur bauen, gestalten und unterhalten können.
E. Der zu Beginn durch die Hafenwirtschaft geprägte, grösstenteils leere Platz am Wasser mit Abendsonne, ist einer der schönsten der Stadt! Diesen mit unseren Ideen zu beleben und zu prägen war und ist grossartig.
F. Einen Gemeinschaftsgarten entstehen zu lassen für alle*.
G. Die Werkstatt entstand aus dem Freisitz heraus. Die Möglichkeiten die durch dies Umfeld geschaffen wurden, machten es zu einem wundervollen und inspirierendem Platz, um sich stets weiter zu entwickeln.


H. Der Containerturm der Karawanserei war ursprünglich eine Design-Arbeit des Architekten Otto Fröhlich. Als er nach einem schönen Platz dafür suchte, wurde er im Hafenareal fündig. Was für ein Glück!
I. Ein Standorte für unsere provisoriische Halle war sehr schwierig zu finden und da kam die Gelegenheit mit dem ExEsso perfekt gelegen.
J. Wir hatten die Möglichkeit ein bereits bestehendes Projekt (Sonnendeck) zu übernehmen. Dies taten wir gerne, um das Hafenareal, durch unsere langjährige Barerfahrung und das dadurch erlernte Wissen, mit feinen Cocktails zu bereichern. Das Quarterdeck bietet zudem einen perfekten Ausgleich zum kulturellen Mainstream.
K. Fisch und Wasser. Das ist wie “A auf Eimer” – das passt einfach!

Wenn die Persönlichkeit vom Hafengebiet ein Tier wäre, welches wäre es und weshalb?
A. Shrimp.
B. Ein Oktopus. Sensibel, anpassungsfähig, intelligent und bedroht.
C. Der Kopf einer Schlange. Skaten ist selten geradlinig und beisst auch gerne mal.
D. Eine Krähe: clever, frei und manchmal etwas laut.
E. Eine Eidechse. Sie wird oft übersehen, aber wenn man genauer hinschaut, schimmert und glänzt sie im Sonnenlicht wie eine Discokugel.
F. Kakerlaken, hat man sie einmal, bekommt man sie fast nicht mehr los.
G. Hier wird fleissig gewerkt, repariert und gebaut - wie bei den Ameisen.
H. Ein Chamäleon, kein anderes Tier ist so vielfältig.
I. Eine Ratte, dieses Tier passt sich hier überall an.
J. Das Quarterdeck wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Eule. Da unsere Bar mit Einbruch der Dämmerung zu leben beginnt und wir durch unsere erhöhte Lage sowie dem 360’ Panorama eine nahezu perfekte Aussicht haben.
K. Oktopus, weil er mega wandelbar ist.


Rückblick! Die Entwicklung am Hafen damals – dazwischen und heute in drei treffenden Worten.
A. Hafen ahoi! – Sommer, Konzerte – Ausbau und weiter
B. Aufbrechen – schaffen – ernten
C. Gruppendynamik – Turbulezen – Jetzt
D. Familiär – Turbulent – Progressiv
E. Verhandeln – intensiv – eingespielt aber verträumt
F. Geil – Geiler – am Geilsten
G. Freiluft Werkstatt - Wellblechdach - Dachterrasse
H. Brachland - Farbexplosion - Leben
I. Unbekannt – bekannt – sehr bekannt
J. Entwicklung - Pandemie – Hoffnung
K. So lange sind wir noch gar nicht dabei.

Ausblick! Ergänze den Satz: Liebes Hafenareal, wie wär’s mal mit…
A. ...wieder Konzerten am Hafen?
B. …anständigen WC, die das ganze Jahr offen haben?
C. ...einem Besuch von Tony Hawk?
D. ...mobiler Architektur?
E. …einer Vereinnahmung der in der Ausschreibung 2011 versprochenen Wasserflächen mit selbstgezimmerten Inseln?
F. ...99 Luftballons?
G. ...einer Freiluft Ausstellung für Kreativschaffende?
H. ...noch 10 weiteren Jahren Wildwuchs?
I. ...einem Pumptrack?
J. ...einem gemeinsamen Strassenfest?
K. ...wieder mehr Veranstaltungen erlauben?
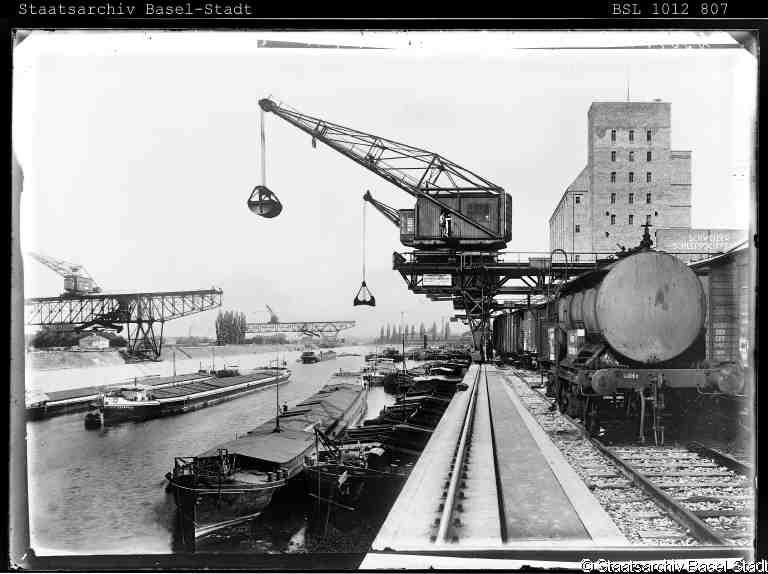
_
von Ana Brankovic
am 06.06.2022
Fotos
© Verein Wie wär’s mal mit, Simone Fuchs, Staatsarchiv Basel-Stadt und diverse I_LAND Projekte für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei den genannten Parteien einholen.
«Living Library»: Im Gespräch mit Emanuel Brito
Eine Bibliothek aus Büchern, die jedoch echte Menschen und ihre Geschichten sind. Bei «Living Library» sitzen Menschen gemeinsam auf Augenhöhe an einem Tisch und lassen sich lesen bzw. erzählen ihre persönliche Geschichte. Wir trafen Emanuel Brito, Mitwirkender bei «Living Library» und Mitglied beim «Verein AfroBasel» in seiner Mittagspause im Gottfried-Keller Schulhaus. Was uns Emanuel über sein Herzensprojekt zu erzählen hat, erfahrt ihr im Gespräch.
![]()
Lieber Emanuel, Bücher sind eine schöne Sache, schöne Begegnungspunkte. Du unterrichtest am Gottfried-Keller Schulhaus. Wie kamst Du zu deinem Beruf?
Ich selbst war nicht gerne Schüler. Mein beruflicher Werdegang als Lehrer hat sich deshalb relativ spät herauskristallisiert. Ich habe eine Aufnahmeprüfung an der FH gemacht undstudiert. Heute unterrichte ich Schüler*innen zwischen 8 und 12 Jahren, begleite sie also von der 4. bis zur 6. Klasse als Klassenlehrer in den Fächern Geschichte, Bio, Geo sowie Deutsch, Englisch, Französisch und Sport. In einer weiteren Klasse unterrichte ich als Fachlehrer Mathematik. Auch habe ich ein ganz eigenes Verständnis für das Klassenleben, für das Schüler*innen-Sein, unter anderem auch durch meinen Migrationshintergrund. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite, sondern eher, dass ich etwas mache, mit dem ich mich identifizieren kann und wo ich mit Herzblut dabei bin.
Was schätzt du an deinem Beruf?
Ich kann Bezugsperson für die Schüler*innen sein. also jemand, der sie ein Stück ihres Weges begleitet. Wir haben immer eine gemeinsame Verbindung. Mit meiner persönlichen Geschichte kann ich mit den Schüler*innen conntecten, weil ich mich mit ihrer Situation im jungen Alter und im eigenen Zuhause identifizieren kann. Dieses Eingehen einer menschlichen Verbindung schätze ich sehr an meinem Beruf.
![]()
Was ist deine eigene Migrationsgeschichte?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen und ging auch immer wieder mit meinen Eltern und Geschwistern auf die Kapverdischen Inseln. Auf den Kapverden spricht man Portugiesisch bzw. Kreolisch, das ist ein Dialekt. Mir ist wichtig, beides zu schätzen: die Kultur, die wir hier in der Schweiz erfahren haben, aber auch diejenige, die wir mitgebracht haben.
Wie sieht dein Alltag als «Migrationskind» als Lehrer im Klassenzimmer aus?
Meine Mehrsprachigkeit spielt eine wichtige Rolle. Beim Vermitteln von Inhalten an der Schule ist diese eine Stärke. Ich trete in den Klassenraum und unterrichte Deutsch, Englisch, Französisch aber auch andere Sprachen werden mit einbezogen. Wir benutzen auch Türkisch und Albanisch, um Deutsche Grammatik zu verstehen. Ich frage meine Schüler*innen, wieviel Sprachen sie sprechen. Dazu zählen auch Geheimsprachen oder ein Nachmittag, an dem sie Griechisch oder Arabisch lernen. Auch die Lehrmittel haben Fortschritte gemacht, indem sie Sprachvergleiche integrieren und man vermitteln kann, wie etwas in der eigenen Muttersprache ausgedrückt wird. Da fühle ich die Klasse sehr und ebenso einen Selbstwert für meinen eigenen Migrationshintergrund. Nur schon, wenn du Kindern Hallo in ihrer Sprache wiedergibst, ist ihre Reaktion unbeschreiblich. In dem Moment realisieren sie auch, dass ihr Hintergrund, ihre Sprache wichtig und auch interessant ist für die Schule. Es zählt nicht nur Deutsch, das hat auch die Vermittlung mittlerweile begriffen. Tolle Kinderbücher gibt es auch von arabischen oder afrikanischen Schriftsteller*innen. Das ganze ist inklusiv, weil auch das Interesse von Kindern mit Schweizer Muttersprache geweckt wird, sich für andere Sprachen zu interessieren.
![]()
Ziehst du dein Projekt «Living Library» mit in deinen Unterricht ein?
Wenn ich eine ältere Klasse hätte, würde ich es machen. In der Primarstufe mache ich dies lediglich auf einer philosophischen Ebene, etwa, dass wir über Stereotypen diskutieren. Wer hat welchen Beruf? Wie sieht die Person aus? Wem schreibt ihr welchen Beruf zu? Also Beurteilung nach Äusserlichkeiten. Ich erzähle auch von meinen eigenen Erfahrungen als Mensch mit Migrationshintergrund. Das schafft eine Verbindung zum Motto von «Living Library»: Don‘t judge a book by its cover, talk to it! Man ist nicht alleine mit dem Gefühl, dass man «gejudged» (Deutsch: verurteilt) wird. Nicht immer werde ich als Lehrer angesehen. Das ist auch ein Gefühl, das man aushalten muss. Nicht jede Person versteht das.
Wenn es eine Form der Weiterbildung gäbe, interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln, wie würde ein solches Format aussehen?
Wie folgt: Ich habe einen Koffer mit Büchern dabei, die diese Thematik behandeln sowie Anschauungsmaterial. Bei Radio X konnte ich einen Beitrag zu «Living Library» leisten, davon zeige ich dann Ausschnitte. Ich erzähle von meinen eigenen Erfahrungen. Ich bringe Menschen das «SAMSProjekt» (Ausstellung zur Mehrsprachigkeit der Schweiz) näher oder gebe Tipps, wie sich die Thematik innerhalb des Unterrichts und eigenen Alltags integrieren lässt.
![]()
Wo findet sich der Zündmoment vom Projekt «Living Library»? Waren dies die Black Live Matter Demonstrationen?
Die Geschichte von George Floyd ist der Moment, in welchem dieses Echo losgetreten worden ist. Für mich persönlich war es die Black Lives Matter Demonstration in Basel am 6. Juni 2020. Die Situation des Stillschweigens habe ich oft persönlich erlebt. Diese Demo traf den Nerv der Jugendlichen und man hat den Mut gespürt, Position zu beziehen. Ich war selbst lange genug still, und dieses Ereignis hat mein Feuer geweckt. Ich habe realisiert, dass ich diesen Mut und die Teilnahme an dieser Community brauche, in meiner eigenen Form, in meinem eigenen Format. So kann ich auch als Lehrer zum Thema beitragen. Afro Jugendliche mit einem natürlichen Stolz, stolz auf ihren Look, auf ihre Attitüde. Diese laute Stimme der Afro Jugendlichen ist noch nicht vorbei, sie ist nachhaltig, sie ist geblieben. Daraus hat sich für mich persönlich der Gedanke der «Living Library» ergeben. Ich wollte etwas Nachhaltiges schaffen, das über einen Hashtag hinausgeht.
Durch meinen Beruf als Lehrer hat sich auch ergeben, dass ich ein Format an der Schule vermitteln kann, das sich sowohl an Jugendliche wie auch Vermittelnde richtet. Ich konnte auch schon an der Fachhochschule im Rahmen eines Workshops «Living Library» vorstellen. Was mich auch sehr bestärkt, sind Anfragen von der Polizei oder Finanzunternehmen wie etwa UBS, die Interesse am Format bekunden und versuchen dafür Platz zu schaffen. Das Zentrale an «Living Library» ist das Fernab von Theorie oder Geschichte. Es geht um jeden Einzelnen als Buch, um eigene, persönliche Geschichten und den alltäglichen Umgang mit Formen von Diskriminierung. Das Relativieren, dieses «Nei, isch doch nid so schlimm», diese Art von Tischgespräch auf Augenhöhe gibt auch dem Buch, dem Mensch, den Wert, eben nicht zu verdrängen und das Gefühl seitens Leserschaft das Individuum und seine Geschichte anzunehmen, wahrzunehmen, ohne zu be- oder verurteilen.
![]()
Erzähl von dem ersten Event «Living Library»?
Ich habe sieben «Bücher», sieben Menschen und ihre Geschichten vorgestellt. Geschichten, die allesamt mit Rassismus oder Formen der Diskriminierung in ihrem Alltag Erfahrungen gemacht haben und diese Erfahrung auch teilen möchten. Wir sind ja immer noch Individuum mit eigener Hemm-Grenze, nicht alle möchten sich auch derart entblössen. Aber es kann helfen zu reden. Es kann auch helfen, nicht im eigenen Freundeskreis zu reden und diese Erfahrung öffentlich in einem geschützten Rahmen mit verschiedenen Menschen zu teilen. Es gab auch für mich einen Moment, in dem ich mir sagen konnte, das, was ich erlebt hatte, das war nicht okay. Rassimus ist nicht Teil des Lebens bzw. sollte nicht so sein. Es gibt bei « Living Library» immer Editorials als Einführung zu jedem «Buch», die vorne am Eingang platziert werden. Ich war nicht sicher, ob dieses Format im KLARA Anklang finden würde und war vorbereitet frühzeitig den Abend zu schliessen. Jedoch war das Gegenteil der Fall, die Gespräche hätten bei weitem noch viel länger weitergeführt werden können als unsere Öffnungszeiten waren. Neben der «Living Library» gibt’s immer auch eine echte Bibliothek. Ich arbeite hierfür mit dem Verlag «Baobab Books» zusammen. Sie fördern vor allem Autor*innen aus Entwicklungsländern und haben Bücher, die interkulturelle Kompetenzen ansprechen. Es gibt also auch Bücher für Jugendliche, in denen Superheld*innen Schwarz oder eine Prinzessin von einer Prinzessin geküsst wird. Man kann entweder in Büchern des Verlages stöbern oder an den Tischen an Gesprächen mit Menschen teilnehmen. Es ist ein Augenblick, in dem du dich vielleicht traust unbequeme Fragen zu stellen, weil das erlaubt ist. Fragen, die du immer schon mal stellen wolltest, aber deinen Freund*innen nicht zumuten willst. Das Schöne: Es ist keine traurige Stimmung am Event, eine nachdenkliche, ja. Dadurch, dass die Gespräche auf Augenhöhe stattfinden, ist es immer eine Erzählung von Mensch zu Mensch und von dem, was sie zu diesem starken Mensch heute gemacht hat.
![]()
Keine Paneldiskussion, sondern Safe Space auf Augenhöhe. Wie hast du die «Bücher» am ersten «Living Library» ausgewählt?
Gäste wie die LGBTQ-Autorin Anna Rosenwasser, der Rapper und Musiker Black Tiger, Stand-up-Comedian Leila Ladari oder Merita Shabani von «BabaNews» mit einem Stand. Auch durch den «Verein Afro Basel», bei dem ich selber Mitglied bin, habe ich tolle Menschen getroffen, die teils zu meinem Freundeskreis gehören, hinter dem Projekt stehen und sich auch als Buch zur Verfügung gestellt haben. Der erste Event setzte sich mit Rassismus und Diskriminierung im Alltag auseinander. Egal, ob ich diskriminiert werde wegen meinem religiösen Hintergrund, meiner sexuellen Orientierung oder meiner Hautfarbe. Es geht nicht darum, dass eine Polizeigewalt einen Schwarzen misshandelt oder um Krieg, sondern es geht, um den eigenen Alltag. Im Übrigen: bevor ich mich dem Projekt gewidmet habe, musste ich auch mit mir selbst klarkommen, mich selbst fragen, welches sind meine eigenen Stereotypes? Auch ich bin trotz meiner Geschichte nicht befreit von Stereotypen. Das Projekt ist also auch Bewusstseinserweiterung für mich Selbst. «Living Library» heisst, versuchen unvoreingenommen mit offenem Ohr und Herzen zuzuhören. Natürlich kann es auch eine therapeutische Form annehmen, die Wunden heilen kann. Ich bin sehr daran interessiert das Format als Event oder als Weiterbildungsmöglichkeit auszubauen, mein Wissen austauschen, zu vernetzen und zu diesem Echo beizutragen.
![]()
Wie wär’s mal mit…
...einer Zusammenarbeit zwischen «Living Library» und dem «Verein Wie wär’s mal mit» oder einfach mit offenem Herz einander zuhören?
Vielen Dank für das Gespräch Emanuel. Emanuel Brito unterrichtet am am Gottfried-Keller Schulhaus und hat eine Arbeit über interkulturelle Kompetenzen geschrieben vor dem Aspekt einer Lehrperson mit Migrationshintergrund. Hier ist «Living Library» sonst noch ein Thema: Wanderausstellung «Mensch, Du hast Rechte!», Podcast bei Radio X, Verein AfroBasel oder BabaNews.
_
von Shirin Zaid
am 20.06.2022
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Lieber Emanuel, Bücher sind eine schöne Sache, schöne Begegnungspunkte. Du unterrichtest am Gottfried-Keller Schulhaus. Wie kamst Du zu deinem Beruf?
Ich selbst war nicht gerne Schüler. Mein beruflicher Werdegang als Lehrer hat sich deshalb relativ spät herauskristallisiert. Ich habe eine Aufnahmeprüfung an der FH gemacht undstudiert. Heute unterrichte ich Schüler*innen zwischen 8 und 12 Jahren, begleite sie also von der 4. bis zur 6. Klasse als Klassenlehrer in den Fächern Geschichte, Bio, Geo sowie Deutsch, Englisch, Französisch und Sport. In einer weiteren Klasse unterrichte ich als Fachlehrer Mathematik. Auch habe ich ein ganz eigenes Verständnis für das Klassenleben, für das Schüler*innen-Sein, unter anderem auch durch meinen Migrationshintergrund. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite, sondern eher, dass ich etwas mache, mit dem ich mich identifizieren kann und wo ich mit Herzblut dabei bin.
Was schätzt du an deinem Beruf?
Ich kann Bezugsperson für die Schüler*innen sein. also jemand, der sie ein Stück ihres Weges begleitet. Wir haben immer eine gemeinsame Verbindung. Mit meiner persönlichen Geschichte kann ich mit den Schüler*innen conntecten, weil ich mich mit ihrer Situation im jungen Alter und im eigenen Zuhause identifizieren kann. Dieses Eingehen einer menschlichen Verbindung schätze ich sehr an meinem Beruf.
Was ist deine eigene Migrationsgeschichte?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen und ging auch immer wieder mit meinen Eltern und Geschwistern auf die Kapverdischen Inseln. Auf den Kapverden spricht man Portugiesisch bzw. Kreolisch, das ist ein Dialekt. Mir ist wichtig, beides zu schätzen: die Kultur, die wir hier in der Schweiz erfahren haben, aber auch diejenige, die wir mitgebracht haben.
Wie sieht dein Alltag als «Migrationskind» als Lehrer im Klassenzimmer aus?
Meine Mehrsprachigkeit spielt eine wichtige Rolle. Beim Vermitteln von Inhalten an der Schule ist diese eine Stärke. Ich trete in den Klassenraum und unterrichte Deutsch, Englisch, Französisch aber auch andere Sprachen werden mit einbezogen. Wir benutzen auch Türkisch und Albanisch, um Deutsche Grammatik zu verstehen. Ich frage meine Schüler*innen, wieviel Sprachen sie sprechen. Dazu zählen auch Geheimsprachen oder ein Nachmittag, an dem sie Griechisch oder Arabisch lernen. Auch die Lehrmittel haben Fortschritte gemacht, indem sie Sprachvergleiche integrieren und man vermitteln kann, wie etwas in der eigenen Muttersprache ausgedrückt wird. Da fühle ich die Klasse sehr und ebenso einen Selbstwert für meinen eigenen Migrationshintergrund. Nur schon, wenn du Kindern Hallo in ihrer Sprache wiedergibst, ist ihre Reaktion unbeschreiblich. In dem Moment realisieren sie auch, dass ihr Hintergrund, ihre Sprache wichtig und auch interessant ist für die Schule. Es zählt nicht nur Deutsch, das hat auch die Vermittlung mittlerweile begriffen. Tolle Kinderbücher gibt es auch von arabischen oder afrikanischen Schriftsteller*innen. Das ganze ist inklusiv, weil auch das Interesse von Kindern mit Schweizer Muttersprache geweckt wird, sich für andere Sprachen zu interessieren.
Ziehst du dein Projekt «Living Library» mit in deinen Unterricht ein?
Wenn ich eine ältere Klasse hätte, würde ich es machen. In der Primarstufe mache ich dies lediglich auf einer philosophischen Ebene, etwa, dass wir über Stereotypen diskutieren. Wer hat welchen Beruf? Wie sieht die Person aus? Wem schreibt ihr welchen Beruf zu? Also Beurteilung nach Äusserlichkeiten. Ich erzähle auch von meinen eigenen Erfahrungen als Mensch mit Migrationshintergrund. Das schafft eine Verbindung zum Motto von «Living Library»: Don‘t judge a book by its cover, talk to it! Man ist nicht alleine mit dem Gefühl, dass man «gejudged» (Deutsch: verurteilt) wird. Nicht immer werde ich als Lehrer angesehen. Das ist auch ein Gefühl, das man aushalten muss. Nicht jede Person versteht das.
Wenn es eine Form der Weiterbildung gäbe, interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln, wie würde ein solches Format aussehen?
Wie folgt: Ich habe einen Koffer mit Büchern dabei, die diese Thematik behandeln sowie Anschauungsmaterial. Bei Radio X konnte ich einen Beitrag zu «Living Library» leisten, davon zeige ich dann Ausschnitte. Ich erzähle von meinen eigenen Erfahrungen. Ich bringe Menschen das «SAMSProjekt» (Ausstellung zur Mehrsprachigkeit der Schweiz) näher oder gebe Tipps, wie sich die Thematik innerhalb des Unterrichts und eigenen Alltags integrieren lässt.
Wo findet sich der Zündmoment vom Projekt «Living Library»? Waren dies die Black Live Matter Demonstrationen?
Die Geschichte von George Floyd ist der Moment, in welchem dieses Echo losgetreten worden ist. Für mich persönlich war es die Black Lives Matter Demonstration in Basel am 6. Juni 2020. Die Situation des Stillschweigens habe ich oft persönlich erlebt. Diese Demo traf den Nerv der Jugendlichen und man hat den Mut gespürt, Position zu beziehen. Ich war selbst lange genug still, und dieses Ereignis hat mein Feuer geweckt. Ich habe realisiert, dass ich diesen Mut und die Teilnahme an dieser Community brauche, in meiner eigenen Form, in meinem eigenen Format. So kann ich auch als Lehrer zum Thema beitragen. Afro Jugendliche mit einem natürlichen Stolz, stolz auf ihren Look, auf ihre Attitüde. Diese laute Stimme der Afro Jugendlichen ist noch nicht vorbei, sie ist nachhaltig, sie ist geblieben. Daraus hat sich für mich persönlich der Gedanke der «Living Library» ergeben. Ich wollte etwas Nachhaltiges schaffen, das über einen Hashtag hinausgeht.
Durch meinen Beruf als Lehrer hat sich auch ergeben, dass ich ein Format an der Schule vermitteln kann, das sich sowohl an Jugendliche wie auch Vermittelnde richtet. Ich konnte auch schon an der Fachhochschule im Rahmen eines Workshops «Living Library» vorstellen. Was mich auch sehr bestärkt, sind Anfragen von der Polizei oder Finanzunternehmen wie etwa UBS, die Interesse am Format bekunden und versuchen dafür Platz zu schaffen. Das Zentrale an «Living Library» ist das Fernab von Theorie oder Geschichte. Es geht um jeden Einzelnen als Buch, um eigene, persönliche Geschichten und den alltäglichen Umgang mit Formen von Diskriminierung. Das Relativieren, dieses «Nei, isch doch nid so schlimm», diese Art von Tischgespräch auf Augenhöhe gibt auch dem Buch, dem Mensch, den Wert, eben nicht zu verdrängen und das Gefühl seitens Leserschaft das Individuum und seine Geschichte anzunehmen, wahrzunehmen, ohne zu be- oder verurteilen.
Erzähl von dem ersten Event «Living Library»?
Ich habe sieben «Bücher», sieben Menschen und ihre Geschichten vorgestellt. Geschichten, die allesamt mit Rassismus oder Formen der Diskriminierung in ihrem Alltag Erfahrungen gemacht haben und diese Erfahrung auch teilen möchten. Wir sind ja immer noch Individuum mit eigener Hemm-Grenze, nicht alle möchten sich auch derart entblössen. Aber es kann helfen zu reden. Es kann auch helfen, nicht im eigenen Freundeskreis zu reden und diese Erfahrung öffentlich in einem geschützten Rahmen mit verschiedenen Menschen zu teilen. Es gab auch für mich einen Moment, in dem ich mir sagen konnte, das, was ich erlebt hatte, das war nicht okay. Rassimus ist nicht Teil des Lebens bzw. sollte nicht so sein. Es gibt bei « Living Library» immer Editorials als Einführung zu jedem «Buch», die vorne am Eingang platziert werden. Ich war nicht sicher, ob dieses Format im KLARA Anklang finden würde und war vorbereitet frühzeitig den Abend zu schliessen. Jedoch war das Gegenteil der Fall, die Gespräche hätten bei weitem noch viel länger weitergeführt werden können als unsere Öffnungszeiten waren. Neben der «Living Library» gibt’s immer auch eine echte Bibliothek. Ich arbeite hierfür mit dem Verlag «Baobab Books» zusammen. Sie fördern vor allem Autor*innen aus Entwicklungsländern und haben Bücher, die interkulturelle Kompetenzen ansprechen. Es gibt also auch Bücher für Jugendliche, in denen Superheld*innen Schwarz oder eine Prinzessin von einer Prinzessin geküsst wird. Man kann entweder in Büchern des Verlages stöbern oder an den Tischen an Gesprächen mit Menschen teilnehmen. Es ist ein Augenblick, in dem du dich vielleicht traust unbequeme Fragen zu stellen, weil das erlaubt ist. Fragen, die du immer schon mal stellen wolltest, aber deinen Freund*innen nicht zumuten willst. Das Schöne: Es ist keine traurige Stimmung am Event, eine nachdenkliche, ja. Dadurch, dass die Gespräche auf Augenhöhe stattfinden, ist es immer eine Erzählung von Mensch zu Mensch und von dem, was sie zu diesem starken Mensch heute gemacht hat.
Keine Paneldiskussion, sondern Safe Space auf Augenhöhe. Wie hast du die «Bücher» am ersten «Living Library» ausgewählt?
Gäste wie die LGBTQ-Autorin Anna Rosenwasser, der Rapper und Musiker Black Tiger, Stand-up-Comedian Leila Ladari oder Merita Shabani von «BabaNews» mit einem Stand. Auch durch den «Verein Afro Basel», bei dem ich selber Mitglied bin, habe ich tolle Menschen getroffen, die teils zu meinem Freundeskreis gehören, hinter dem Projekt stehen und sich auch als Buch zur Verfügung gestellt haben. Der erste Event setzte sich mit Rassismus und Diskriminierung im Alltag auseinander. Egal, ob ich diskriminiert werde wegen meinem religiösen Hintergrund, meiner sexuellen Orientierung oder meiner Hautfarbe. Es geht nicht darum, dass eine Polizeigewalt einen Schwarzen misshandelt oder um Krieg, sondern es geht, um den eigenen Alltag. Im Übrigen: bevor ich mich dem Projekt gewidmet habe, musste ich auch mit mir selbst klarkommen, mich selbst fragen, welches sind meine eigenen Stereotypes? Auch ich bin trotz meiner Geschichte nicht befreit von Stereotypen. Das Projekt ist also auch Bewusstseinserweiterung für mich Selbst. «Living Library» heisst, versuchen unvoreingenommen mit offenem Ohr und Herzen zuzuhören. Natürlich kann es auch eine therapeutische Form annehmen, die Wunden heilen kann. Ich bin sehr daran interessiert das Format als Event oder als Weiterbildungsmöglichkeit auszubauen, mein Wissen austauschen, zu vernetzen und zu diesem Echo beizutragen.
Wie wär’s mal mit…
...einer Zusammenarbeit zwischen «Living Library» und dem «Verein Wie wär’s mal mit» oder einfach mit offenem Herz einander zuhören?
Vielen Dank für das Gespräch Emanuel. Emanuel Brito unterrichtet am am Gottfried-Keller Schulhaus und hat eine Arbeit über interkulturelle Kompetenzen geschrieben vor dem Aspekt einer Lehrperson mit Migrationshintergrund. Hier ist «Living Library» sonst noch ein Thema: Wanderausstellung «Mensch, Du hast Rechte!», Podcast bei Radio X, Verein AfroBasel oder BabaNews.
_
von Shirin Zaid
am 20.06.2022
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Matt & Elly» Basel: Im Gespräch mit Denise Furter und Jarin Huber
Das «Matt & Elly» beim Bâleo Erlenmatt in Basel wird von Denise Furter und Jarin Huber betrieben, die sich 2010 beim gemeinsamen Arbeiten bei der Krafft Gruppe kennengelernt haben. Der gelernte Koch und die Hotelmanagerin beschlossen 2017 gemeinsame Sache zu machen – was «Matt & Elly» ist und weshalb sie den Schritt gewagt haben? Das erzählen uns die beiden im Gespräch.
![]()
Liebe Denise, Lieber Jarin, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Jarin: Ich bin Jarin, 38 Jahre alt, bin aus dem Baselbiet und wohne seit knapp 20 Jahren in Basel. Meine Mutter ist Halb-Schweizerin/Halb-Deutsche und hat über 10 Jahre der Gastronomie gewidmet. Mein Vater ist Basler und aus der Finanzbranche. Meine Rastlosigkeit macht es mir manchmal schwierig, mich zu distanzieren und abzuschalten. Das würde ich wohl als meine grösste Macke, aber auch als eine meiner Stärken bezeichnen.
![]()
Denise: Ich bin Denise, 36 Jahre alt, bin aus dem Aargau und wohne seit 13 Jahren in Basel. Hier bin ich zuhause. Die Familie meiner Mutter ist aus Graubünden. Sie haben da zwei Beizen geführt; unter anderem das «Alperösli» oberhalb von Klosters. Mein Vater ist ebenfalls Schweizer und nutzt sein pensioniertes Leben, um Wasserwerke zu betreuen und die Schweiz zu Fuss oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Dass ich immer denke, «voll easy, das kann ich locker machen, weils mir noch Spass machen würde», und dann merke, dass ich wieder einmal voll im Seich bin, das passiert noch immer. Dann frage ich mich, ob es etwas Gutes ist oder ob ich endlich lernen sollte, dass ich auch Grenzen habe?
![]()
Was ist «Matt & Elly» und wie kam es zur Gründung?
Denise: «Matt & Elly» Brewery & Kitchen ist ein Restaurant, eine Brauerei und eine Craft Beer Bar. Ein Ort an dem Lokales und Lokale zusammenkommen, zum Geniessen und gemütlichen Beisammensein, um etwas Neues zu erleben oder sich mit einer neuen Person auszutauschen. «Matt & Elly» ist aber auch eine Brand. Eine Brand, bei der alles möglich ist und sein kann. Wer uns kennt weiss, dass wir auch Kunstausstellungen zeigen und einen kleinen Concept Store haben mit Produkten von lokalen Designer*innen und Anbieter*innen, Merchandising oder Hausgemachtem aus unserer Küche.
![]()
Jarin schrieb damals für seinen Arbeitgeber einen Businessplan, wie man den Betrieb weiterentwickeln könnte. Seine Idee kam nicht in die nächste Runde, weshalb ich ihm sagte, na, dann mach’s doch selbst! Jarin meinte, also gut, aber ich mach’ das sicher nicht allein, wenn, dann bist du mit dabei! Wir liessen das beide einmal sacken und gingen zuerst auf Reisen. Vor allem die Westküste der USA hat uns dabei sehr inspiriert. Die Brauereien, aber auch das Essen, das aus den Zutaten gekocht wurde, die in der Gegend verfügbar waren, hat uns begeistert. Speisekarten gab es oft nicht oder waren nicht aktuell, weils schon neue Produkte gab. Essen mit Craft Beer zu kombinieren, wie man das mit Wein selbstverständlich macht, hat uns voll begeistert und wir dachten, das fehlt noch in Basel!
![]()
«Matt & Elly» – weshalb der Name?
Wir wussten von Anfang an, dass wir einen starken Namen wollen. Einen, der unsere Inspiration beschreibt und den Menschen schon vor dem Entstehen der Brewery & Kitchen, beschreiben kann, wie sich dieser Ort anfühlen wird, was er ausstrahlt, wer dahin kommen möchte. Für uns war wichtig, dass wir ein kreatives Team von Anfang an mit im Boot haben, weshalb wir Zoe Neumayr von «cleo» angefragt haben. Sie hat uns mit unserer Grafikerin, Künstlerin und mittlerweile guter Freundin, Patrizia Stalder und unserem Innenarchitekten, Gabriel Heusser, zusammengebracht. In diesem Team haben wir den Namen erarbeitet und mit der Story von «Matt & Elly» begonnen; zwei Reisende, die sich in Basel kennen gelernt und sich in die Stadt und ineinander verliebt haben. Gemeinsam haben sie beschlossen, ihre Ideen und Inspirationen mit den Menschen in Basel zu teilen. In der «Matt & Elly» Brewery & Kitchen.
![]()
Was habt ihr vor «Matt & Elly» gemacht?
Jarin hat die Lehre als Koch gemacht, hat als Barkeeper, Geschäftsführer gearbeitet in Basel. Denise hat Hotelmanagement studiert und hat bis auf ein, zwei Jahre in denen sie im Marketing und im Verkauf gearbeitet hat, in der Hotellerie gearbeitet als Receptionistin, Receptionsleiterin und Direktorin.
![]()
Eine «Matt & Elly» Weisheit an unsere Leser*innen?
Bei allem was wir schaffen, setzen wir auf Qualität; beim Kochen, beim Brauen, beim Umgang mit Menschen – Mitarbeiter*innen, Gästen, Lieferant*innen, Partner*innen und miteinander – und beim Entscheiden von Alltäglichem oder Strategischem. Natürlich ist das auch anstrengend, aber nur so macht unser Schaffen für uns Sinn!
![]()
![]()
Wie klingt Matt & Elly?
«Matt & Elly» Playlist «Day 1» von Alma Negra. Diego und Dersu haben sechs ‘World Music’ Playlists für uns gemacht, bevor wir eröffnet haben, einfach aufgrund unserer Beschreibung vom Ort und von dem, was wir möchten, dass die Menschen fühlen. Wir nutzen sie noch immer, vor allem die «Day 1».
Wo in Basel treibt ihr euch persönlich am liebsten herum?
Im Herz – wir lieben ihre Cocktails. Im Sommer im «FISK&ØL» am Hafen. Neu auch auf unserer Terrasse, wir sind grad umgezogen und bei unseren Freund*innen im Garten, die gerade in ein Haus gezogen sind.
![]()
Was ist eure absolute Spezialität?
«Matt & Elly» ist immer ein Erlebnis, eine Entdeckung. Entweder geniesst du neue Speisen, neue Craft Beer Sorten, neue Kunst an den Wänden, neue Kleider und Accessoires im Concept Store oder neue Events mit neuen Künstler:innen. Wir wechseln ca. all 2 – 3 Wochen einzelne Gerichte, deren Zutaten nicht mehr saisonal verfügbar sind.
Wenn es etwas statt Regen vom Himmel regnen könnte, was wäre das?
Schöne Kleidung.
![]()
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Mehr Offenheit; füreinander, für Neues, für sich selbst. Weniger Drang zur Sicherheit.
Wie wär's mal mit...
...Ana Brankovic ins «Matt & Elly» einladen? Mit ihr macht’s drum sehr viel Spass – und ihr schmeckt’s sehr! (Lacht)
![]()
Vielen Dank an Denise, Jarin und das tolle Team für einen tollen Abend mit grandiosem Essen. Wir kommen bestimmt wieder!
_
von Ana Brankovic
am 06.06.2022
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Das «Matt & Elly» beim Bâleo Erlenmatt in Basel wird von Denise Furter und Jarin Huber betrieben, die sich 2010 beim gemeinsamen Arbeiten bei der Krafft Gruppe kennengelernt haben. Der gelernte Koch und die Hotelmanagerin beschlossen 2017 gemeinsame Sache zu machen – was «Matt & Elly» ist und weshalb sie den Schritt gewagt haben? Das erzählen uns die beiden im Gespräch.

Liebe Denise, Lieber Jarin, wer seid ihr und was ist eure grösste Macke?
Jarin: Ich bin Jarin, 38 Jahre alt, bin aus dem Baselbiet und wohne seit knapp 20 Jahren in Basel. Meine Mutter ist Halb-Schweizerin/Halb-Deutsche und hat über 10 Jahre der Gastronomie gewidmet. Mein Vater ist Basler und aus der Finanzbranche. Meine Rastlosigkeit macht es mir manchmal schwierig, mich zu distanzieren und abzuschalten. Das würde ich wohl als meine grösste Macke, aber auch als eine meiner Stärken bezeichnen.

Denise: Ich bin Denise, 36 Jahre alt, bin aus dem Aargau und wohne seit 13 Jahren in Basel. Hier bin ich zuhause. Die Familie meiner Mutter ist aus Graubünden. Sie haben da zwei Beizen geführt; unter anderem das «Alperösli» oberhalb von Klosters. Mein Vater ist ebenfalls Schweizer und nutzt sein pensioniertes Leben, um Wasserwerke zu betreuen und die Schweiz zu Fuss oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Dass ich immer denke, «voll easy, das kann ich locker machen, weils mir noch Spass machen würde», und dann merke, dass ich wieder einmal voll im Seich bin, das passiert noch immer. Dann frage ich mich, ob es etwas Gutes ist oder ob ich endlich lernen sollte, dass ich auch Grenzen habe?

Was ist «Matt & Elly» und wie kam es zur Gründung?
Denise: «Matt & Elly» Brewery & Kitchen ist ein Restaurant, eine Brauerei und eine Craft Beer Bar. Ein Ort an dem Lokales und Lokale zusammenkommen, zum Geniessen und gemütlichen Beisammensein, um etwas Neues zu erleben oder sich mit einer neuen Person auszutauschen. «Matt & Elly» ist aber auch eine Brand. Eine Brand, bei der alles möglich ist und sein kann. Wer uns kennt weiss, dass wir auch Kunstausstellungen zeigen und einen kleinen Concept Store haben mit Produkten von lokalen Designer*innen und Anbieter*innen, Merchandising oder Hausgemachtem aus unserer Küche.

Jarin schrieb damals für seinen Arbeitgeber einen Businessplan, wie man den Betrieb weiterentwickeln könnte. Seine Idee kam nicht in die nächste Runde, weshalb ich ihm sagte, na, dann mach’s doch selbst! Jarin meinte, also gut, aber ich mach’ das sicher nicht allein, wenn, dann bist du mit dabei! Wir liessen das beide einmal sacken und gingen zuerst auf Reisen. Vor allem die Westküste der USA hat uns dabei sehr inspiriert. Die Brauereien, aber auch das Essen, das aus den Zutaten gekocht wurde, die in der Gegend verfügbar waren, hat uns begeistert. Speisekarten gab es oft nicht oder waren nicht aktuell, weils schon neue Produkte gab. Essen mit Craft Beer zu kombinieren, wie man das mit Wein selbstverständlich macht, hat uns voll begeistert und wir dachten, das fehlt noch in Basel!

«Matt & Elly» – weshalb der Name?
Wir wussten von Anfang an, dass wir einen starken Namen wollen. Einen, der unsere Inspiration beschreibt und den Menschen schon vor dem Entstehen der Brewery & Kitchen, beschreiben kann, wie sich dieser Ort anfühlen wird, was er ausstrahlt, wer dahin kommen möchte. Für uns war wichtig, dass wir ein kreatives Team von Anfang an mit im Boot haben, weshalb wir Zoe Neumayr von «cleo» angefragt haben. Sie hat uns mit unserer Grafikerin, Künstlerin und mittlerweile guter Freundin, Patrizia Stalder und unserem Innenarchitekten, Gabriel Heusser, zusammengebracht. In diesem Team haben wir den Namen erarbeitet und mit der Story von «Matt & Elly» begonnen; zwei Reisende, die sich in Basel kennen gelernt und sich in die Stadt und ineinander verliebt haben. Gemeinsam haben sie beschlossen, ihre Ideen und Inspirationen mit den Menschen in Basel zu teilen. In der «Matt & Elly» Brewery & Kitchen.

Was habt ihr vor «Matt & Elly» gemacht?
Jarin hat die Lehre als Koch gemacht, hat als Barkeeper, Geschäftsführer gearbeitet in Basel. Denise hat Hotelmanagement studiert und hat bis auf ein, zwei Jahre in denen sie im Marketing und im Verkauf gearbeitet hat, in der Hotellerie gearbeitet als Receptionistin, Receptionsleiterin und Direktorin.

Eine «Matt & Elly» Weisheit an unsere Leser*innen?
Bei allem was wir schaffen, setzen wir auf Qualität; beim Kochen, beim Brauen, beim Umgang mit Menschen – Mitarbeiter*innen, Gästen, Lieferant*innen, Partner*innen und miteinander – und beim Entscheiden von Alltäglichem oder Strategischem. Natürlich ist das auch anstrengend, aber nur so macht unser Schaffen für uns Sinn!


Wie klingt Matt & Elly?
«Matt & Elly» Playlist «Day 1» von Alma Negra. Diego und Dersu haben sechs ‘World Music’ Playlists für uns gemacht, bevor wir eröffnet haben, einfach aufgrund unserer Beschreibung vom Ort und von dem, was wir möchten, dass die Menschen fühlen. Wir nutzen sie noch immer, vor allem die «Day 1».
Wo in Basel treibt ihr euch persönlich am liebsten herum?
Im Herz – wir lieben ihre Cocktails. Im Sommer im «FISK&ØL» am Hafen. Neu auch auf unserer Terrasse, wir sind grad umgezogen und bei unseren Freund*innen im Garten, die gerade in ein Haus gezogen sind.

Was ist eure absolute Spezialität?
«Matt & Elly» ist immer ein Erlebnis, eine Entdeckung. Entweder geniesst du neue Speisen, neue Craft Beer Sorten, neue Kunst an den Wänden, neue Kleider und Accessoires im Concept Store oder neue Events mit neuen Künstler:innen. Wir wechseln ca. all 2 – 3 Wochen einzelne Gerichte, deren Zutaten nicht mehr saisonal verfügbar sind.
Wenn es etwas statt Regen vom Himmel regnen könnte, was wäre das?
Schöne Kleidung.

Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Mehr Offenheit; füreinander, für Neues, für sich selbst. Weniger Drang zur Sicherheit.
Wie wär's mal mit...
...Ana Brankovic ins «Matt & Elly» einladen? Mit ihr macht’s drum sehr viel Spass – und ihr schmeckt’s sehr! (Lacht)

Vielen Dank an Denise, Jarin und das tolle Team für einen tollen Abend mit grandiosem Essen. Wir kommen bestimmt wieder!
_
von Ana Brankovic
am 06.06.2022
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Astro Fries»: Im Gespräch mit Lothar Linsmayer und Ayrton Rodriguez
Dank «Astro Fries» bekommt Basel die erste Frittenbude überhaupt. Direkt an der belebten Feldbergstrasse gibt’s sowohl einfache Pommes mit Ketchup als auch Loaded Fries mit diversen Toppings. Warum Lothar Linsmayer und Ayrton Rodriguez «Astro Fries» auf die Beine stellten und wo die beiden sich am liebsten rumtreiben, erzählen sie uns im Gespräch.
![]()
Lieber Lothie, lieber Ayrton, wer seid ihr und woher kennt ihr euch?
Lothie: Hi Ana, ich bin 36 Jahre jung und schon länger in der Gastronomie in Basel tätig. Ich bin aufbrausend aber lustig (lacht). Ich bin gelernter Koch und habe schon diverse Foodkonzepte für Restaurants gemacht.
![]()
Ayrton: Hallo Ana, Ich bin 27 Jahre alt und komme eigentlich aus einer anderen Branche. Ich habe Automobil-Mechatroniker gelernt und bin dann in die Eventbranche gerutscht. Mein Interesse an der Gastronomie und an Essen wurde immer intensiver. Wir teilen die gleiche Leidenschaft und zwar das Surfen. Durch dieses Hobby kennen wir uns auch. Wir haben so viele Macken, die zählen wir jetzt nicht alle auf (lacht).
![]()
Was ist «Astro Fries» und weshalb habt ihr die gegründet?
Ayrton: «Astro Fries» ist die erste Pommesbude in Basel. Wir machen hausgemachte Fritten und leckere Toppings. «Astro Fries» hat sich zu einem Treffpunkt für alle* entwickelt, da alle* Pommes lieben. Fritten verbinden.
![]()
Lothie: Mit «Astro Fries» wollten wir den Leuten leckeren «Comfort Food» bieten: Loaded Fries mit ausgefallenen Toppings. Wir legen grossen Wert auf die Zubereitung unserer Pommes sowie unserer Saucen und Toppings.
«Astro Fries» weshalb der Name?
Beide: Weil es einfach astronomisch geile Fritten sind.
![]()
![]()
Wer war für das Interieur sowie die Grafik zuständig und was ist das Konzept dahinter?
Lothie: Wir haben uns das meiste selber ausgedacht und überlegt, wie es bei uns aussehen soll. Das Interieur Konzept ist einfach und schlicht, wie es sich für eine Pommesbude gehört. Unsere Corporate Identity hat Olivia Schläpfer von Studio Peepz entworfen.
![]()
Ayrton: Wir waren nicht immer gleicher Meinung (lacht) und das war auch gut, da wir so unseren Horizont erweitern konnten. Für die Umsetzung haben wir viel Hilfe von Freund:innen und Familie bekommen.
![]()
Wie steht ihr zu den Themen Nachhaltigkeit, Food Waste und Local Food?
Ayrton: Die Themen Nachhaltigkeit und vor allem Food Waste sind uns sehr wichtig. Meiner Meinung nach, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, mit schweizer Produkten zu arbeiten und auf eine möglichst ökologische Verpackung zu achten.
![]()
Lothie: Food Waste ist für uns ein No-Go. Wir produzieren den täglichen Bedarf und wenn etwas alle ist, ist es halt alle – besser so als es wegzuschmeissen. Grundsätzlich probieren wir so regional wie möglich zu arbeiten.
![]()
Ein Song oder eine Playlist, der bzw. die «Astro Fries» am besten widerspiegelt?
«Astro World» von Travis Scott.
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Beide: Abgesehen davon, dass es natürlich mehr Kartoffeln geben sollte, sollte es mehr Miteinander und weniger Gegeneinander geben. Die Menschen sind oft auf sich und ihr nahes Umfeld fokussiert, dass sie vergessen, dass es noch andere Menschen gibt. Es kann schliesslich sein, dass man miteinander noch viel weiter kommt.
![]()
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte statt Regen, was wäre das?
Beide: Frittierte Sonnenstrahlen
Wo in Basel treibt ihr euch am liebsten rum und weshalb?
Ayrton: In meiner Freizeit schraube ich gerne an meinem Motorrad rum und geh auch gerne fahren. Auflegen gehört ebenfalls zu meiner Leidenschaft und ich bespiele gerne das Viertel und weiter Clubs. Wenn ich mal einen Abend frei habe, gehe ich gerne in die Taverne Johann Essen. Ein kühles Bier im Lido feier ich auch ab.
![]()
![]()
Lothie: Bei der Kaserne finde ich es ganz gut – ob mit Kaffee oder Bier man trifft immer jemanden an, den man kennt. Pizzen von Notorious 801 und Premura finde ich richtig lecker.
![]()
Eure absoluten Lieblingspommes?
Ayrton: Truffle Parmesan Fries ist der Shit!
Lothie: Truffle Parmesan Fries mit extra Spiegelei, Damn!
Wie wär’s mal mit...
Beide: ...Fritten?
![]()
Vielen Dank an Lothie und Ayrton für die leckeren Fritten sowie die entspannte und sympathische Atmosphäre bei «Astro Fries».
_
von Ana Brankovic
am 27.12.2021
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Dank «Astro Fries» bekommt Basel die erste Frittenbude überhaupt. Direkt an der belebten Feldbergstrasse gibt’s sowohl einfache Pommes mit Ketchup als auch Loaded Fries mit diversen Toppings. Warum Lothar Linsmayer und Ayrton Rodriguez «Astro Fries» auf die Beine stellten und wo die beiden sich am liebsten rumtreiben, erzählen sie uns im Gespräch.
Lieber Lothie, lieber Ayrton, wer seid ihr und woher kennt ihr euch?
Lothie: Hi Ana, ich bin 36 Jahre jung und schon länger in der Gastronomie in Basel tätig. Ich bin aufbrausend aber lustig (lacht). Ich bin gelernter Koch und habe schon diverse Foodkonzepte für Restaurants gemacht.
Ayrton: Hallo Ana, Ich bin 27 Jahre alt und komme eigentlich aus einer anderen Branche. Ich habe Automobil-Mechatroniker gelernt und bin dann in die Eventbranche gerutscht. Mein Interesse an der Gastronomie und an Essen wurde immer intensiver. Wir teilen die gleiche Leidenschaft und zwar das Surfen. Durch dieses Hobby kennen wir uns auch. Wir haben so viele Macken, die zählen wir jetzt nicht alle auf (lacht).
Was ist «Astro Fries» und weshalb habt ihr die gegründet?
Ayrton: «Astro Fries» ist die erste Pommesbude in Basel. Wir machen hausgemachte Fritten und leckere Toppings. «Astro Fries» hat sich zu einem Treffpunkt für alle* entwickelt, da alle* Pommes lieben. Fritten verbinden.
Lothie: Mit «Astro Fries» wollten wir den Leuten leckeren «Comfort Food» bieten: Loaded Fries mit ausgefallenen Toppings. Wir legen grossen Wert auf die Zubereitung unserer Pommes sowie unserer Saucen und Toppings.
«Astro Fries» weshalb der Name?
Beide: Weil es einfach astronomisch geile Fritten sind.
Wer war für das Interieur sowie die Grafik zuständig und was ist das Konzept dahinter?
Lothie: Wir haben uns das meiste selber ausgedacht und überlegt, wie es bei uns aussehen soll. Das Interieur Konzept ist einfach und schlicht, wie es sich für eine Pommesbude gehört. Unsere Corporate Identity hat Olivia Schläpfer von Studio Peepz entworfen.
Ayrton: Wir waren nicht immer gleicher Meinung (lacht) und das war auch gut, da wir so unseren Horizont erweitern konnten. Für die Umsetzung haben wir viel Hilfe von Freund:innen und Familie bekommen.
Wie steht ihr zu den Themen Nachhaltigkeit, Food Waste und Local Food?
Ayrton: Die Themen Nachhaltigkeit und vor allem Food Waste sind uns sehr wichtig. Meiner Meinung nach, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, mit schweizer Produkten zu arbeiten und auf eine möglichst ökologische Verpackung zu achten.
Lothie: Food Waste ist für uns ein No-Go. Wir produzieren den täglichen Bedarf und wenn etwas alle ist, ist es halt alle – besser so als es wegzuschmeissen. Grundsätzlich probieren wir so regional wie möglich zu arbeiten.
Ein Song oder eine Playlist, der bzw. die «Astro Fries» am besten widerspiegelt?
«Astro World» von Travis Scott.
Wovon braucht die Schweiz mehr, wovon weniger?
Beide: Abgesehen davon, dass es natürlich mehr Kartoffeln geben sollte, sollte es mehr Miteinander und weniger Gegeneinander geben. Die Menschen sind oft auf sich und ihr nahes Umfeld fokussiert, dass sie vergessen, dass es noch andere Menschen gibt. Es kann schliesslich sein, dass man miteinander noch viel weiter kommt.
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte statt Regen, was wäre das?
Beide: Frittierte Sonnenstrahlen
Wo in Basel treibt ihr euch am liebsten rum und weshalb?
Ayrton: In meiner Freizeit schraube ich gerne an meinem Motorrad rum und geh auch gerne fahren. Auflegen gehört ebenfalls zu meiner Leidenschaft und ich bespiele gerne das Viertel und weiter Clubs. Wenn ich mal einen Abend frei habe, gehe ich gerne in die Taverne Johann Essen. Ein kühles Bier im Lido feier ich auch ab.
Lothie: Bei der Kaserne finde ich es ganz gut – ob mit Kaffee oder Bier man trifft immer jemanden an, den man kennt. Pizzen von Notorious 801 und Premura finde ich richtig lecker.
Eure absoluten Lieblingspommes?
Ayrton: Truffle Parmesan Fries ist der Shit!
Lothie: Truffle Parmesan Fries mit extra Spiegelei, Damn!
Wie wär’s mal mit...
Beide: ...Fritten?
Vielen Dank an Lothie und Ayrton für die leckeren Fritten sowie die entspannte und sympathische Atmosphäre bei «Astro Fries».
_
von Ana Brankovic
am 27.12.2021
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Wartsaal» Bern: Im Gespräch mit Martin Allemann und Tom Iseli
Gleich zu Anfang des beliebten Lorraine-Quartier befindet sich der «Wartsaal», Wohnzimmer und Bar in einem. Hier schreiben die Autor:innen von morgen, die Karte entführt in die Welt des ausgedehnten Brunchens und verleiht einen Einblick in die Vielfalt der Bierkultur. Wie das Lokal zu seinem Namen kam und wann du am besten vorbeigehst, um gemütliche Stunden zu verbringen? Wir sprachen mit Martin Allemann und Tom Iseli, die sich die Geschäftsleitung teilen.
![]()
Lieber Tom, wer bist du und was machst du hier?
Ich bin mit Tinu zusammen Geschäftsführer, respektive –Inhaber des Lokals «Wartsaal». Wir arbeiten beide im Service mit an der Front, sowie in der Küche und natürlich auch im Büro für das Bestellwesen und unsere kulturellen Anlässe.
![]()
Wie beschreibst du das Konzept des Wartsaals und was hat euch zur Eröffnung des Lokals inspiriert?
Zum einen möchten wir gerne «Wohnzimmer» sein für unser Quartier, die Lorraine. Unser Anspruch ist es, dass sich hier alle wohlfühlen und vorbeikommen können. Wir sind aber nicht eine reine Quartierbeiz, Menschen aus der ganzen Stadt zieht es zu uns.
Warum der Name «Wartsaal»?
Hier im Lorraine-Quartier befand sich einst der Endbahnhof der Stadt Bern und da gab es bestimmt auch einen geschäftigen «Wartsaal». Wir wollten diese schöne Stimmung aufgreifen mit unserem Konzept.
![]()
Was magst du gerne an deiner Arbeit und was weniger?
Ich mag besonders, wenn genügend Zeit da ist, um auch mit den Kund:innen ins Gespräch zu kommen, über unsere Auswahl an Getränken und Speisen, oder auch einmal auszuholen über die Herkunft unserer Produkte. Es ist einfach schön, zufriedene Gäste um sich zu haben. Manchmal gibt es besonders tolle Abende, die nicht aufhören sollten. Aber es gibt halt Gesetze und Regeln, die in einem gastronomischen Betrieb einzuhalten sind und administrative Arbeiten sind manchmal lästig.
![]()
![]()
Wie würdest du den Wartsaal als Song beschreiben?
«Always look on the bright side of life» (lacht)! Also, die Platte, worauf dieser Song zu hören wäre, hätte sicherlich auch eine B-Side. Sozusagen eine Seite, die fröhlich klingt und die andere eher melancholisch.
Zu welcher Tageszeit lohnt sich ein Besuch deiner Meinung nach am meisten?
Es kommt darauf an, was man möchte – das ist das tolle an unserem Lokal! Ich mag beide Stimmungen sehr, wenn man spätabends vorbeikommt zum Schlummertrunk oder morgens inklusive Morgensonne seinen Kaffee auf der Terrasse geniesst.
![]()
Wie beschreibst du eure Kundschaft in drei Worten?
Divers, bewusst, freundlich, oder: nett und unkompliziert.
Beschreibe einen perfekten Tag in Bern.
Die schöne Morgensonne geniessen, danach ein bisschen arbeiten und dazwischen in der Zimmerstunde einen Sprung in die Aare machen. Und abends dann ein gemütliches Konzert mit Freund:innen besuchen.
![]()
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das?
Desinfektionsmittel (lacht). Nein, Liebe!
Wie wär’s mal mit...
...Brunchen im «Wartsaal»? Oder: «Tibi», unserem selbstgebrauten Wasser-Kefir-Getränk!
![]()
Vielen Dank, lieber Tom für den herzlichen Einblick und den guten Cappuccino. Wer kein Wohnzimmer hat oder einfach einen gemütlichen Ort zum ausspannen oder sogar den ganzen Tag zu verbringen braucht, suche den «Wartsaal» auf und lasse sich in die gemütliche Atmosphäre einlullen.
_
von Linda Christa Bill
am 13.12.2021
Fotos
© Laura Binggeli für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Gleich zu Anfang des beliebten Lorraine-Quartier befindet sich der «Wartsaal», Wohnzimmer und Bar in einem. Hier schreiben die Autor:innen von morgen, die Karte entführt in die Welt des ausgedehnten Brunchens und verleiht einen Einblick in die Vielfalt der Bierkultur. Wie das Lokal zu seinem Namen kam und wann du am besten vorbeigehst, um gemütliche Stunden zu verbringen? Wir sprachen mit Martin Allemann und Tom Iseli, die sich die Geschäftsleitung teilen.

Lieber Tom, wer bist du und was machst du hier?
Ich bin mit Tinu zusammen Geschäftsführer, respektive –Inhaber des Lokals «Wartsaal». Wir arbeiten beide im Service mit an der Front, sowie in der Küche und natürlich auch im Büro für das Bestellwesen und unsere kulturellen Anlässe.

Wie beschreibst du das Konzept des Wartsaals und was hat euch zur Eröffnung des Lokals inspiriert?
Zum einen möchten wir gerne «Wohnzimmer» sein für unser Quartier, die Lorraine. Unser Anspruch ist es, dass sich hier alle wohlfühlen und vorbeikommen können. Wir sind aber nicht eine reine Quartierbeiz, Menschen aus der ganzen Stadt zieht es zu uns.
Warum der Name «Wartsaal»?
Hier im Lorraine-Quartier befand sich einst der Endbahnhof der Stadt Bern und da gab es bestimmt auch einen geschäftigen «Wartsaal». Wir wollten diese schöne Stimmung aufgreifen mit unserem Konzept.

Was magst du gerne an deiner Arbeit und was weniger?
Ich mag besonders, wenn genügend Zeit da ist, um auch mit den Kund:innen ins Gespräch zu kommen, über unsere Auswahl an Getränken und Speisen, oder auch einmal auszuholen über die Herkunft unserer Produkte. Es ist einfach schön, zufriedene Gäste um sich zu haben. Manchmal gibt es besonders tolle Abende, die nicht aufhören sollten. Aber es gibt halt Gesetze und Regeln, die in einem gastronomischen Betrieb einzuhalten sind und administrative Arbeiten sind manchmal lästig.


Wie würdest du den Wartsaal als Song beschreiben?
«Always look on the bright side of life» (lacht)! Also, die Platte, worauf dieser Song zu hören wäre, hätte sicherlich auch eine B-Side. Sozusagen eine Seite, die fröhlich klingt und die andere eher melancholisch.
Zu welcher Tageszeit lohnt sich ein Besuch deiner Meinung nach am meisten?
Es kommt darauf an, was man möchte – das ist das tolle an unserem Lokal! Ich mag beide Stimmungen sehr, wenn man spätabends vorbeikommt zum Schlummertrunk oder morgens inklusive Morgensonne seinen Kaffee auf der Terrasse geniesst.

Wie beschreibst du eure Kundschaft in drei Worten?
Divers, bewusst, freundlich, oder: nett und unkompliziert.
Beschreibe einen perfekten Tag in Bern.
Die schöne Morgensonne geniessen, danach ein bisschen arbeiten und dazwischen in der Zimmerstunde einen Sprung in die Aare machen. Und abends dann ein gemütliches Konzert mit Freund:innen besuchen.

Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das?
Desinfektionsmittel (lacht). Nein, Liebe!
Wie wär’s mal mit...
...Brunchen im «Wartsaal»? Oder: «Tibi», unserem selbstgebrauten Wasser-Kefir-Getränk!

Vielen Dank, lieber Tom für den herzlichen Einblick und den guten Cappuccino. Wer kein Wohnzimmer hat oder einfach einen gemütlichen Ort zum ausspannen oder sogar den ganzen Tag zu verbringen braucht, suche den «Wartsaal» auf und lasse sich in die gemütliche Atmosphäre einlullen.
_
von Linda Christa Bill
am 13.12.2021
Fotos
© Laura Binggeli für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Ballonsalon Peng!»: Im Gespräch mit Gründerin Marianne Tobler
Direkt an der 30er Bushaltestelle Schanzenstrasse haben Marianne Tobler und Dina Schüpbach ihren «Ballonsalon Peng!» eröffnet. Was sie dazu motiviert hat, was Ballons mit Theater und Museen zu tun haben und weshalb Helium-Ballons nicht nur Kinder ansprechen, erzählt uns Marianne Tobler aka Mary im Gespräch.
![]()
Liebe Mary, wer bist du und was treibt dich im Leben an?
Ich kann sagen, woher ich komme, was ich mache und dass mich, was ich tue und erlebe, prägt. Seit 16 Jahren lebe ich in Basel, aufgewachsen bin ich in Hundwil im Appenzell Ausserhoden. Das ist übrigens das Dorf, in welchem im April 1989 dann endlich noch das Frauenstimmrecht an der Landsgemeinde angenommen wurde. In Hundwil gab es jedes Jahr eine Viehschau mit einem kleinen Jahrmarkt, an dem ich zum ersten Mal einen mit Helium gefüllten Ballon bekam. So begann die Leidenschaft für Ballons. Ich liebe es, schöne Momente zu kreieren, welche Menschen verbinden. Meine Kreativität und meine Phantasie treiben mich an.
![]()
Wann und weshalb hast du «Ballonsalon Peng!» gegründet?
Gemeinsam mit einer Freundin habe ich im April 2021 den «Ballonsalon Peng!» eröffnet. Schon immer habe ich Ballons gesammelt und auch eine Flasche Helium stand bei mir zuhause. Ich mag an Ballons, dass sie klein und kompakt sind, aber mit dem Aufblasen eine bezaubernde Wirkung entfalten.
![]()
![]()
Die ganze Idee für den Laden entstand, nachdem ich eine Installation für ein Theaterfestival der Cie. Buffpapier gemacht hatte. Dies Installation ist fünf Tage geflogen und ich konnte in dieser Zeit beobachten, welche Wirkung sie auf die Menschen ausübte. Das hat mich fasziniert und angetrieben. Etwas später habe ich erfahren, dass eine Ladenhälfte bei «Arno Wolf» an der der Schanzenstrasse 4 in Basel frei wird. Ich habe mal nachgefragt, was mit dem Lokal passiert und so führte das eine zum andern. Dann ging alles recht schnell. Erstmals hatten wir vor, den Laden drei Monate zu führen, um zu sehen, was passiert. Der Laden fand grossen Anklang, was mich dazu bewegt hatte, nach den drei Monaten alleine weiter zu machen. Danke Dina, ohne dich hätte ich das nicht gestartet.
![]()
![]()
«Ballonsalon Peng!» – weshalb der Name?
Der Name «Ballonsalon Peng!» entstand aus der Idee, dass es nicht nur ein Laden sein soll, sondern auch eine Einladung, sich Zeit zu nehmen, nicht ein fertiges Produkt zu kaufen, sondern ein Teil des Gestaltungsprozesses zu sein. Indem man die Möglichkeit bekommt, aus verschieden Materialien, Farben, Grössen und Accessoires etwas Einmaliges und persönliches zusammenzustellen. Es ist mir wichtig, den Ballon aus dem «Gummpischloss» Kindergeburtstags-Vibe zu holen. Denn ein Ballon ist für mich etwas sehr Poetisches. Und ja, manchmal knallts «peng! peng!»
![]()
![]()
Was sind bisher deine persönlichen Lieblingsprojekte, bei denen du Balloninstallationen gemacht hast und weshalb?
Ehrlich gesagt ist jedes Projekt ein Projekt, über das ich mich auch im Nachhinein noch freue. Jedes Mal ist etwas anders und manchmal ist ein Auftrag auch ein Experiment. Zum Beispiel ein Bühnenbild für eine Theaterproduktion im Appenzellerland mit leuchtenden Riesenballons, welche 3 Wochen fliegen mussten. Im September 2021 durfte ich für das Theaterplatz Fest eine Installation über dem Theaterplatz verwirklichen. Meine Idee war ein schwebendes Dach, welches über den Köpfen der Besucher*innen fliegt, den Raum gegen oben definiert und dem Fest ein Zentrum gibt. Das hat wunderbar geklappt und als der Chor vom Theater Basel darunter gesungen hatte, kam für mich Gänsehautstimmung auf.
![]()
Für mich war es traumhaft, das zu realisieren und die erfreuten Gesichter zu sehen und etwas Zauber an das Fest zu bringen. Für «Das 25 Jahre Jubiläum» des Museum Tinguely habe ich eine Installation mit transparenten Bubbles im Museum und die ganze Ballondekoration in und um den Solitude Park gemacht. Das schöne daran war die Zusammenarbeit mit dem Team des Museums und die Riesenballons mit einem Durchmesser von bis zu 1,80 m. Diese haben wir vor Ort direkt beschriftet und zur Wegleitung genutzt.
![]()
Was ist dein Lebensmotto?
Auch Mut macht schön, nicht nur der Haarföhn.
Wo in Basel treibst du dich am liebsten rum und weshalb?
Im «Ballonsalon Peng!», da gibt’s Helium. Ich mag die Dreirosenbrücke wegen der Weitsicht, bin gerne auf den Rollschuhen unterwegs. Das «Lido» hat mir diesen Sommer schöne Momente geschenkt. Und ich bewege mich gerne zwischen dem Blackcross Bowl und der «Marina Bar». Gerne hätte ich mal wieder eine gute Hiphop-Party.
![]()
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, ausser Regen, was wäre das?
Equilibrum Nr. 2.
Wenn du der ganzen Welt einen Ballon schenken könntest, wie sähe dieser aus, was würde er können?
Knallrot, rund und er wäre gefüllt mit Empathie und Mut.
Wie wär’s mal mit...
...einem Ballon?
![]()
Vielen Dank an Mary für die tollen Einblicke in ihr Tun und Machen.
_
von Ana Brankovic
am 08.11.2021
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Korrektorat
Leonie Häsler, Judith Nyfeler
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Direkt an der 30er Bushaltestelle Schanzenstrasse haben Marianne Tobler und Dina Schüpbach ihren «Ballonsalon Peng!» eröffnet. Was sie dazu motiviert hat, was Ballons mit Theater und Museen zu tun haben und weshalb Helium-Ballons nicht nur Kinder ansprechen, erzählt uns Marianne Tobler aka Mary im Gespräch.
Liebe Mary, wer bist du und was treibt dich im Leben an?
Ich kann sagen, woher ich komme, was ich mache und dass mich, was ich tue und erlebe, prägt. Seit 16 Jahren lebe ich in Basel, aufgewachsen bin ich in Hundwil im Appenzell Ausserhoden. Das ist übrigens das Dorf, in welchem im April 1989 dann endlich noch das Frauenstimmrecht an der Landsgemeinde angenommen wurde. In Hundwil gab es jedes Jahr eine Viehschau mit einem kleinen Jahrmarkt, an dem ich zum ersten Mal einen mit Helium gefüllten Ballon bekam. So begann die Leidenschaft für Ballons. Ich liebe es, schöne Momente zu kreieren, welche Menschen verbinden. Meine Kreativität und meine Phantasie treiben mich an.
Wann und weshalb hast du «Ballonsalon Peng!» gegründet?
Gemeinsam mit einer Freundin habe ich im April 2021 den «Ballonsalon Peng!» eröffnet. Schon immer habe ich Ballons gesammelt und auch eine Flasche Helium stand bei mir zuhause. Ich mag an Ballons, dass sie klein und kompakt sind, aber mit dem Aufblasen eine bezaubernde Wirkung entfalten.
Die ganze Idee für den Laden entstand, nachdem ich eine Installation für ein Theaterfestival der Cie. Buffpapier gemacht hatte. Dies Installation ist fünf Tage geflogen und ich konnte in dieser Zeit beobachten, welche Wirkung sie auf die Menschen ausübte. Das hat mich fasziniert und angetrieben. Etwas später habe ich erfahren, dass eine Ladenhälfte bei «Arno Wolf» an der der Schanzenstrasse 4 in Basel frei wird. Ich habe mal nachgefragt, was mit dem Lokal passiert und so führte das eine zum andern. Dann ging alles recht schnell. Erstmals hatten wir vor, den Laden drei Monate zu führen, um zu sehen, was passiert. Der Laden fand grossen Anklang, was mich dazu bewegt hatte, nach den drei Monaten alleine weiter zu machen. Danke Dina, ohne dich hätte ich das nicht gestartet.
«Ballonsalon Peng!» – weshalb der Name?
Der Name «Ballonsalon Peng!» entstand aus der Idee, dass es nicht nur ein Laden sein soll, sondern auch eine Einladung, sich Zeit zu nehmen, nicht ein fertiges Produkt zu kaufen, sondern ein Teil des Gestaltungsprozesses zu sein. Indem man die Möglichkeit bekommt, aus verschieden Materialien, Farben, Grössen und Accessoires etwas Einmaliges und persönliches zusammenzustellen. Es ist mir wichtig, den Ballon aus dem «Gummpischloss» Kindergeburtstags-Vibe zu holen. Denn ein Ballon ist für mich etwas sehr Poetisches. Und ja, manchmal knallts «peng! peng!»
Was sind bisher deine persönlichen Lieblingsprojekte, bei denen du Balloninstallationen gemacht hast und weshalb?
Ehrlich gesagt ist jedes Projekt ein Projekt, über das ich mich auch im Nachhinein noch freue. Jedes Mal ist etwas anders und manchmal ist ein Auftrag auch ein Experiment. Zum Beispiel ein Bühnenbild für eine Theaterproduktion im Appenzellerland mit leuchtenden Riesenballons, welche 3 Wochen fliegen mussten. Im September 2021 durfte ich für das Theaterplatz Fest eine Installation über dem Theaterplatz verwirklichen. Meine Idee war ein schwebendes Dach, welches über den Köpfen der Besucher*innen fliegt, den Raum gegen oben definiert und dem Fest ein Zentrum gibt. Das hat wunderbar geklappt und als der Chor vom Theater Basel darunter gesungen hatte, kam für mich Gänsehautstimmung auf.
Für mich war es traumhaft, das zu realisieren und die erfreuten Gesichter zu sehen und etwas Zauber an das Fest zu bringen. Für «Das 25 Jahre Jubiläum» des Museum Tinguely habe ich eine Installation mit transparenten Bubbles im Museum und die ganze Ballondekoration in und um den Solitude Park gemacht. Das schöne daran war die Zusammenarbeit mit dem Team des Museums und die Riesenballons mit einem Durchmesser von bis zu 1,80 m. Diese haben wir vor Ort direkt beschriftet und zur Wegleitung genutzt.
Was ist dein Lebensmotto?
Auch Mut macht schön, nicht nur der Haarföhn.
Wo in Basel treibst du dich am liebsten rum und weshalb?
Im «Ballonsalon Peng!», da gibt’s Helium. Ich mag die Dreirosenbrücke wegen der Weitsicht, bin gerne auf den Rollschuhen unterwegs. Das «Lido» hat mir diesen Sommer schöne Momente geschenkt. Und ich bewege mich gerne zwischen dem Blackcross Bowl und der «Marina Bar». Gerne hätte ich mal wieder eine gute Hiphop-Party.
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, ausser Regen, was wäre das?
Equilibrum Nr. 2.
Wenn du der ganzen Welt einen Ballon schenken könntest, wie sähe dieser aus, was würde er können?
Knallrot, rund und er wäre gefüllt mit Empathie und Mut.
Wie wär’s mal mit...
...einem Ballon?
Vielen Dank an Mary für die tollen Einblicke in ihr Tun und Machen.
_
von Ana Brankovic
am 08.11.2021
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Korrektorat
Leonie Häsler, Judith Nyfeler
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Banan» Basel: Im Gespräch mit Anis Hübscher, Stéphanie Laurent, Denis Ivanović und Anna Parisi
Hast du genug vom immer gleichen Haarschnitt und möchtest dich von kreativen und motivierten Menschen inspirieren lassen? Wo der Coiffeursalon schöner als dein zu Hause ist und der Zeitgeist in Frisur und Nageldesign fliesst, da ist das Team von «Banan» und Anna von «Parisinailedit». Im Interview erfährst du, wie sie ihr Geschäft in Zeiten der Pandemie eröffnet haben, welche Musik bei ihnen morgens in Dauerschleife läuft und wo man die vier in Basel sonst noch so antrifft.
![]()
Liebe Anis, Stéphanie, Denis und Anna, wer seid ihr und was macht ihr?
Anis: Wir sind «Banan». Denis, Stéphanie und ich, Anis, sind eine eigenständige Firma und Anna ist bei uns mit ihrem Nagelstudio eingemietet. Wir haben unsere Firma im Mai 2020 gegründet.
Stéphanie: Im Oktober haben wir erstmal ein Pop Up eröffnet, weil wir an der Wallstrasse noch nicht fertig waren mit dem Umbau. Anfang 2021 sind wir dann fix hier eingezogen und im März ist Anna dazugekommen.
Anna: Die Zusammenarbeit haben wir zwar schon im Sommer davor abgesprochen, doch da war ich noch nicht so weit. Ich habe erst noch eine Ausbildung gemacht, bevor ich hier mein Studio eröffnet habe.
![]()
Woher kennt ihr euch und wie habt ihr zusammengefunden?
Anis: Denis und ich haben zuvor fast acht Jahre lang gemeinsam in der «Hauptsache» gearbeitet. Danach bin ich zu «Laurent Laurent», wo ich Stéphanie kennengelernt habe. Denis und ich wollten unbedingt wieder zusammenarbeiten und Stéphanie wollte auch etwas Neues anfangen und so kam die Idee auf, gemeinsam etwas Neues zu starten.
Anna: Und ich kenne Denis aus Zeiten, als ich noch im «Hinterhof» gearbeitet habe. Anis kenne ich ebenfalls durch das Ausgehen und Stéphanie habe ich dann hier im «Banan» kennengelernt.
![]()
Anis: Wir haben uns ziemlich zu Beginn der Covid-19 Pandemie entschlossen das «Banan» zu gründen.
Stéphanie: Es gab dann erstmal einen Lockdown, aber danach war der Ansturm so gross, dass für uns klar war, dass wir unsere Idee durchziehen können.
Denis: Wir hatten da eigentlich Glück, weil die Coiffeurgeschäfte fast immer geöffnet blieben und die Nachfrage nach dem Lockdown so gross war.
![]()
Wo seid ihr in Basel gerne unterwegs?
Stéphanie: Ich gehe am liebsten ins «Flore» oder ins «Avant-Gouz».
Anis: Am liebsten bin ich immer noch im St. Johann unterwegs, weil ich da lange gewohnt habe und viele meiner Freund*innen noch da wohnen. Und sonst gehe ich auch gerne ab und zu ins «Wurm» in der «Flatterschaft».
Anna: Bei mir gibt es eigentlich nur zwei Zustände, entweder voll Party-Modus oder einfach lame und gemütlich. Deshalb bin ich ganz gerne in meinem Bett. Aber sonst bin ich gerne unterwegs, z.B. im «Elysia» oder im «Rouine».
Denis: Ich gehe auch ganz gerne ins «Flore». Und sonst am liebsten auf den Markt oder in ein gutes Bio-Lädeli. Der schönste Markt ist der in St. Louis oder beim Wettsteinplatz.
![]()
Was macht eure Arbeit besonders spannend und was findet ihr eher anstrengend?
Stéphanie: Wir haben extrem tolle Kund*innen. Es sind viele kreative Leute und das ist eine Bereicherung für uns. Ich möchte nicht angeben, aber man zieht ja bekanntlich das an, was man selbst ist. Wir schätzen das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, sehr.
Anis: Sie geben uns die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten und uns ausleben zu dürfen. Die Beratung und der Austausch mit den Kund*innen sind sehr bereichernd, das macht wirklich sehr viel aus.
Denis: Die Arbeit ist ausserdem sehr abwechslungsreich, in dem Sinne, dass jede Person einzigartig ist. Und trotzdem sieht man unmittelbar nach einer kurzen Zeit ein Ergebnis der eigenen Arbeit. Zudem schätze ich auch, dass man die Arbeit am Abend nicht mit nach Hause nimmt. Es ist jedoch auch kein einfacher Job, der physische Aspekt ist zum Teil sehr anstrengend, man muss sich immer wieder daran erinnern, keine komische Haltung einzunehmen.
Stéphanie: Schwierig am Job ist auch, dass man sich total auf die Kund*innen einlassen muss und sehr exponiert ist. Man bekommt immer alles mit und kann sich während der Arbeit nicht zurückziehen.
![]()
![]()
Anna: Das kann ich alles bestätigen. Für mich war vor allem der Aspekt des Exponiert-Seins etwas Neues, mit dem ich erst lernen musste umzugehen, da ich zuvor meistens in einem Büro gearbeitet habe. Aber man gewöhnt sich schnell daran. Hat mal jemand einen schlechten Tag, nimmt man diese Energie des Gegenübers selbst auch auf. Aber es ist wirklich schön, in einer kurzen Zeit das Ergebnis der eigenen Arbeit zu sehen. Dabei konfrontiere ich mich jedoch auch mit dem Anspruch an die eigene Leistung. Das ist für mich ein grosser Prozess, weil ich es noch nicht so lange mache. Teil dieses Prozesses ist es auch immer, ein wenig besser zu werden. Diese Auseinandersetzung mit meiner Leistung und meinen Zielen gibt mir sehr viel Energie, ist aber teilweise auch sehr anstrengend.
![]()
Wenn das «Banan» ein Drei-Gang Menü wäre, was gäbe es zu essen?
Denis: Also, es gäbe sicherlich Prosecco zum Trinken.
Anis: Und zum Essen gibt es Gipfeli, Bouillon-Suppe und eine Banane.
Stéphanie: Das sind so etwa die Dinge, die oft bei uns auf dem Tisch liegen.
Anna: Auf jeden Fall etwas, das man schnell zwischen den Terminen essen kann, weil wir meistens kaum Zeit haben, uns in Ruhe hinzusetzen.
![]()
Was inspiriert euch für eure Arbeit?
Anis: Mich inspiriert sehr, dass ich jetzt auf dem Land wohne und mich von der Arbeit in der Stadt distanzieren kann.
Stéphanie: Mich inspirieren vor allem die Menschen, die zu uns kommen. Sich auf sie einzulassen und etwas auszuprobieren, finde ich immer wieder sehr schön. Und sonst schaue ich mir gerne auf Reisen oder in den Ferien die Leute an und versuche mich vom Vibe des Ortes inspirieren zu lassen und etwas davon mitzunehmen.
Denis: Ich fühle mich immer wieder inspiriert durch das Nachtleben, sei es durch die Leute selbst, durch Musik, Mode oder Frisuren, die ich dort sehe.
![]()
Anna: Bei mir sind es schon eher Bilder von Designs oder von neuen Techniken, die mich in meiner Arbeit inspirieren. Das ist jedoch oft eine endlose Suche und Inspiration. Ich könnte stundenlang durch Instagram scrollen, das gehört für mich zum Prozess dazu, meinen eigenen Stil zu finden. Weitere Inspirationen finde ich auch in der Kunst oder ganz konkret durch ein Outfit, ein Muster, oder eine Tapete. Daraus versuche ich dann ein Design zu abstrahieren und auf dem Nagel umzusetzen. Das ist oft ein sehr langer Prozess, aber meistens kommt genau das dann sehr gut an und ich merke, dass das am meisten ‹ich selbst› bin.
Welche Songs laufen bei euch in Dauerschleife?
Denis: Ich bin meistens früh dran und höre zurzeit einen Track von Sault im Repeat-Modus.
Anna: Bei mir läuft meistens GDS.FM.
Stéphanie: Wenn ich als erste hier bin, höre ich oft Colors Studios.
Anis: Und ich bin eigentlich nie als erste da und höre daher immer das, was halt gerade läuft.
Wie wär’s mal mit...
...«Banan»?!
![]()
Vielen Dank für das Gespräch, Anis, Denis, Stéphanie und Anna und die Einblicke in eure Arbeit, die ihr mir vermittelt habt. Wer sich also gerne wieder mal in inspirierender Umgebung die Nägel mit trendigen Designs oder die Haare mit einem mutigen Haarschnitt auffrischen lassen möchte, sollte einen Besuch im «Banan» nicht verpassen.
_
von Laura Schläpfer
am 01.11.2021
Fotos
© Monir Sahili für Wie wär's mal mit
Korrektorat
Leonie Häsler, Judith Nyfeler
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Hast du genug vom immer gleichen Haarschnitt und möchtest dich von kreativen und motivierten Menschen inspirieren lassen? Wo der Coiffeursalon schöner als dein zu Hause ist und der Zeitgeist in Frisur und Nageldesign fliesst, da ist das Team von «Banan» und Anna von «Parisinailedit». Im Interview erfährst du, wie sie ihr Geschäft in Zeiten der Pandemie eröffnet haben, welche Musik bei ihnen morgens in Dauerschleife läuft und wo man die vier in Basel sonst noch so antrifft.

Liebe Anis, Stéphanie, Denis und Anna, wer seid ihr und was macht ihr?
Anis: Wir sind «Banan». Denis, Stéphanie und ich, Anis, sind eine eigenständige Firma und Anna ist bei uns mit ihrem Nagelstudio eingemietet. Wir haben unsere Firma im Mai 2020 gegründet.
Stéphanie: Im Oktober haben wir erstmal ein Pop Up eröffnet, weil wir an der Wallstrasse noch nicht fertig waren mit dem Umbau. Anfang 2021 sind wir dann fix hier eingezogen und im März ist Anna dazugekommen.
Anna: Die Zusammenarbeit haben wir zwar schon im Sommer davor abgesprochen, doch da war ich noch nicht so weit. Ich habe erst noch eine Ausbildung gemacht, bevor ich hier mein Studio eröffnet habe.

Woher kennt ihr euch und wie habt ihr zusammengefunden?
Anis: Denis und ich haben zuvor fast acht Jahre lang gemeinsam in der «Hauptsache» gearbeitet. Danach bin ich zu «Laurent Laurent», wo ich Stéphanie kennengelernt habe. Denis und ich wollten unbedingt wieder zusammenarbeiten und Stéphanie wollte auch etwas Neues anfangen und so kam die Idee auf, gemeinsam etwas Neues zu starten.
Anna: Und ich kenne Denis aus Zeiten, als ich noch im «Hinterhof» gearbeitet habe. Anis kenne ich ebenfalls durch das Ausgehen und Stéphanie habe ich dann hier im «Banan» kennengelernt.

Anis: Wir haben uns ziemlich zu Beginn der Covid-19 Pandemie entschlossen das «Banan» zu gründen.
Stéphanie: Es gab dann erstmal einen Lockdown, aber danach war der Ansturm so gross, dass für uns klar war, dass wir unsere Idee durchziehen können.
Denis: Wir hatten da eigentlich Glück, weil die Coiffeurgeschäfte fast immer geöffnet blieben und die Nachfrage nach dem Lockdown so gross war.

Wo seid ihr in Basel gerne unterwegs?
Stéphanie: Ich gehe am liebsten ins «Flore» oder ins «Avant-Gouz».
Anis: Am liebsten bin ich immer noch im St. Johann unterwegs, weil ich da lange gewohnt habe und viele meiner Freund*innen noch da wohnen. Und sonst gehe ich auch gerne ab und zu ins «Wurm» in der «Flatterschaft».
Anna: Bei mir gibt es eigentlich nur zwei Zustände, entweder voll Party-Modus oder einfach lame und gemütlich. Deshalb bin ich ganz gerne in meinem Bett. Aber sonst bin ich gerne unterwegs, z.B. im «Elysia» oder im «Rouine».
Denis: Ich gehe auch ganz gerne ins «Flore». Und sonst am liebsten auf den Markt oder in ein gutes Bio-Lädeli. Der schönste Markt ist der in St. Louis oder beim Wettsteinplatz.

Was macht eure Arbeit besonders spannend und was findet ihr eher anstrengend?
Stéphanie: Wir haben extrem tolle Kund*innen. Es sind viele kreative Leute und das ist eine Bereicherung für uns. Ich möchte nicht angeben, aber man zieht ja bekanntlich das an, was man selbst ist. Wir schätzen das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, sehr.
Anis: Sie geben uns die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten und uns ausleben zu dürfen. Die Beratung und der Austausch mit den Kund*innen sind sehr bereichernd, das macht wirklich sehr viel aus.
Denis: Die Arbeit ist ausserdem sehr abwechslungsreich, in dem Sinne, dass jede Person einzigartig ist. Und trotzdem sieht man unmittelbar nach einer kurzen Zeit ein Ergebnis der eigenen Arbeit. Zudem schätze ich auch, dass man die Arbeit am Abend nicht mit nach Hause nimmt. Es ist jedoch auch kein einfacher Job, der physische Aspekt ist zum Teil sehr anstrengend, man muss sich immer wieder daran erinnern, keine komische Haltung einzunehmen.
Stéphanie: Schwierig am Job ist auch, dass man sich total auf die Kund*innen einlassen muss und sehr exponiert ist. Man bekommt immer alles mit und kann sich während der Arbeit nicht zurückziehen.


Anna: Das kann ich alles bestätigen. Für mich war vor allem der Aspekt des Exponiert-Seins etwas Neues, mit dem ich erst lernen musste umzugehen, da ich zuvor meistens in einem Büro gearbeitet habe. Aber man gewöhnt sich schnell daran. Hat mal jemand einen schlechten Tag, nimmt man diese Energie des Gegenübers selbst auch auf. Aber es ist wirklich schön, in einer kurzen Zeit das Ergebnis der eigenen Arbeit zu sehen. Dabei konfrontiere ich mich jedoch auch mit dem Anspruch an die eigene Leistung. Das ist für mich ein grosser Prozess, weil ich es noch nicht so lange mache. Teil dieses Prozesses ist es auch immer, ein wenig besser zu werden. Diese Auseinandersetzung mit meiner Leistung und meinen Zielen gibt mir sehr viel Energie, ist aber teilweise auch sehr anstrengend.

Wenn das «Banan» ein Drei-Gang Menü wäre, was gäbe es zu essen?
Denis: Also, es gäbe sicherlich Prosecco zum Trinken.
Anis: Und zum Essen gibt es Gipfeli, Bouillon-Suppe und eine Banane.
Stéphanie: Das sind so etwa die Dinge, die oft bei uns auf dem Tisch liegen.
Anna: Auf jeden Fall etwas, das man schnell zwischen den Terminen essen kann, weil wir meistens kaum Zeit haben, uns in Ruhe hinzusetzen.

Was inspiriert euch für eure Arbeit?
Anis: Mich inspiriert sehr, dass ich jetzt auf dem Land wohne und mich von der Arbeit in der Stadt distanzieren kann.
Stéphanie: Mich inspirieren vor allem die Menschen, die zu uns kommen. Sich auf sie einzulassen und etwas auszuprobieren, finde ich immer wieder sehr schön. Und sonst schaue ich mir gerne auf Reisen oder in den Ferien die Leute an und versuche mich vom Vibe des Ortes inspirieren zu lassen und etwas davon mitzunehmen.
Denis: Ich fühle mich immer wieder inspiriert durch das Nachtleben, sei es durch die Leute selbst, durch Musik, Mode oder Frisuren, die ich dort sehe.

Anna: Bei mir sind es schon eher Bilder von Designs oder von neuen Techniken, die mich in meiner Arbeit inspirieren. Das ist jedoch oft eine endlose Suche und Inspiration. Ich könnte stundenlang durch Instagram scrollen, das gehört für mich zum Prozess dazu, meinen eigenen Stil zu finden. Weitere Inspirationen finde ich auch in der Kunst oder ganz konkret durch ein Outfit, ein Muster, oder eine Tapete. Daraus versuche ich dann ein Design zu abstrahieren und auf dem Nagel umzusetzen. Das ist oft ein sehr langer Prozess, aber meistens kommt genau das dann sehr gut an und ich merke, dass das am meisten ‹ich selbst› bin.
Welche Songs laufen bei euch in Dauerschleife?
Denis: Ich bin meistens früh dran und höre zurzeit einen Track von Sault im Repeat-Modus.
Anna: Bei mir läuft meistens GDS.FM.
Stéphanie: Wenn ich als erste hier bin, höre ich oft Colors Studios.
Anis: Und ich bin eigentlich nie als erste da und höre daher immer das, was halt gerade läuft.
Wie wär’s mal mit...
...«Banan»?!

Vielen Dank für das Gespräch, Anis, Denis, Stéphanie und Anna und die Einblicke in eure Arbeit, die ihr mir vermittelt habt. Wer sich also gerne wieder mal in inspirierender Umgebung die Nägel mit trendigen Designs oder die Haare mit einem mutigen Haarschnitt auffrischen lassen möchte, sollte einen Besuch im «Banan» nicht verpassen.
_
von Laura Schläpfer
am 01.11.2021
Fotos
© Monir Sahili für Wie wär's mal mit
Korrektorat
Leonie Häsler, Judith Nyfeler
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«LESC»: Im Gespräch mit Schweizer Designerin Laura Sanchez
Hinter dem Modelabel «LESC» steckt Laura Sanchez aus Basel. Die gelernte Schneiderin zog 2017 nach München, um ihren Abschluss an der «Meisterschule für Mode» zu machen. Was ihre Mode inspiriert, wo sie in München anzutreffen ist und wer sie ist? Das erfahrt ihr im Gespräch.
![]()
Liebe Laura, wer bist du und was treibt dich im Leben an?
Ich bin 26 und in Basel geboren. Aufgewachsen bin ich in Reinach mit meiner Mutter aus der Schweiz und zwei älteren Geschwistern. Mein Vater ist Mexikaner, sodass ich verschiedene kulturelle Einflüsse mit auf den Weg bekam. Diese Einblicke und Differenzen, zwischen den beiden Kulturen haben mich geprägt und geformt.
![]()
Weshalb bist du von Basel nach München gezogen?
Ich bin 2017 nach München gezogen, nachdem ich 2015 in der Schweiz die Ausbildung als Schneiderin abgeschlossen hatte, um den Meister*innenabschluss im Masschneiderei-Handwerk zu absolvieren. Danach habe ich noch ein Designjahr angehängt. Auf die Deutsche Meisterschule für Mode hat mich eine Freundin aufmerksam gemacht. Dafür entschieden habe ich mich, da sie in Vollzeit zwischen dem praktischen, handwerklichen und der Theorie aufgegliedert ist und ich dadurch viel lernen konnte.
![]()
Wann und weshalb hast du dein eigenes Label «LESC» gegründet?
Etwas Eigenes zu erschaffen, war schon immer mein Antrieb.
Ich möchte meine Ideen, Inspirationen und das Handwerk in meinen Kreationen frei entfalten können. Vom Design, über die Produktion bis zum fertigen Teil, alles aus einer Hand und für die Kund*innen greifbar. Offiziell habe ich mein eigenes Label «LESC» 2021 gegründet, die Eröffnung des Ateliers mit eigener kleiner Produktionsstätte sowie Verkaufsraum in München an der Enhuberstrasse 5, findet am Samstag, 18. September 2021 statt.
![]()
«LESC» – weshalb der Name?
«LESC» sind meine Initialen Laura Elisa Sanchez Camacho, ich denke das ist sehr passend. Der Name ist reduziert und nicht aufdringlich. Zu Beginn ist nicht klar, was oder wer, dahinter steht und das gefällt mir. Das nicht ich als Person im Vordergrund stehe, sondern «LESC» als Label und das, was daraus erschaffen wird.
![]()
Beschreibe «LESC» in 3 Worten.
Wertschätzung, grenzenlos, clean.
Wie kommst du durchs Leben? Kannst du von deiner Mode leben?
Da ich das Label erst vor kurzem gegründet habe und die Eröffnung des Ateliers noch bevorsteht, kann ich noch nicht davon leben. Ich denke es wird schwierig, sich in einer Branche durchzusetzen, in der Billigkaufhäuser und Händler*innen den Markt dominieren. Aber ich bleibe beharrlich und bis dahin habe ich noch eine Nebentätigkeit in einem Laden für Denim- und Heritagebekleidung. Das Ideale Leben sähe für mich so aus, dass ich diese freie und selbstbestimmte Art zu arbeiten beibehalten kann. Das meine Arbeit verstanden und wertgeschätzt wird und natürlich, dass ich davon leben kann.
![]()
Wo kaufst du deine Kleider am liebsten ein, und weshalb?
Einiges nähe ich mir selbst, wenn die Zeit reicht, oder kaufe Secondhand ein. Ich habe gelernt, dass eine kleine Garderobe mit Teilen, die ich gerne trage wichtiger und befreiender ist, als einen überfüllten Kleiderschrank mit Dingen, die ich nicht brauche.
![]()
Welche Werte vertrittst du, wenn es um die Produktion deiner Mode geht? Wie stehst du zur Modewelt allgemein?
Das ist eine Frage, mit der ich mich sehr oft auseinandersetze. Ich entwerfe und produziere die Kollektionen in kleinen Serien im Atelier. Das ermöglicht mir, die Aspekte der Nachhaltigkeit und der Qualität zu berücksichtigen. Die Personen die bei mir einkaufen, können sehen, wie die Dinge hergestellt werden. «LESC» wird dadurch auch greifbarer. Ich finde es schade, dass für meinen Beruf oder in der Branche oft das Verständnis und die Wertschätzung fehlt. Fast Fashion fördert den Konsum der Menschen und viele setzen sich leider gar nicht damit auseinander, was sie da gerade tragen und was diese Schnelllebigkeit für Konsequenzen mit sich bringt. Meine Intention mit «LESC» ist es, langlebige Teile mit Anspruch an Verarbeitung und Qualität zu kreiiren. Was ich aber gut finde ist, dass die Mode im Wandel ist. Es werden langsam mehr Menschen inkludiert. Mode fängt an diverser zu werden und Grenzen zu brechen.
![]()
Wer sind deine persönliche Stilikonen und weshalb?
Es gibt vieles was mich visuell inspiriert wie z.B. Interior, Architektur oder die Natur. In Zukunft möchte ich auch soziale und politische Themen in meine Arbeit einfliessen lassen. Menschen inspirieren mich ständig, sei es Leute, die ich persönlich kenne oder nicht. Ich mag es, wenn eine Person die Hingabe zu etwas hat, aber auch die Geschichte oder die Art einer Person kann sehr inspirierend sein. Jil Sander gefällt mir als Modelabel aufgrund der schlichten Klarheit und einer Ähstetik, die mich überzeugt.
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, ausser Regen, was wäre das?
Hm... Chips! Die mögen doch alle und wenn die auf den Kopf fallen tut es nicht weh. Ausserdem gibt’s nie genug davon.
Wie wär’s mal mit...
...einer Tüte Chips? (lacht)
![]()
Wir danken Laura für ihre Zeit und wünschen auf jeden Fall viel Erfolg!
_
von Ana Brankovic
am 30.08.2021
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Hinter dem Modelabel «LESC» steckt Laura Sanchez aus Basel. Die gelernte Schneiderin zog 2017 nach München, um ihren Abschluss an der «Meisterschule für Mode» zu machen. Was ihre Mode inspiriert, wo sie in München anzutreffen ist und wer sie ist? Das erfahrt ihr im Gespräch.
Liebe Laura, wer bist du und was treibt dich im Leben an?
Ich bin 26 und in Basel geboren. Aufgewachsen bin ich in Reinach mit meiner Mutter aus der Schweiz und zwei älteren Geschwistern. Mein Vater ist Mexikaner, sodass ich verschiedene kulturelle Einflüsse mit auf den Weg bekam. Diese Einblicke und Differenzen, zwischen den beiden Kulturen haben mich geprägt und geformt.
Weshalb bist du von Basel nach München gezogen?
Ich bin 2017 nach München gezogen, nachdem ich 2015 in der Schweiz die Ausbildung als Schneiderin abgeschlossen hatte, um den Meister*innenabschluss im Masschneiderei-Handwerk zu absolvieren. Danach habe ich noch ein Designjahr angehängt. Auf die Deutsche Meisterschule für Mode hat mich eine Freundin aufmerksam gemacht. Dafür entschieden habe ich mich, da sie in Vollzeit zwischen dem praktischen, handwerklichen und der Theorie aufgegliedert ist und ich dadurch viel lernen konnte.
Wann und weshalb hast du dein eigenes Label «LESC» gegründet?
Etwas Eigenes zu erschaffen, war schon immer mein Antrieb.
Ich möchte meine Ideen, Inspirationen und das Handwerk in meinen Kreationen frei entfalten können. Vom Design, über die Produktion bis zum fertigen Teil, alles aus einer Hand und für die Kund*innen greifbar. Offiziell habe ich mein eigenes Label «LESC» 2021 gegründet, die Eröffnung des Ateliers mit eigener kleiner Produktionsstätte sowie Verkaufsraum in München an der Enhuberstrasse 5, findet am Samstag, 18. September 2021 statt.
«LESC» – weshalb der Name?
«LESC» sind meine Initialen Laura Elisa Sanchez Camacho, ich denke das ist sehr passend. Der Name ist reduziert und nicht aufdringlich. Zu Beginn ist nicht klar, was oder wer, dahinter steht und das gefällt mir. Das nicht ich als Person im Vordergrund stehe, sondern «LESC» als Label und das, was daraus erschaffen wird.
Beschreibe «LESC» in 3 Worten.
Wertschätzung, grenzenlos, clean.
Wie kommst du durchs Leben? Kannst du von deiner Mode leben?
Da ich das Label erst vor kurzem gegründet habe und die Eröffnung des Ateliers noch bevorsteht, kann ich noch nicht davon leben. Ich denke es wird schwierig, sich in einer Branche durchzusetzen, in der Billigkaufhäuser und Händler*innen den Markt dominieren. Aber ich bleibe beharrlich und bis dahin habe ich noch eine Nebentätigkeit in einem Laden für Denim- und Heritagebekleidung. Das Ideale Leben sähe für mich so aus, dass ich diese freie und selbstbestimmte Art zu arbeiten beibehalten kann. Das meine Arbeit verstanden und wertgeschätzt wird und natürlich, dass ich davon leben kann.
Wo kaufst du deine Kleider am liebsten ein, und weshalb?
Einiges nähe ich mir selbst, wenn die Zeit reicht, oder kaufe Secondhand ein. Ich habe gelernt, dass eine kleine Garderobe mit Teilen, die ich gerne trage wichtiger und befreiender ist, als einen überfüllten Kleiderschrank mit Dingen, die ich nicht brauche.
Welche Werte vertrittst du, wenn es um die Produktion deiner Mode geht? Wie stehst du zur Modewelt allgemein?
Das ist eine Frage, mit der ich mich sehr oft auseinandersetze. Ich entwerfe und produziere die Kollektionen in kleinen Serien im Atelier. Das ermöglicht mir, die Aspekte der Nachhaltigkeit und der Qualität zu berücksichtigen. Die Personen die bei mir einkaufen, können sehen, wie die Dinge hergestellt werden. «LESC» wird dadurch auch greifbarer. Ich finde es schade, dass für meinen Beruf oder in der Branche oft das Verständnis und die Wertschätzung fehlt. Fast Fashion fördert den Konsum der Menschen und viele setzen sich leider gar nicht damit auseinander, was sie da gerade tragen und was diese Schnelllebigkeit für Konsequenzen mit sich bringt. Meine Intention mit «LESC» ist es, langlebige Teile mit Anspruch an Verarbeitung und Qualität zu kreiiren. Was ich aber gut finde ist, dass die Mode im Wandel ist. Es werden langsam mehr Menschen inkludiert. Mode fängt an diverser zu werden und Grenzen zu brechen.
Wer sind deine persönliche Stilikonen und weshalb?
Es gibt vieles was mich visuell inspiriert wie z.B. Interior, Architektur oder die Natur. In Zukunft möchte ich auch soziale und politische Themen in meine Arbeit einfliessen lassen. Menschen inspirieren mich ständig, sei es Leute, die ich persönlich kenne oder nicht. Ich mag es, wenn eine Person die Hingabe zu etwas hat, aber auch die Geschichte oder die Art einer Person kann sehr inspirierend sein. Jil Sander gefällt mir als Modelabel aufgrund der schlichten Klarheit und einer Ähstetik, die mich überzeugt.
Wenn es etwas vom Himmel regnen könnte, ausser Regen, was wäre das?
Hm... Chips! Die mögen doch alle und wenn die auf den Kopf fallen tut es nicht weh. Ausserdem gibt’s nie genug davon.
Wie wär’s mal mit...
...einer Tüte Chips? (lacht)
Wir danken Laura für ihre Zeit und wünschen auf jeden Fall viel Erfolg!
_
von Ana Brankovic
am 30.08.2021
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Studio Moono» Basel: Im Gespräch mit Pati Grabowicz und Celine Pereira
Das Wort «Mono» kommt aus dem Griechischen und «mónos» bedeutet soviel wie Unikat. Weshalb «Studio Moono» jedoch mit zwei «o» geschrieben wird und wie der Vorkurs an der Schule für Gestaltung in Basel sowie die Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW die beiden in Basel tätigen Gestalter*innen Pati Grabowicz und Celine Pereira unter diesem Namen zusammengeführt haben, erzählen uns die beiden im Gespräch.
![]()
Liebe Celine, liebe Pati, wer seid ihr, was ist eure grösste Macke?
Beide: Kennengelernt haben wir uns im Vorkurs 2013 an der Schule für Gestaltung in Basel und studierten danach gemeinsam Visuelle Kommunikation an der HGK. Wirklich zusammengeführt hat uns aber schlussendlich die gemeinsame Leidenschaft für die Gestaltung, zahlreiche Stunden im Fotostudio, der Buchbinderei und in der Siebdruckwerkstatt. Oft war der Pizzakurier die letzte Anlaufstelle, wenn uns um 2 Uhr am Morgen vor lauter Werken dann doch plötzlich das Hungergefühl überrannte. Das ist übrigens auch heute noch eine Macke von uns.
Celine: Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Basel und war schon als Kind kreativ unterwegs. Inspiriert hat mich damals meine Grossmutter, die Malerin war. Ich freute mich jedes Mal, wenn sie ihren Holzschrank mit ihren Malutensilien öffnete und ich mit ihr malen durfte. Das war immer etwas ganz Besonderes. Wirklich zum Beruf wurde die Gestaltung erst nach dem Gymnasium in Liestal, als ich ein einjähriges Praktikum als Goldschmiedin absolvierte und danach den Vorkurs und Vorkurs Plus an der Schule für Gestaltung in Basel besuchte. Da wusste ich, dass ich am richtigen Ort und im richtigen Umfeld bin. 2018 habe ich das Studium Visuelle Kommunikation an der HGK abgeschlossen. Heute bin ich sehr vielseitig unterwegs. Neben den gestalterischen Projekten vom «Studio Moono» arbeite ich in der Eventbranche und im Tanzstudio «Movimento» in Basel.
![]()
Pati: Ich bin Pati, komme ursprünglich aus Herten, aus dem im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Dort ging ich mega lange zur Jugendfeuerwehr, fing meine Ausbildung als Krankenschwester an, traf dort Leonardo DiCaprio im Krankenhauslift und sonst fuhr ich sehr viel Motorrad und habe immer gerne durch die Linse einer Kamera geschaut. Das Thema Gestaltung wurde dann erst in der Schweiz zu meinem geliebten Alltag. Gemeinsam mit Celine besuchte ich den zweijährigen Vorkurs in Basel, lernte ganz tolle Menschen kennen und konnte mich in all den wunderbaren analogen Techniken und Handarbeiten in Tiefdruck, Fotografie und Buchbinderei austoben. Die Schweizer Grafik trat in meinen Fokus, das Studium Visuelle Kommunikation an der HGK FHNW wurde zu einem neuen Kapitel mit wunderbaren Begegnungen und dem Schwerpunkt Bild zu meinem geliebten Hauptfach. Im Anschluss habe ich einen sechsmonatigen Zwischenstopp bei Ludovic Balland eingelegt und arbeite derzeit bei der Fondation Beyeler als Assistentin in der digitalen Kommunikation. Seit Januar 2020 bin ich nun auch stolze Besitzerin eines Gestaltungsstudios, mit einer Fotoecke. Mein Schwerpunkt ist das Bild, die Fotografie. Meine Liebe hege ich zu Fotoapparaten jeglicher Art und den Blitzgeräten.
![]()
Was ist «Studio Moono» und wie ist es entstanden?
Beide: Auf dem Papier haben wir uns im Januar 2020 gegründet, aber bereits vorher gemeinsame Projekte in unseren Wohnzimmern realisiert. Uns fiel auf: Wir brauchen einen Platz zur Entfaltung. Das «Studio Moono» ist somit ein Ort für kreative Köpfe geworden, ein Raum, welchen wir nutzen, um zusammenzukommen und Projekte im Bereich der visuellen Kommunikation zu kreieren, ein Treffpunkt für Gestalter*innen und ein Platz an dem Kreativität sich ganz entfalten kann. Den Raum möchten wir im Übrigen nicht nur für uns allein nutzen; Mischa Hurdes, begnadete Illustratorin, ist dazugestossen, mit ihr besuchten wir damals auch den Vorkurs an der Schule für Gestaltung Basel. So freuen wir uns immer über Zuwachs von Selbstschaffenden, das regt den Austausch an, lädt zum Biertrinken ein und führt zu tollen Gesprächen.
![]()
«Studio Moono» – weshalb der Name?
Beide: Für den Namen und die Gestaltung haben wir schon ein Weilchen gebraucht bis es an einem z’Nacht und bei gutem Wein irgendwann gefunkt hat. Viel hatte auch mit der Schrift zu tun. Uns hat die Kombination aus Bedeutung, Sprache und Form sehr gut gefallen. Das Wort «Mono» kommt aus dem Griechischen und «mónos» bedeutet in Wortzusammensetzungen soviel wie: einzig, einzeln, ein Unikat. Die angedeutete Doppelung des Buchstaben «o» sind wir Beide, als zwei einzelne Gestalterinnen mit ihren eigenen Schwerpunkten und Stärken, fusionieren jedoch gleichzeitig und ergänzen uns in den Projekten, an denen wir gemeinsam arbeiten.
![]()
Für wen oder was habt ihr bereits Konzepte und visuelle Erzeugnisse erstellt? Habt ihr einen Lieblingsauftrag?
Beide: Ob ein Magazin, ein Plakat oder eine Website, unsere Aufträge sind sehr vielfältig und decken ein breites gestalterisches Spektrum ab. Das Schöne ist, dass jedes Projekt einen neuen visuellen und thematischen Aspekt mit sich bringt. Wir lernen übrigens auch immer sehr viel von unseren Kunden – beispielsweise über Augenyoga oder die Zubereitung von orientalischen Gerichten.
Am Liebsten kreieren wir medienübergreifende Konzepte und verbinden unsere Gestaltung im analogen sowie im digitalen Bereich. So facettenreich wie unsere Outputs sind auch unsere Kunden: Neben kulturellen Projekten für Museen, Eventlokale und Institutionen haben wir unter anderem auch Privatkunden aus den Bereichen Produktdesign, Fashion, Möbelschreiner, Yoga, Augenoptik und Catering.
![]()
Was wäre euer Traumauftrag?
Pati: Ich selbst würde gerne für diverse Magazine fotografieren wollen. Oder gar als Reporterin um die Welt reisen. Ein Porträt von Benedict Cumberbatch zu schiessen, wäre grandios.
Celine: Ich wünsche mir ein Buchprojekt von eine*r Fotograf*in. Die Semiotik beim Zusammenstellen von Fotos finde ich unglaublich spannend. Ein weiterer Wunsch von mir ist, wieder einmal selber in einer Druckwerkstatt zu stehen. Das handwerkliche Schaffen im Siebdruck, Hockdruck und Tiefdruck finde ich wunderbar.
![]()
Beschreibt eure Arbeitsweise in drei treffenden Worten.
Pati: Neugierig, hingebungsvoll, perfektionistisch
Celine: Experimentell, passioniert, medienübergreifend
Worauf legt ihr persönlich Wert bei Grafikdesign und kreativen Prozessen?
Beide: Wir achten sehr auf Details und denken oft über andere Möglichkeiten nach, um nicht die erstbeste Gestaltung zu akzeptieren. Wir geben uns gerne Zeit und überdenken Designs. Mit Abstand zur eigenen Gestaltung und zur kritischen Beobachtung kommen frische Ideen und lassen uns in unserer Kreativität wachsen. Natürlich ist Zeit leider oft eine Seltenheit im täglichen Geschäft. Druck und Abgabestress stehen dem Entstehungsprozess gegenüber.
![]()
![]()
Mit wem und mit welchen Inhalten arbeitet ihr am liebsten?
Beide: Inhaltlich arbeiten wir mit Vorliebe im kulturellen Bereich. Gestalterisch haben wir in der Kultur gewöhnlich mehr Spielraum, innovative Ideen und der Mut zu besonderen Designs sind häufiger akzeptiert oder gar angesehen.
Pati: Ich arbeite aus diesem Grund gerne mit Celine zusammen, sie bringt eine ganz eigene und angenehme Ruhe in unsere Arbeit mit und verhilft mir aus meiner Unruhe heraus, immer nach dem Besten zu streben. Das schätze ich sehr.
Celine: Pati teilt meine Leidenschaft für Gestaltung. Sie weiss, dass es auch mal Extrarunden und Überstunden braucht bis eine Projekt abgeschlossen werden kann. Ausserdem wird es mit ihrer humorvollen Art nie langweilig. Ich habe bereits unzählige spektakuläre Videos von Pati, welche zusammengeschnitten mindestens die Länge eines Spielfilms einnehmen.
![]()
Wo in Basel treibt ihr euch am liebsten rum, wenn ihr gerade mal nicht bei «Studio Moono» tätig seid?
Celine: Ich geniesse die kulinarische Vielfalt der Restaurants in Basel. Ein Stück Pizza bei «VITO» geht immer! Im Sommer verbringe ich meine Abende gerne mit tollen Menschen, guter Musik und einem Bier am Rhein. Ein absolutes Highlight ist mein Arbeitsweg in Basel. Den kann ich nämlich schwimmend im Rhein machen, wenn mir danach ist.
Pati: Der Rhein ist mein absoluter Lieblingsort, liebend gerne kombiniere ich den Rheinspaziergang mit einem Besuch in der «Cargo Bar». Dabei sehe ich gerne den fliessenden Wassermengen zu. Immer eine Richtung, das beruhigt, im Sommer sorgt es für Abkühlung. Was kann es Schöneres geben?
![]()
Die Schweiz als Grafiklandschaft: Beschreibt diese als ein essbares Menü.
Pati: Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus. Die Schweiz als Grafiklandschaft ist retro und einfach gut so wie es war, ist und hoffentlich auch bleibt. Ein klassisches Gericht, in der Schlichtheit und Nüchternheit kaum zu übertreffen, vom Handwerk perfekt. Ein Gericht, welches sich gut vermarkten lässt. Ein Grundrezept, nahezu perfekt und super fein und dafür braucht es nur drei Zutaten: Präzision, Schlichtheit und Eleganz.
Celine: Gemüselasagne, vielschichtig und bunt.
![]()
![]()
Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre, welches wäre das und weshalb?
Pati: Ein Tier wie der Bär, wäre für mich das Jahr 2020. Wenn auch schwierig, wem möchte man dieses Jahr schon als Charakter oder Eigenschaft zuordnen? Und doch charakterisiert der Bär leider ein allgemeines Gesamtgefühl: Der Bär liebt seine Rituale und ist ein ruhender Pol, lebt seine Ungestörtheit und braucht sein eigenes Tempo, um sich entfalten zu können. Denn wehe er fühlt sich getrieben. In seiner Ruhe liegen Stärke und Geschicklichkeit und nicht Langsamkeit und Behäbigkeit. Nimmt man dem Bären diese Ruhe, wird er schnell und aggressiv und holt dich vom Baum, auf den du dich geflüchtet hast. Der Bär ist ein Raubtier, das jedoch meist friedlich durch die Welt spaziert.
Celine: Das Jahr 2020 ist für mich so unvorhersehbar wir die Farben eines Chamäleons und so medienfokussiert wie der Rundblick des Chamäleons.
![]()
Wenn ihr zehn Jahre in die Zukunft schaut, was seht ihr?
Pati: Mit Freude habe ich meine Kamerasammlung erweitern können, tolle Fotoprojekte realisiert, einige Workshops in der Street Photography gegeben, meine eigene kleine Ausstellung gefeiert und eine Fotocommunity gegründet.
![]()
Celine: Eine eigene Druckwerkstatt? Ein Projekt in Portugal? Vielleicht aber auch etwas ganz anderes.
Wie wär’s mal mit…
...gutem Design oder erfrischenden Fotos? Dann meldet euch, wir freuen uns.
![]()
Wir danken Celine und Pati für die spannenden Einblicke in ihre Freundschaft und Zusammenarbeit sowie für die Gestaltung unseres Jahresmagazins im 2020 zum Thema «Gutes Klima». Auf viele weitere tolle Projekte.
_
von Ana Brankovic
am 28.12.2020
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
© Diverse Arbeiten: Studio Moono
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Das Wort «Mono» kommt aus dem Griechischen und «mónos» bedeutet soviel wie Unikat. Weshalb «Studio Moono» jedoch mit zwei «o» geschrieben wird und wie der Vorkurs an der Schule für Gestaltung in Basel sowie die Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW die beiden in Basel tätigen Gestalter*innen Pati Grabowicz und Celine Pereira unter diesem Namen zusammengeführt haben, erzählen uns die beiden im Gespräch.
Liebe Celine, liebe Pati, wer seid ihr, was ist eure grösste Macke?
Beide: Kennengelernt haben wir uns im Vorkurs 2013 an der Schule für Gestaltung in Basel und studierten danach gemeinsam Visuelle Kommunikation an der HGK. Wirklich zusammengeführt hat uns aber schlussendlich die gemeinsame Leidenschaft für die Gestaltung, zahlreiche Stunden im Fotostudio, der Buchbinderei und in der Siebdruckwerkstatt. Oft war der Pizzakurier die letzte Anlaufstelle, wenn uns um 2 Uhr am Morgen vor lauter Werken dann doch plötzlich das Hungergefühl überrannte. Das ist übrigens auch heute noch eine Macke von uns.
Celine: Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Basel und war schon als Kind kreativ unterwegs. Inspiriert hat mich damals meine Grossmutter, die Malerin war. Ich freute mich jedes Mal, wenn sie ihren Holzschrank mit ihren Malutensilien öffnete und ich mit ihr malen durfte. Das war immer etwas ganz Besonderes. Wirklich zum Beruf wurde die Gestaltung erst nach dem Gymnasium in Liestal, als ich ein einjähriges Praktikum als Goldschmiedin absolvierte und danach den Vorkurs und Vorkurs Plus an der Schule für Gestaltung in Basel besuchte. Da wusste ich, dass ich am richtigen Ort und im richtigen Umfeld bin. 2018 habe ich das Studium Visuelle Kommunikation an der HGK abgeschlossen. Heute bin ich sehr vielseitig unterwegs. Neben den gestalterischen Projekten vom «Studio Moono» arbeite ich in der Eventbranche und im Tanzstudio «Movimento» in Basel.
Pati: Ich bin Pati, komme ursprünglich aus Herten, aus dem im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Dort ging ich mega lange zur Jugendfeuerwehr, fing meine Ausbildung als Krankenschwester an, traf dort Leonardo DiCaprio im Krankenhauslift und sonst fuhr ich sehr viel Motorrad und habe immer gerne durch die Linse einer Kamera geschaut. Das Thema Gestaltung wurde dann erst in der Schweiz zu meinem geliebten Alltag. Gemeinsam mit Celine besuchte ich den zweijährigen Vorkurs in Basel, lernte ganz tolle Menschen kennen und konnte mich in all den wunderbaren analogen Techniken und Handarbeiten in Tiefdruck, Fotografie und Buchbinderei austoben. Die Schweizer Grafik trat in meinen Fokus, das Studium Visuelle Kommunikation an der HGK FHNW wurde zu einem neuen Kapitel mit wunderbaren Begegnungen und dem Schwerpunkt Bild zu meinem geliebten Hauptfach. Im Anschluss habe ich einen sechsmonatigen Zwischenstopp bei Ludovic Balland eingelegt und arbeite derzeit bei der Fondation Beyeler als Assistentin in der digitalen Kommunikation. Seit Januar 2020 bin ich nun auch stolze Besitzerin eines Gestaltungsstudios, mit einer Fotoecke. Mein Schwerpunkt ist das Bild, die Fotografie. Meine Liebe hege ich zu Fotoapparaten jeglicher Art und den Blitzgeräten.

Was ist «Studio Moono» und wie ist es entstanden?
Beide: Auf dem Papier haben wir uns im Januar 2020 gegründet, aber bereits vorher gemeinsame Projekte in unseren Wohnzimmern realisiert. Uns fiel auf: Wir brauchen einen Platz zur Entfaltung. Das «Studio Moono» ist somit ein Ort für kreative Köpfe geworden, ein Raum, welchen wir nutzen, um zusammenzukommen und Projekte im Bereich der visuellen Kommunikation zu kreieren, ein Treffpunkt für Gestalter*innen und ein Platz an dem Kreativität sich ganz entfalten kann. Den Raum möchten wir im Übrigen nicht nur für uns allein nutzen; Mischa Hurdes, begnadete Illustratorin, ist dazugestossen, mit ihr besuchten wir damals auch den Vorkurs an der Schule für Gestaltung Basel. So freuen wir uns immer über Zuwachs von Selbstschaffenden, das regt den Austausch an, lädt zum Biertrinken ein und führt zu tollen Gesprächen.
«Studio Moono» – weshalb der Name?
Beide: Für den Namen und die Gestaltung haben wir schon ein Weilchen gebraucht bis es an einem z’Nacht und bei gutem Wein irgendwann gefunkt hat. Viel hatte auch mit der Schrift zu tun. Uns hat die Kombination aus Bedeutung, Sprache und Form sehr gut gefallen. Das Wort «Mono» kommt aus dem Griechischen und «mónos» bedeutet in Wortzusammensetzungen soviel wie: einzig, einzeln, ein Unikat. Die angedeutete Doppelung des Buchstaben «o» sind wir Beide, als zwei einzelne Gestalterinnen mit ihren eigenen Schwerpunkten und Stärken, fusionieren jedoch gleichzeitig und ergänzen uns in den Projekten, an denen wir gemeinsam arbeiten.
Für wen oder was habt ihr bereits Konzepte und visuelle Erzeugnisse erstellt? Habt ihr einen Lieblingsauftrag?
Beide: Ob ein Magazin, ein Plakat oder eine Website, unsere Aufträge sind sehr vielfältig und decken ein breites gestalterisches Spektrum ab. Das Schöne ist, dass jedes Projekt einen neuen visuellen und thematischen Aspekt mit sich bringt. Wir lernen übrigens auch immer sehr viel von unseren Kunden – beispielsweise über Augenyoga oder die Zubereitung von orientalischen Gerichten.
Am Liebsten kreieren wir medienübergreifende Konzepte und verbinden unsere Gestaltung im analogen sowie im digitalen Bereich. So facettenreich wie unsere Outputs sind auch unsere Kunden: Neben kulturellen Projekten für Museen, Eventlokale und Institutionen haben wir unter anderem auch Privatkunden aus den Bereichen Produktdesign, Fashion, Möbelschreiner, Yoga, Augenoptik und Catering.

Was wäre euer Traumauftrag?
Pati: Ich selbst würde gerne für diverse Magazine fotografieren wollen. Oder gar als Reporterin um die Welt reisen. Ein Porträt von Benedict Cumberbatch zu schiessen, wäre grandios.
Celine: Ich wünsche mir ein Buchprojekt von eine*r Fotograf*in. Die Semiotik beim Zusammenstellen von Fotos finde ich unglaublich spannend. Ein weiterer Wunsch von mir ist, wieder einmal selber in einer Druckwerkstatt zu stehen. Das handwerkliche Schaffen im Siebdruck, Hockdruck und Tiefdruck finde ich wunderbar.
Beschreibt eure Arbeitsweise in drei treffenden Worten.
Pati: Neugierig, hingebungsvoll, perfektionistisch
Celine: Experimentell, passioniert, medienübergreifend
Worauf legt ihr persönlich Wert bei Grafikdesign und kreativen Prozessen?
Beide: Wir achten sehr auf Details und denken oft über andere Möglichkeiten nach, um nicht die erstbeste Gestaltung zu akzeptieren. Wir geben uns gerne Zeit und überdenken Designs. Mit Abstand zur eigenen Gestaltung und zur kritischen Beobachtung kommen frische Ideen und lassen uns in unserer Kreativität wachsen. Natürlich ist Zeit leider oft eine Seltenheit im täglichen Geschäft. Druck und Abgabestress stehen dem Entstehungsprozess gegenüber.
Mit wem und mit welchen Inhalten arbeitet ihr am liebsten?
Beide: Inhaltlich arbeiten wir mit Vorliebe im kulturellen Bereich. Gestalterisch haben wir in der Kultur gewöhnlich mehr Spielraum, innovative Ideen und der Mut zu besonderen Designs sind häufiger akzeptiert oder gar angesehen.
Pati: Ich arbeite aus diesem Grund gerne mit Celine zusammen, sie bringt eine ganz eigene und angenehme Ruhe in unsere Arbeit mit und verhilft mir aus meiner Unruhe heraus, immer nach dem Besten zu streben. Das schätze ich sehr.
Celine: Pati teilt meine Leidenschaft für Gestaltung. Sie weiss, dass es auch mal Extrarunden und Überstunden braucht bis eine Projekt abgeschlossen werden kann. Ausserdem wird es mit ihrer humorvollen Art nie langweilig. Ich habe bereits unzählige spektakuläre Videos von Pati, welche zusammengeschnitten mindestens die Länge eines Spielfilms einnehmen.
Wo in Basel treibt ihr euch am liebsten rum, wenn ihr gerade mal nicht bei «Studio Moono» tätig seid?
Celine: Ich geniesse die kulinarische Vielfalt der Restaurants in Basel. Ein Stück Pizza bei «VITO» geht immer! Im Sommer verbringe ich meine Abende gerne mit tollen Menschen, guter Musik und einem Bier am Rhein. Ein absolutes Highlight ist mein Arbeitsweg in Basel. Den kann ich nämlich schwimmend im Rhein machen, wenn mir danach ist.
Pati: Der Rhein ist mein absoluter Lieblingsort, liebend gerne kombiniere ich den Rheinspaziergang mit einem Besuch in der «Cargo Bar». Dabei sehe ich gerne den fliessenden Wassermengen zu. Immer eine Richtung, das beruhigt, im Sommer sorgt es für Abkühlung. Was kann es Schöneres geben?
Die Schweiz als Grafiklandschaft: Beschreibt diese als ein essbares Menü.
Pati: Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus. Die Schweiz als Grafiklandschaft ist retro und einfach gut so wie es war, ist und hoffentlich auch bleibt. Ein klassisches Gericht, in der Schlichtheit und Nüchternheit kaum zu übertreffen, vom Handwerk perfekt. Ein Gericht, welches sich gut vermarkten lässt. Ein Grundrezept, nahezu perfekt und super fein und dafür braucht es nur drei Zutaten: Präzision, Schlichtheit und Eleganz.
Celine: Gemüselasagne, vielschichtig und bunt.
Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre, welches wäre das und weshalb?
Pati: Ein Tier wie der Bär, wäre für mich das Jahr 2020. Wenn auch schwierig, wem möchte man dieses Jahr schon als Charakter oder Eigenschaft zuordnen? Und doch charakterisiert der Bär leider ein allgemeines Gesamtgefühl: Der Bär liebt seine Rituale und ist ein ruhender Pol, lebt seine Ungestörtheit und braucht sein eigenes Tempo, um sich entfalten zu können. Denn wehe er fühlt sich getrieben. In seiner Ruhe liegen Stärke und Geschicklichkeit und nicht Langsamkeit und Behäbigkeit. Nimmt man dem Bären diese Ruhe, wird er schnell und aggressiv und holt dich vom Baum, auf den du dich geflüchtet hast. Der Bär ist ein Raubtier, das jedoch meist friedlich durch die Welt spaziert.
Celine: Das Jahr 2020 ist für mich so unvorhersehbar wir die Farben eines Chamäleons und so medienfokussiert wie der Rundblick des Chamäleons.
Wenn ihr zehn Jahre in die Zukunft schaut, was seht ihr?
Pati: Mit Freude habe ich meine Kamerasammlung erweitern können, tolle Fotoprojekte realisiert, einige Workshops in der Street Photography gegeben, meine eigene kleine Ausstellung gefeiert und eine Fotocommunity gegründet.
Celine: Eine eigene Druckwerkstatt? Ein Projekt in Portugal? Vielleicht aber auch etwas ganz anderes.
Wie wär’s mal mit…
...gutem Design oder erfrischenden Fotos? Dann meldet euch, wir freuen uns.
Wir danken Celine und Pati für die spannenden Einblicke in ihre Freundschaft und Zusammenarbeit sowie für die Gestaltung unseres Jahresmagazins im 2020 zum Thema «Gutes Klima». Auf viele weitere tolle Projekte.
_
von Ana Brankovic
am 28.12.2020
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
© Diverse Arbeiten: Studio Moono
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Hotmailhotnail» Zürich: Im Gespräch mit Ivana Milenković
Nailart hat eigentlich gar nichts mit Kunst zu tun und wer seine Nägel macht, ist bestimmt weiblich und eitel? Zwei Klischees, die noch immer oft mit dem Gang ins Nagelstudio assoziiert werden. Seit einem Jahr zeigen Ivana und Yvee mit «Hotmailhotnail», dass Nägelmachen auch anders geht. Mit Erfolg. Umso überraschender, dass das Ganze durch Zufall und Corona zustande gekommen ist.
![]()
Liebe Ivana, wer bist du und was machst du?
Ich bin Ivana Milenković und seit einem Jahr mache ich Nägel im Nagelstudio «Hotmailhotnail». Zur Zeit zu hundert Prozent, denn aufgrund der Pandemie musste ich einige Dinge zwangsläufig pausieren. So etwa mein Dokumentarfilmprojekt, dass ich im Oktober 2019 in Mazedonien begonnen habe und wo eine Weiterführung diesen Herbst aufgrund der aktuellen Lage nicht mehr möglich war. Mit diesem Film wollte ich mich ursprünglich dann auch in Belgrad für ein Regiestudium bewerben. Vor «Hotmailhotnail» war ich am Konzert Theater Bern – wo ich auch als Regieassistentin beginnen wollte – und habe an der Universität Zürich Kunstgeschichte und Filmwissenschaften studiert.
![]()
![]()
Wie bist du zu «Hotmailhotnail» gekommen?
Auslöser war die Idee einer Freundin, im kleinen Lokal neben der Rothausbar einen 1-Franken-Laden zu eröffnen. Luca, Janina und Urs – die Betreiberinnen der Bar – verfolgten zu dieser Zeit das Konzept eines immer wieder wechselnden Gastes. So waren schon El Compañero und ein Sushi-Pop-Up vor uns drin. Ich war von der Idee, etwas eigenes direkt an der Langstrasse aufzubauen, begeistert. Und ein Nagelstudio würde doch perfekt passen.
![]()
![]()
Wie ging es dann weiter?
Zuerst bin ich für mein Dokumentarfilmprojekt nach Mazedonien gereist. Damals dachte ich mir, dass bis zur Eröffnung im Dezember 2019 noch genug Zeit wäre und ich bis dahin gelernt hätte, wie man Nägel macht. So habe ich bereits auf dem Balkan und anschliessend auch in Japan – an beiden Orten sind gemachte Nägel weitaus populärer wie hierzulande – viele Eindrücke und meine ersten Erfahrungen mit Acrylmodellage gesammelt. Zurück in der Schweiz habe ich mein Vorhaben via Social Media gepostet, woraufhin Yvee Nogara auf mich zugekommen ist. Da wir beide zuvor noch nie professionell Nägel gemacht haben, begannen wir also zu üben. Zuerst an uns selbst, dann an Freundinnen, mal im Wohnzimmer, dann bei Yvee im Atelier. Ins Rothaus sind wir dann Corona bedingt erst am 4. Mai 2020 eingezogen.
![]()
Im Rothaus in Zürich konntet ihr bis zuletzt auch bleiben.
Genau. Zu Beginn standen wir eigentlich an jedem Monatsende vor der Entscheidung, ob und wie wir mit «Hotmailhotnail» weitermachen wollen. Denn eigentlich hat das Ganze als Kunstprojekt gestartet und wir merkten allmählich, dass wir immer mehr und vor allem unbeabsichtigt in den Dienstleistungssektor hinein gerieten. Als schliesslich von Seiten Luca, Janina und Urs das Angebot für eine permanente Nutzung des Lokals kam, haben wir nichtsdestotrotz zugesagt.
![]()
Wo konnte man nebst der Langstrasse sonst noch auf «Hotmailhotnail» stossen?
Seit unserer Eröffnung im Mai 2019 waren wir immer Mal wieder in diversen Studios und Ateliers zu Gast. Ein erster Event fand bereits schon am Frauenstreik vom 14. Juni 2019 statt, da haben wir einzelne Nägel über die Gasse gemacht. Eine Woche später folgten zwei Auftritte in Tillmanns Abendschau für kapsel.space und im Juli waren wir zusätzlich zu unserer Residenz im Rothaus den ganzen Monat im Rahmen des RFSC in der Roten Fabrik. Dafür haben wir unsere gesamte Ausrüstung jede Woche mit den Velos von der Langstrasse nach Wollishofen und wieder zurück transportiert. Daneben haben wir für eine Performance des Tanzhauses Zürich eine Reihe Press-On-Nägel kreiert, die man abnehmen kann. Zuletzt hatten wir verschiedene Anfragen für Musikvideos, die jedoch Corona bedingt abgesagt werden mussten.
![]()
Im November 2020 hiess es dann Ende für die Rothausbar und somit Ende für Hotmailhotnail an der Langstrasse. Jetzt habt ihr am Rindermarkt 23 Neueröffnung gefeiert. Wie war das?
Als bekannt wurde, dass die «Republik» die Rothausbar und uns auf Ende Jahr sozusagen rausschmeissen werden, ist «enSoie» auf uns zugekommen und hat uns ihr Lokal im Niederdorf zur Zwischennutzung angeboten. Auf einmal musste alles sehr schnell gehen, und so haben wir mit Hilfe von Noel Picco innert kürzester Zeit auf die Neueröffnung am 26. November 2020 hingearbeitet: Wir haben einen neuen Tisch gebaut, eine kleine Bühne geplättelt und uns überlegt, wie wir den fast doppelt so grossen Raum sinnvoll nutzen können. Also haben wir verschiedene Leute eingeladen, mitzuwirken, um so ihnen und ihren Projekten eine Plattform zu geben. Dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat, haben wir dann an der Neueröffnung erleben dürfen. Viele gute Menschen sind zusammengekommen, wir hatten eine Feuerschale mit Turboruss, Dino Brandão hat ein kleines Konzert zum Besten gegeben – kurzum: Es war richtig schön.
![]()
![]()
Auch euer Team hat sich vergrössert. Wer sind die Gesichter hinter «Hotmailhotnail»?
Neben Yvee und mir sind neu auch Melinda Bieri und Nina Orgiu mit im Team. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass sich Yvee diesen Herbst mehr ihrem Studium gewidmet hat und ich darum im Oktober und November mehrheitlich alleine gearbeitet habe.
![]()
![]()
Ihr habt schnell viele Fans gewonnen. Was unterscheidet euch von anderen Nagelstudios?
Ich glaube, das haben wir sicher auch unserem enormen sozialen Netzwerk zu verdanken, das andere Menschen, die ein Nagelstudio eröffnen, vielleicht nicht haben. Ein weiterer Grund liegt vermutlich in der Art und Weise, wie wir «Hotmailhotnail» auf Instagram präsentieren. Dadurch sind wir weggekommen von einem sehr klischeebehafteten Bild vom Nägelmachen, dass mir noch immer sehr verbreitet scheint. Nägel müssen nicht zwangsläufig mit Eitelkeit und einem voreingenommen Frauenbild einhergehen, sondern können auch Schmuck oder Kunstwerke sein. Was oft als reine Routine schubladisiert wird, kann zu einem Event oder ganzen Happenings gemacht werden – nicht nur für Frauen, sondern für alle. Zu guter Letzt haben wir sicher auch einen passenden Moment erwischt, ein Nagelstudio wie «Hotmailhotnail» in Zürich zu starten.
![]()
Glaubst du es liegt auch daran, dass ihr euch in der Kunst- und Kulturszene bewegt?
Nicht unbedingt. Gemachte Nägel waren eigentlich nicht wirklich verbreitet in dieser Szene, obwohl sie sehr durchmischt ist. Neunzig Prozent unserer Kundinnen probieren Nailart das erste Mal aus.
![]()
Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?
Mit «Hotmailhotnail» habe ich mir etwas aufgebaut, wovon ich nie gedacht hätte, dass ich es einmal machen würde. Vor allem nicht über ein Jahr. Das Nägelmachen ist eine sehr repetitive Arbeit, alles ist sehr filigran. Das war neu für mich und trotzdem bereitet mir diese Arbeit sehr viel Freude – auch und gerade, weil ich so auch unter Leuten sein kann und direktes Feedback für meine Arbeit erhalte.
![]()
Gibt es auch etwas, das dir gar nicht zusagt?
Ja, dass wir mit der Zeit immer mehr in den Dienstleistungssektor reingerutscht sind. Wir machen eigentlich endless von früh bis spät Nails, anderes hat da fast keinen Platz mehr.
![]()
Am 17. Januar 2021 ist eure Zwischennutzungszeit schon vorbei, wohin wird es weitergehen?
Wir wissen noch nicht lange, dass wir statt bis zum 31. Dezember nun bis zum 17. Januar am Rindermarkt 23 bleiben dürfen. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht klar. Eine Option wäre die Nasa Tankstelle – eine weitere die Zwischennutzung im Haus Eber im Kreis 4.
![]()
Was wünschst du dir für die Zukunft von «Hotmailhotnail»?
Ich wünsche mir ein wenig den Vibe zurück, den wir zu Beginn bei «Hotmailhotnail» hatten. Weg vom reinen Dienstleistungs-Dasein und wieder hin zu entspannterem Zusammensein. Wir möchten wieder vermehrt Kunstprojekte und 3D-Nailart verfolgen – mit dem nächsten Ortswechsel soll dieser Austritt angestrebt werden. Trotzdem möchten wir zugänglich bleiben für alle. Und natürlich, dass wir weiterhin dem etablierten und teilweise verschobenen Bild vom Nägelmachen entgegenwirken. Wer weiss, vielleicht erstellen wir schon bald Press-On-Nägel im gleichen Studio wie ein Radio?
Wo in Zürich bist du am liebsten?
Kürzlich war ich wieder einmal zu Besuch in Witikon (Kreis 7), wo ich geboren und aufgewachsen bin. Den Spaziergang durch das verschneite Dörfchen habe ich sehr genossen.
![]()
Wenn nicht Corona wäre, in welcher Bar oder in welchem Club würde man dich antreffen?
Wenn Corona und die Republik nicht wären, dann in der Rothausbar.
Wie wär’s mal mit…
…bedingungslosem Grundeinkommen?
![]()
Vielen lieben Dank Ivana für das tolle Gespräch und die Einblicke in deine Welt der Nagelkunst.
_
von Valérie Hug
am 21.12.2020
Fotos
© Monir Salihi für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Nailart hat eigentlich gar nichts mit Kunst zu tun und wer seine Nägel macht, ist bestimmt weiblich und eitel? Zwei Klischees, die noch immer oft mit dem Gang ins Nagelstudio assoziiert werden. Seit einem Jahr zeigen Ivana und Yvee mit «Hotmailhotnail», dass Nägelmachen auch anders geht. Mit Erfolg. Umso überraschender, dass das Ganze durch Zufall und Corona zustande gekommen ist.

Liebe Ivana, wer bist du und was machst du?
Ich bin Ivana Milenković und seit einem Jahr mache ich Nägel im Nagelstudio «Hotmailhotnail». Zur Zeit zu hundert Prozent, denn aufgrund der Pandemie musste ich einige Dinge zwangsläufig pausieren. So etwa mein Dokumentarfilmprojekt, dass ich im Oktober 2019 in Mazedonien begonnen habe und wo eine Weiterführung diesen Herbst aufgrund der aktuellen Lage nicht mehr möglich war. Mit diesem Film wollte ich mich ursprünglich dann auch in Belgrad für ein Regiestudium bewerben. Vor «Hotmailhotnail» war ich am Konzert Theater Bern – wo ich auch als Regieassistentin beginnen wollte – und habe an der Universität Zürich Kunstgeschichte und Filmwissenschaften studiert.


Wie bist du zu «Hotmailhotnail» gekommen?
Auslöser war die Idee einer Freundin, im kleinen Lokal neben der Rothausbar einen 1-Franken-Laden zu eröffnen. Luca, Janina und Urs – die Betreiberinnen der Bar – verfolgten zu dieser Zeit das Konzept eines immer wieder wechselnden Gastes. So waren schon El Compañero und ein Sushi-Pop-Up vor uns drin. Ich war von der Idee, etwas eigenes direkt an der Langstrasse aufzubauen, begeistert. Und ein Nagelstudio würde doch perfekt passen.


Wie ging es dann weiter?
Zuerst bin ich für mein Dokumentarfilmprojekt nach Mazedonien gereist. Damals dachte ich mir, dass bis zur Eröffnung im Dezember 2019 noch genug Zeit wäre und ich bis dahin gelernt hätte, wie man Nägel macht. So habe ich bereits auf dem Balkan und anschliessend auch in Japan – an beiden Orten sind gemachte Nägel weitaus populärer wie hierzulande – viele Eindrücke und meine ersten Erfahrungen mit Acrylmodellage gesammelt. Zurück in der Schweiz habe ich mein Vorhaben via Social Media gepostet, woraufhin Yvee Nogara auf mich zugekommen ist. Da wir beide zuvor noch nie professionell Nägel gemacht haben, begannen wir also zu üben. Zuerst an uns selbst, dann an Freundinnen, mal im Wohnzimmer, dann bei Yvee im Atelier. Ins Rothaus sind wir dann Corona bedingt erst am 4. Mai 2020 eingezogen.

Im Rothaus in Zürich konntet ihr bis zuletzt auch bleiben.
Genau. Zu Beginn standen wir eigentlich an jedem Monatsende vor der Entscheidung, ob und wie wir mit «Hotmailhotnail» weitermachen wollen. Denn eigentlich hat das Ganze als Kunstprojekt gestartet und wir merkten allmählich, dass wir immer mehr und vor allem unbeabsichtigt in den Dienstleistungssektor hinein gerieten. Als schliesslich von Seiten Luca, Janina und Urs das Angebot für eine permanente Nutzung des Lokals kam, haben wir nichtsdestotrotz zugesagt.

Wo konnte man nebst der Langstrasse sonst noch auf «Hotmailhotnail» stossen?
Seit unserer Eröffnung im Mai 2019 waren wir immer Mal wieder in diversen Studios und Ateliers zu Gast. Ein erster Event fand bereits schon am Frauenstreik vom 14. Juni 2019 statt, da haben wir einzelne Nägel über die Gasse gemacht. Eine Woche später folgten zwei Auftritte in Tillmanns Abendschau für kapsel.space und im Juli waren wir zusätzlich zu unserer Residenz im Rothaus den ganzen Monat im Rahmen des RFSC in der Roten Fabrik. Dafür haben wir unsere gesamte Ausrüstung jede Woche mit den Velos von der Langstrasse nach Wollishofen und wieder zurück transportiert. Daneben haben wir für eine Performance des Tanzhauses Zürich eine Reihe Press-On-Nägel kreiert, die man abnehmen kann. Zuletzt hatten wir verschiedene Anfragen für Musikvideos, die jedoch Corona bedingt abgesagt werden mussten.

Im November 2020 hiess es dann Ende für die Rothausbar und somit Ende für Hotmailhotnail an der Langstrasse. Jetzt habt ihr am Rindermarkt 23 Neueröffnung gefeiert. Wie war das?
Als bekannt wurde, dass die «Republik» die Rothausbar und uns auf Ende Jahr sozusagen rausschmeissen werden, ist «enSoie» auf uns zugekommen und hat uns ihr Lokal im Niederdorf zur Zwischennutzung angeboten. Auf einmal musste alles sehr schnell gehen, und so haben wir mit Hilfe von Noel Picco innert kürzester Zeit auf die Neueröffnung am 26. November 2020 hingearbeitet: Wir haben einen neuen Tisch gebaut, eine kleine Bühne geplättelt und uns überlegt, wie wir den fast doppelt so grossen Raum sinnvoll nutzen können. Also haben wir verschiedene Leute eingeladen, mitzuwirken, um so ihnen und ihren Projekten eine Plattform zu geben. Dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat, haben wir dann an der Neueröffnung erleben dürfen. Viele gute Menschen sind zusammengekommen, wir hatten eine Feuerschale mit Turboruss, Dino Brandão hat ein kleines Konzert zum Besten gegeben – kurzum: Es war richtig schön.


Auch euer Team hat sich vergrössert. Wer sind die Gesichter hinter «Hotmailhotnail»?
Neben Yvee und mir sind neu auch Melinda Bieri und Nina Orgiu mit im Team. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass sich Yvee diesen Herbst mehr ihrem Studium gewidmet hat und ich darum im Oktober und November mehrheitlich alleine gearbeitet habe.


Ihr habt schnell viele Fans gewonnen. Was unterscheidet euch von anderen Nagelstudios?
Ich glaube, das haben wir sicher auch unserem enormen sozialen Netzwerk zu verdanken, das andere Menschen, die ein Nagelstudio eröffnen, vielleicht nicht haben. Ein weiterer Grund liegt vermutlich in der Art und Weise, wie wir «Hotmailhotnail» auf Instagram präsentieren. Dadurch sind wir weggekommen von einem sehr klischeebehafteten Bild vom Nägelmachen, dass mir noch immer sehr verbreitet scheint. Nägel müssen nicht zwangsläufig mit Eitelkeit und einem voreingenommen Frauenbild einhergehen, sondern können auch Schmuck oder Kunstwerke sein. Was oft als reine Routine schubladisiert wird, kann zu einem Event oder ganzen Happenings gemacht werden – nicht nur für Frauen, sondern für alle. Zu guter Letzt haben wir sicher auch einen passenden Moment erwischt, ein Nagelstudio wie «Hotmailhotnail» in Zürich zu starten.

Glaubst du es liegt auch daran, dass ihr euch in der Kunst- und Kulturszene bewegt?
Nicht unbedingt. Gemachte Nägel waren eigentlich nicht wirklich verbreitet in dieser Szene, obwohl sie sehr durchmischt ist. Neunzig Prozent unserer Kundinnen probieren Nailart das erste Mal aus.

Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?
Mit «Hotmailhotnail» habe ich mir etwas aufgebaut, wovon ich nie gedacht hätte, dass ich es einmal machen würde. Vor allem nicht über ein Jahr. Das Nägelmachen ist eine sehr repetitive Arbeit, alles ist sehr filigran. Das war neu für mich und trotzdem bereitet mir diese Arbeit sehr viel Freude – auch und gerade, weil ich so auch unter Leuten sein kann und direktes Feedback für meine Arbeit erhalte.

Gibt es auch etwas, das dir gar nicht zusagt?
Ja, dass wir mit der Zeit immer mehr in den Dienstleistungssektor reingerutscht sind. Wir machen eigentlich endless von früh bis spät Nails, anderes hat da fast keinen Platz mehr.

Am 17. Januar 2021 ist eure Zwischennutzungszeit schon vorbei, wohin wird es weitergehen?
Wir wissen noch nicht lange, dass wir statt bis zum 31. Dezember nun bis zum 17. Januar am Rindermarkt 23 bleiben dürfen. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht klar. Eine Option wäre die Nasa Tankstelle – eine weitere die Zwischennutzung im Haus Eber im Kreis 4.

Was wünschst du dir für die Zukunft von «Hotmailhotnail»?
Ich wünsche mir ein wenig den Vibe zurück, den wir zu Beginn bei «Hotmailhotnail» hatten. Weg vom reinen Dienstleistungs-Dasein und wieder hin zu entspannterem Zusammensein. Wir möchten wieder vermehrt Kunstprojekte und 3D-Nailart verfolgen – mit dem nächsten Ortswechsel soll dieser Austritt angestrebt werden. Trotzdem möchten wir zugänglich bleiben für alle. Und natürlich, dass wir weiterhin dem etablierten und teilweise verschobenen Bild vom Nägelmachen entgegenwirken. Wer weiss, vielleicht erstellen wir schon bald Press-On-Nägel im gleichen Studio wie ein Radio?
Wo in Zürich bist du am liebsten?
Kürzlich war ich wieder einmal zu Besuch in Witikon (Kreis 7), wo ich geboren und aufgewachsen bin. Den Spaziergang durch das verschneite Dörfchen habe ich sehr genossen.

Wenn nicht Corona wäre, in welcher Bar oder in welchem Club würde man dich antreffen?
Wenn Corona und die Republik nicht wären, dann in der Rothausbar.
Wie wär’s mal mit…
…bedingungslosem Grundeinkommen?

Vielen lieben Dank Ivana für das tolle Gespräch und die Einblicke in deine Welt der Nagelkunst.
_
von Valérie Hug
am 21.12.2020
Fotos
© Monir Salihi für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Carvolution»: Im Gespräch mit Gründerin Léa Miggiano
In Zeiten von COVID-19 entdecken einige Menschen mit dem eigenen Auto die Schweiz als Urlaubsziel wieder. Doch was, wenn man kein eigenes Auto besitzt? Wie leistet man sich günstig diese Flexibilität, ohne gleich ein teures Auto kaufen oder leasen zu müssen? Léa Miggiano ist Gründerin von «Carvolution» und erzählt uns, weshalb ein Auto-Abo Sinn macht.
![]()
Liebe Léa, erzähl uns ein wenig über dich.
2018 habe ich «Carvolution» gegründet. Zuvor studierte ich in St. Gallen an der HSG Betriebswirtschaft. Bei einem Austauschsemester in Amsterdam konnte ich meinen Horizont erweitern. Bereits während dem Studium entdeckte ich meine Leidenschaft für Startups und durfte unter anderem in Berlin diverse Arbeitserfahrungen sammeln.
![]()
Meine Entscheidung, mit 23 Jahren ein Unternehmen zu gründen, kam für viele unerwartet. Ich habe es mit kaum jemandem besprochen, aber mein Bauchgefühl stimmte und ich habe meinen Entscheid nie bereut. Die Entscheidung ein Startup zu gründen entwickelte sich aus dem Gedanken heraus, da ich selbst ein Auto benötigte. Ein Auto zu kaufen oder zu leasen fand ich viel zu teuer, unflexibel und mühsam. Dank meiner Mentalität bin ich aber so eingestellt, dass ich Lösungen für Probleme finden möchte. Daher war die Gründung eine beschlossene Sache.
![]()
Pferdestärken (PS) haben in meinem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Von den tierischen PS, dem Reiten, habe ich mit «Carvolution» meine Aufmerksamkeit nun mehr den technischen PS zugewandt. Dem Pferd und dem Reitsport bin ich aber immer noch treu geblieben. Fun Fact: Wenn ich einparke, müssen alle im Auto ruhig sein, sonst klappt das nicht so gut. Obwohl ich täglich mit Autos zu tun habe, haben sich meine Seitwärts-Parkier-Fähigkeiten bislang nicht verbessert. Kommt aber bestimmt noch.
![]()
Was ist «Carvolution» und wie ist es entstanden?
«Carvolution» entstand 2018, nachdem ich und meine Mitgründer selbst ein Auto benötigten. Wir merkten alle sofort, dass es sehr umständlich war, ein Auto zu kaufen oder zu leasen. Zudem summierten sich schnell die vielen versteckten Kosten. Wir alle wollten eine Lösung, die es einfacher macht, ein eigenes Auto zu fahren. Es soll aber auch genauso einfach sein, sein Auto wieder zurückzugeben. Dass dabei alles inklusive ist und man sich um nichts kümmern muss, spricht ebenfalls für «Carvolution». Mit dem monatlichen Fixpreis hat man des Weiteren die Gesamtkosten seines Autos immer im Überblick. Denn es stellte sich heraus, dass viele ihre Kosten nicht im Blick haben. Ein Auto wird so schnell zu einem finanziellen Risiko. Ich bin oft selbst überrascht, dass wir in der heutigen Zeit so viel preiswerter als ein Neuwagenkauf oder Leasing sind.
![]()
«Carvolution» – weshalb der Name?
Nachdem wir auf einer Liste alle Namen notierten, die uns eingefallen sind, liessen wir Freunde und Familie abstimmen. Der Name «Carvolution» hat das Mini-Voting klar gewonnen. Es ist ein Name, der vieles widerspiegelt. Auto - Revolution oder Evolution. Bei uns ist beides wichtig. Unsere Kundinnen und Kunden können das Auto wie früher nutzten, wir haben es nur leicht verändert, eben wie eine Evolution. Das Revolutionäre bei uns ist, dass wir uns von bestehenden Prozessen nicht beirren lassen und die Buchung bzw. das Erlebnis an die heutigen Bedürfnissen angepasst haben.
![]()
![]() Wie gross ist eures Team und was sind die Aufgaben?
Wie gross ist eures Team und was sind die Aufgaben?
Unser Team zählt momentan 40 Mitarbeitende. Wir haben natürlich ein sehr beeindruckendes IT-Team, das sicherstellt, dass auf der Website, in der App aber vor allem im Hintergrund alles funktioniert. Weiter haben wir ein Dispositions-Team. Es kümmert sich um alles rund ums Auto. Sei es die Einlösung im Kanton, die Schadensabwicklung für unsere Kundinnen und Kunden und den administrativen Aufwand. Damit wir immer die besten Neuwagen anbieten können, gibt es natürlich auch ein Einkaufsteam. Weiter haben wir ein Team von BeraterInnen, den Marketingbereich und den Finanzbereich. Zu guter Letzt zählt zu «Carvolution» ebenfalls ein Team, das all unsere Prozesse kontinuierlich verbessert. Alle arbeiten daran, dass wir unseren Kundinnen und Kunden den besten Service und die besten Preise anbieten können (lacht).
![]()
Was sind die Vorteile eines Auto-Abos bei «Carvolution» im Gegensatz zum Kauf oder Leasing eines Autos?
Der erste Vorteil ist, dass das Auto-Abo günstiger ist als ein Leasing oder Kauf. Denn die Gesamtkosten von beispielsweise einem geleasten Audi A1 belaufen sich laut TCS mit allen Kosten monatlich auf rund 841 CHF. Im Abo dagegen gibt es einen neuen Audi A1 bereits ab 469 CHF pro Monat. In 36 Monaten lassen sich so bei «Carvolution» über 13’300 CHF sparen. Weiter kann bei einem Auto-Abo der Kunde sein Auto genau so lange fahren, wie er möchte. Seien dies 3, 6 oder bis zu 36 Monate. Bei einem Leasing ist man oft in Leasingverträgen gebunden, die mindestens 36 Monate dauern. Bei einem Kauf ist man noch starrer diesbezüglich. «Carvolution» bietet Flexibilität. So kann man sein Auto immer seinen Bedürfnissen anpassen, egal wie schnell diese wechseln.
![]()
Bei einem Auto-Abo ist zudem alles inklusive. Es kommen keine zusätzlichen Kosten hinzu. Anders als bei einem Leasing oder Kauf, bei dem man sich noch um die Versicherung, die Steuern, Services und Wartung und die Reifen kümmern und bezahlen muss. Das alles übernimmt «Carvolution». Unsere Kund*innen haben keinen Aufwand.
Beschreibt eure Kundschaft in 3 treffenden Worten.
Neugierig, smart, glücklich.
![]()
![]()
Worauf legt ihr persönlich Wert im Umgang mit der Kundschaft und wofür werden die Autos verwendet?
Unsere Kundschaft soll keinen Aufwand haben und nur ihr Auto und die Fahrt geniessen. Deshalb legen wir grossen Wert darauf, alles für sie zu koordinieren. Die Autos werden für alles mögliche verwendet. Viele benötigen ein Auto, um zur Arbeit zu fahren, andere wollen es für die Freizeit. Wieder andere möchten im Sommer ein Cabriolet fahren, andere im Winter einen SUV. Geschäftskunden nutzen ihr Auto für den Aussendienst.
![]()
Welche Menschen sollten ein Autoabo bei «Carvolution» lösen und weshalb?
Das Auto-Abo ist für alle – ob das erste Auto oder ein Auto im Alter. Unsere Kundschaft erstreckt sich durch alle Altersklassen. Weiter ist das Abo geeignet für Familien, die ein grosses Auto brauchen, bis die Kinder wieder aus dem Haus sind und danach einfach auf ein kleineres Auto umsteigen wollen. Es ist für alleinstehende Personen, die gerne mobil sind und für jene, die mit dem Abo auch ein klein wenig an die Umwelt denken wollen, denn sie fahren ihr Auto nur für eine bestimmte Zeit. Es ist auch für jene, die ein neues Auto, wie beispielsweise ein Elektroauto, auch erst einmal ausprobieren möchten. Das Auto-Abo ist somit für ganz unterschiedliche individuelle Bedürfnisse geeignet. Natürlich auch für Firmenkunden, allen voran die KMUs.
![]()
Wo in Zürich treibst du dich am liebsten rum, wenn du gerade nicht bei «Carvolution» am arbeiten bist?
Mein absoluter Lieblingsort in Zürich ist das «Resident» im schönen Seefeld. Dort kann ich unter anderem am Nachmittag in Ruhe arbeiten und später mit Freund*innen oder anderen Entrepreneurs einen After Work Drink geniessen. Sonst bin ich auch ab und zu im «Kosmos» anzutreffen. Dort läuft immer was und es liegt auf meinem Arbeitsweg. Am Wochenende gehe ich gerne im «4 Tiere» oder im «Kasheme» etwas trinken, zwei Bars mit sehr tollen Atmosphären. Sonntags gehe ich gerne mit Freund*innen brunchen. Da habe ich aber tatsächlich noch keinen Lieblingsort gefunden.
![]() Wo in der Schweiz muss man unbedingt mal gewesen bzw. was kann man alles unkonventionelles mit einem Auto anstellen?
Wo in der Schweiz muss man unbedingt mal gewesen bzw. was kann man alles unkonventionelles mit einem Auto anstellen?
Die Schweiz ist mit all ihren schönen Orten beinahe unergründlich. Man kann mit dem Auto überall hinfahren. Ins Tessin an den Lago Maggiore, über den Gotthard oder ins Jura. Man kann in die Zentralschweiz für schöne Wanderungen oder nach Davos, um Ski zu fahren. Einfach sein Gepäck unkompliziert in den Kofferraum verstauen und losfahren, wann man möchte. Man muss sich weder um Abfahrtszeiten noch um Umsteigezeiten sorgen.
![]()
![]()
Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre welches wäre das und weshalb?
2020 wäre ganz klar ein Fabelwesen. Man hätte es nicht für möglich gehalten, doch ist es erschienen. Ich glaube, man darf aber nicht nur das Negative im Jahr 2020 sehen. Klar, die Situation war und ist schwierig, aber es konnten auch enorm viele Fortschritte gemacht werden, v.a. in der digitalen Welt. Auch wir haben unsere Prozesse angepasst und konnten uns so an manchen Stellen verbessern.
![]()
Wenn du 10 Jahre in die Zukunft schaust, was siehst du?
So weit plane ich gar nicht. Ich nehme das Leben, wie es kommt. Aber die letzten 2.5 Jahre haben gezeigt, wie schnell sich das Leben verändern kann. Von der Studentin zur Unternehmerin. Von einer Idee zu einem Unternehmen. Von einem Neuling in der Automobilindustrie zu einem anerkannten Unternehmen. Das «Carvolution» Team und ich haben noch viel vor. Ihr werdet noch einiges von uns hören (lacht).
Wie wär’s mal mit...
...einem Auto, dass das Leben einfacher macht und weniger kostet? Dann melde dich bei mir.
![]()
Vielen Dank an Léa für die Einblicke in ihr Startup samt jungem, sympathischen Team sowie der tollen Zusammenarbeit. «Carvolution» ermöglichte uns im Herbst 2020 mit einem Auto die «Dönerteller Schweiz Tour» zu machen und die Schweiz neu zu entdecken.
_
von Ana Brankovic
am 09.11.2020
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
© Porträt von Léa Maggiano via Carvolution
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
In Zeiten von COVID-19 entdecken einige Menschen mit dem eigenen Auto die Schweiz als Urlaubsziel wieder. Doch was, wenn man kein eigenes Auto besitzt? Wie leistet man sich günstig diese Flexibilität, ohne gleich ein teures Auto kaufen oder leasen zu müssen? Léa Miggiano ist Gründerin von «Carvolution» und erzählt uns, weshalb ein Auto-Abo Sinn macht.
Liebe Léa, erzähl uns ein wenig über dich.
2018 habe ich «Carvolution» gegründet. Zuvor studierte ich in St. Gallen an der HSG Betriebswirtschaft. Bei einem Austauschsemester in Amsterdam konnte ich meinen Horizont erweitern. Bereits während dem Studium entdeckte ich meine Leidenschaft für Startups und durfte unter anderem in Berlin diverse Arbeitserfahrungen sammeln.
Meine Entscheidung, mit 23 Jahren ein Unternehmen zu gründen, kam für viele unerwartet. Ich habe es mit kaum jemandem besprochen, aber mein Bauchgefühl stimmte und ich habe meinen Entscheid nie bereut. Die Entscheidung ein Startup zu gründen entwickelte sich aus dem Gedanken heraus, da ich selbst ein Auto benötigte. Ein Auto zu kaufen oder zu leasen fand ich viel zu teuer, unflexibel und mühsam. Dank meiner Mentalität bin ich aber so eingestellt, dass ich Lösungen für Probleme finden möchte. Daher war die Gründung eine beschlossene Sache.
Pferdestärken (PS) haben in meinem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Von den tierischen PS, dem Reiten, habe ich mit «Carvolution» meine Aufmerksamkeit nun mehr den technischen PS zugewandt. Dem Pferd und dem Reitsport bin ich aber immer noch treu geblieben. Fun Fact: Wenn ich einparke, müssen alle im Auto ruhig sein, sonst klappt das nicht so gut. Obwohl ich täglich mit Autos zu tun habe, haben sich meine Seitwärts-Parkier-Fähigkeiten bislang nicht verbessert. Kommt aber bestimmt noch.
Was ist «Carvolution» und wie ist es entstanden?
«Carvolution» entstand 2018, nachdem ich und meine Mitgründer selbst ein Auto benötigten. Wir merkten alle sofort, dass es sehr umständlich war, ein Auto zu kaufen oder zu leasen. Zudem summierten sich schnell die vielen versteckten Kosten. Wir alle wollten eine Lösung, die es einfacher macht, ein eigenes Auto zu fahren. Es soll aber auch genauso einfach sein, sein Auto wieder zurückzugeben. Dass dabei alles inklusive ist und man sich um nichts kümmern muss, spricht ebenfalls für «Carvolution». Mit dem monatlichen Fixpreis hat man des Weiteren die Gesamtkosten seines Autos immer im Überblick. Denn es stellte sich heraus, dass viele ihre Kosten nicht im Blick haben. Ein Auto wird so schnell zu einem finanziellen Risiko. Ich bin oft selbst überrascht, dass wir in der heutigen Zeit so viel preiswerter als ein Neuwagenkauf oder Leasing sind.
«Carvolution» – weshalb der Name?
Nachdem wir auf einer Liste alle Namen notierten, die uns eingefallen sind, liessen wir Freunde und Familie abstimmen. Der Name «Carvolution» hat das Mini-Voting klar gewonnen. Es ist ein Name, der vieles widerspiegelt. Auto - Revolution oder Evolution. Bei uns ist beides wichtig. Unsere Kundinnen und Kunden können das Auto wie früher nutzten, wir haben es nur leicht verändert, eben wie eine Evolution. Das Revolutionäre bei uns ist, dass wir uns von bestehenden Prozessen nicht beirren lassen und die Buchung bzw. das Erlebnis an die heutigen Bedürfnissen angepasst haben.
Unser Team zählt momentan 40 Mitarbeitende. Wir haben natürlich ein sehr beeindruckendes IT-Team, das sicherstellt, dass auf der Website, in der App aber vor allem im Hintergrund alles funktioniert. Weiter haben wir ein Dispositions-Team. Es kümmert sich um alles rund ums Auto. Sei es die Einlösung im Kanton, die Schadensabwicklung für unsere Kundinnen und Kunden und den administrativen Aufwand. Damit wir immer die besten Neuwagen anbieten können, gibt es natürlich auch ein Einkaufsteam. Weiter haben wir ein Team von BeraterInnen, den Marketingbereich und den Finanzbereich. Zu guter Letzt zählt zu «Carvolution» ebenfalls ein Team, das all unsere Prozesse kontinuierlich verbessert. Alle arbeiten daran, dass wir unseren Kundinnen und Kunden den besten Service und die besten Preise anbieten können (lacht).
Was sind die Vorteile eines Auto-Abos bei «Carvolution» im Gegensatz zum Kauf oder Leasing eines Autos?
Der erste Vorteil ist, dass das Auto-Abo günstiger ist als ein Leasing oder Kauf. Denn die Gesamtkosten von beispielsweise einem geleasten Audi A1 belaufen sich laut TCS mit allen Kosten monatlich auf rund 841 CHF. Im Abo dagegen gibt es einen neuen Audi A1 bereits ab 469 CHF pro Monat. In 36 Monaten lassen sich so bei «Carvolution» über 13’300 CHF sparen. Weiter kann bei einem Auto-Abo der Kunde sein Auto genau so lange fahren, wie er möchte. Seien dies 3, 6 oder bis zu 36 Monate. Bei einem Leasing ist man oft in Leasingverträgen gebunden, die mindestens 36 Monate dauern. Bei einem Kauf ist man noch starrer diesbezüglich. «Carvolution» bietet Flexibilität. So kann man sein Auto immer seinen Bedürfnissen anpassen, egal wie schnell diese wechseln.
Bei einem Auto-Abo ist zudem alles inklusive. Es kommen keine zusätzlichen Kosten hinzu. Anders als bei einem Leasing oder Kauf, bei dem man sich noch um die Versicherung, die Steuern, Services und Wartung und die Reifen kümmern und bezahlen muss. Das alles übernimmt «Carvolution». Unsere Kund*innen haben keinen Aufwand.
Beschreibt eure Kundschaft in 3 treffenden Worten.
Neugierig, smart, glücklich.
Worauf legt ihr persönlich Wert im Umgang mit der Kundschaft und wofür werden die Autos verwendet?
Unsere Kundschaft soll keinen Aufwand haben und nur ihr Auto und die Fahrt geniessen. Deshalb legen wir grossen Wert darauf, alles für sie zu koordinieren. Die Autos werden für alles mögliche verwendet. Viele benötigen ein Auto, um zur Arbeit zu fahren, andere wollen es für die Freizeit. Wieder andere möchten im Sommer ein Cabriolet fahren, andere im Winter einen SUV. Geschäftskunden nutzen ihr Auto für den Aussendienst.
Welche Menschen sollten ein Autoabo bei «Carvolution» lösen und weshalb?
Das Auto-Abo ist für alle – ob das erste Auto oder ein Auto im Alter. Unsere Kundschaft erstreckt sich durch alle Altersklassen. Weiter ist das Abo geeignet für Familien, die ein grosses Auto brauchen, bis die Kinder wieder aus dem Haus sind und danach einfach auf ein kleineres Auto umsteigen wollen. Es ist für alleinstehende Personen, die gerne mobil sind und für jene, die mit dem Abo auch ein klein wenig an die Umwelt denken wollen, denn sie fahren ihr Auto nur für eine bestimmte Zeit. Es ist auch für jene, die ein neues Auto, wie beispielsweise ein Elektroauto, auch erst einmal ausprobieren möchten. Das Auto-Abo ist somit für ganz unterschiedliche individuelle Bedürfnisse geeignet. Natürlich auch für Firmenkunden, allen voran die KMUs.
Wo in Zürich treibst du dich am liebsten rum, wenn du gerade nicht bei «Carvolution» am arbeiten bist?
Mein absoluter Lieblingsort in Zürich ist das «Resident» im schönen Seefeld. Dort kann ich unter anderem am Nachmittag in Ruhe arbeiten und später mit Freund*innen oder anderen Entrepreneurs einen After Work Drink geniessen. Sonst bin ich auch ab und zu im «Kosmos» anzutreffen. Dort läuft immer was und es liegt auf meinem Arbeitsweg. Am Wochenende gehe ich gerne im «4 Tiere» oder im «Kasheme» etwas trinken, zwei Bars mit sehr tollen Atmosphären. Sonntags gehe ich gerne mit Freund*innen brunchen. Da habe ich aber tatsächlich noch keinen Lieblingsort gefunden.
Die Schweiz ist mit all ihren schönen Orten beinahe unergründlich. Man kann mit dem Auto überall hinfahren. Ins Tessin an den Lago Maggiore, über den Gotthard oder ins Jura. Man kann in die Zentralschweiz für schöne Wanderungen oder nach Davos, um Ski zu fahren. Einfach sein Gepäck unkompliziert in den Kofferraum verstauen und losfahren, wann man möchte. Man muss sich weder um Abfahrtszeiten noch um Umsteigezeiten sorgen.
Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre welches wäre das und weshalb?
2020 wäre ganz klar ein Fabelwesen. Man hätte es nicht für möglich gehalten, doch ist es erschienen. Ich glaube, man darf aber nicht nur das Negative im Jahr 2020 sehen. Klar, die Situation war und ist schwierig, aber es konnten auch enorm viele Fortschritte gemacht werden, v.a. in der digitalen Welt. Auch wir haben unsere Prozesse angepasst und konnten uns so an manchen Stellen verbessern.
Wenn du 10 Jahre in die Zukunft schaust, was siehst du?
So weit plane ich gar nicht. Ich nehme das Leben, wie es kommt. Aber die letzten 2.5 Jahre haben gezeigt, wie schnell sich das Leben verändern kann. Von der Studentin zur Unternehmerin. Von einer Idee zu einem Unternehmen. Von einem Neuling in der Automobilindustrie zu einem anerkannten Unternehmen. Das «Carvolution» Team und ich haben noch viel vor. Ihr werdet noch einiges von uns hören (lacht).
Wie wär’s mal mit...
...einem Auto, dass das Leben einfacher macht und weniger kostet? Dann melde dich bei mir.

Vielen Dank an Léa für die Einblicke in ihr Startup samt jungem, sympathischen Team sowie der tollen Zusammenarbeit. «Carvolution» ermöglichte uns im Herbst 2020 mit einem Auto die «Dönerteller Schweiz Tour» zu machen und die Schweiz neu zu entdecken.
_
von Ana Brankovic
am 09.11.2020
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
© Porträt von Léa Maggiano via Carvolution
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«QWSTION» und «Soeder»: Pop-Up Store in Basel
Die beiden Schweizer Brands «QWSTION» und «Soeder» schliessen sich für einen Pop-Up Store in Basel zusammen. Vor Ort gibt es nicht nur zahlreiche tolle Produkte sondern auch Einblicke in Designprozesse sowie einen Showroom. Christian Kaegi von «QWSTION» und Hanna Åkerström von «Soeder» erzählen uns in einem Gespräch mehr über Nachhaltigkeit, die Liebe zum Detail und Materialien sowie zur Zusammenarbeit vor allem in Zeiten von Social Distancing.
![]()
Lieber Christian, liebe Hanna, wer seid ihr und was inspiriert euch so im Leben?
Christian: Ich bin mit Werkstatt und Nähmaschine in der Nähe von Zürich aufgewachsen und habe schon als Kind die wildesten Ideen aufskizziert, oft auch gebaut oder eher gebastelt (lacht). Dass sowas mal mein Beruf werden könnte, habe ich erst viel später realisiert und dann Industrial Design studiert. Mich interessieren Materialien, Herstellungsprozesse, kultureller Kontext, Zusammenhänge. All dies spielt in meinem Designverständnis eine Rolle und ich kann mich bei «QWSTION» ständig damit befassen. Hanna und ich haben uns vor mehr als 10 Jahren über gemeinsame Freund*innen kennengelernt, und hatten beide immer Freude an gut gestalteten, sinnvollen Dingen.
![]()
Hanna: Ich bin Schweden aufgewachsen, habe aber habe mein ganzes Erwachsenenleben in der Schweiz verbracht. Als 19 Jährige habe ich ein Austauschsemester in der Schweiz gemacht und bin natürlich hängen geblieben. Nach einem Jahr in den Bergen folgten 6 Jahre an der Architekturabteilung der ETH in Zürich. Danach arbeitete ich einige Jahre als Architektin in Zürich, habe einen schwedischen Mann getroffen, Kinder bekommen und nebenbei noch «Soeder» mit ihm gegründet. Ich bin gerne leidenschaftlich kreativ, komme aber leider nicht oft dazu wegen allem anderen im Leben. Meine Tage verbringe ich glücklicherweise mit dem sehr sehr vielfältigen Job bei «Soeder. Der Job ist kreativ, sehr vielfältig und spannend. Freizeit? Das Wort sagt mir schon was, hatte ich früher öfters, bevor mein Leben zusammengeschmolzen ist mit «Soeder». Nun ist «Soeder» das, was wir machen, womit unsere Kinder gross werden und das, was wir im Sommer mit in die Ferien nehmen.
![]()
Wie sind «QWSTION» bzw. «Soeder» in Zürich entstanden?
Christian: Ich war auf der Suche nach einer Tasche, welche den Spagat zwischen Funktionalität und zeitlosem Design macht und genauso auf dem Fahrrad überzeugt, wie in einem formelleren Kontext. Verantwortungsvolle Herstellung war für mich immer zwingend und erneuerbare, natürliche Ressourcen sollten die Basis bilden. Auch meine Mitgründer Hannes, Matthias, Fabrice und Sebastian konnten eine solche Tasche nicht finden, weshalb wir uns 2008 daran machten, diese selber herzustellen.
Hanna: Wir haben in 2013 die Firma gegründet und auch den «Soeder» Store aufgemacht. Alles basierte auf unserer Überzeugung, dass zukunftsfähiger Konsum nachhaltig sein muss. Unsere Produkte wurden seither immer langlebig designt, aus nachhaltigen Materialien produziert und in Europa hergestellt.
![]()
![]()
«QWSTION» – weshalb der Name?
Christian: Wir haben seit Anbeginn stets geltende Normen hinterfragt, um neue Antworten zu finden, da schien uns der Name «QWSTION» passend.
![]()
Wie kam es zur Idee «QWSTION» x «Soeder» Pop-Up Store in Basel und was bietet dieser?
Hanna: Wir kennen uns seit langem, schon vor den Zeiten von «QWSTION» und «Soeder». Es ist eine Freundschaft entstanden, die uns verbindet und dazu noch das beidseitige Verständnis für Nachhaltigkeit. Beide Firmen arbeiten auch auf einer freundschaftlichen Basis, es erfüllt uns zur Arbeit zu gehen. Das heisst, dass wir natürlich gerne mit guten Leuten arbeiten und es war nun wieder an die Zeit gemeinsam etwas zu machen.
Christian: Wir wollen mit unserem Temporary Shop zeigen, wie gross das Potential von Pflanzen als Rohstoff für gute Alltagsprodukte ist, und dass man bei vielen Dingen auf Plastik oder andere erdöl-basierte Inhaltsstoffe gänzlich verzichten kann. Zudem bringen wir das Handwerk zurück in die Stadt. Wir verfolgen beide das Ziel eines verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, wozu ebenso gehört, dass wir im Pop-Up Store Reparaturen, Refills und Recycling anbieten.
![]()
![]()
Worauf legt ihr persönlich Wert beim Einkaufen von Produkten für den Store bzw. privat?
Hanna: Langlebigkeit und gesunde Rohstoffe. Es ist nur frustrierend, wenn Produkte kaputt gehen vor der eigentlichen Lebenszeit. Sachen wegwerfen tut weh und somit kaufe ich stets für einen langen Zeithorizont ein. Lieber länger auf etwas warten, statt spontan und schnellebig einzukaufen, das ist meine Devise. Für den Store kaufen wir nichts ein, wir designen und produzieren selber oder lassen es bei bekannten Betrieben produzieren.
Christian: Privat kaufe ich generell bei kleinen Läden oder Brands und meide die grossen Konzerne. Die Kleinen sind oft transparenter, was Ressourcen und Lieferketten angeht.
![]()
Wo in Basel treibt ihr euch am liebsten rum?
Hanna: Ich liebe Kunst und da ich selber mit der Arbeit keine Zeit habe, selber etwas zu schaffen, gehe ich gern in Museen. Basel ist ja extrem gut in diesem Bereich. Das neue Kunstmuseum ist traumhaft ebenso Fondation Beyeler, Tinguely, S AM, Schaulager oder Museum der Kulturen – die Aufzählung hört ja nicht auf in Basel. Auch die Architektur in Basel ist etwas, was man sich stundenlang anschauen kann. Der «Soeder» Store war ja früher in einem super schönen Haus von Herzog de Meuron an der Schützenmattstrasse in Basel. Nun sind wir um die Ecke von einem meiner Lieblingsorte von mir, der Jazzcampus von Buol&Zünd Architekten.
Christian: Architektonisch hat Basel wirklich sehr viel zu bieten. Mir gefällt der Mut zum Unkonventionellen. Die Läden in der St. Johanns-Vorstadt sind meine Favoriten, wenn ich etwas brauche, insbesondere Ooid Store und Grimsel.
![]()
![]()
Und wo in Zürich muss man unbedingt hin, wenn man nicht gerade bei QWSTION oder Soeder einkauft?
Christian: Eine Führung durch die Sammlung des Museums für Gestaltung ist sehr inspirierend, da sind zum Beispiel einzigartige Möbel von LeCorbusier/Perriand/Jeanneret, Willy Guhl und Trix&Robert Haussmann. Im charmanten, kleinen «Coffee» an der Grüngasse ist der Name Programm, aber auch der Brunch am Samstag ist für mich ein Highlight. Für Aperitif gehe ich gerne in die «Gamper-Bar», für radikal saisonal und lokales Essen in die «Wirtschaft im Franz», und für Cocktails in die «Central Bar».
Hanna: Im «Hammam Stadtbad» Zürich kann man sich nach dem Einkaufen sehr schön entspannen. Dann etwas kleines bei «Maison Manesse» essen gehen und sich ein Glas Wein in der Cafe Bar «Meierei» gönnen. So sieht ein traumhafter Tag für mich aus.
![]()
Beschreibt eure Kundschaft in 3 treffenden Worten.
Hanna: Fast jedes alter, Geschlecht und Hintergrund. Vor allem mit den Pflegeprodukten stossen wir auf breites Interesse. Im Bad zuhause wie im 5 Sterne Hotel sind wir zu finden.
Christian: Neugierig, verantwortungsvoll, stilbewusst. Ich denke unsere Brands haben beide ein sehr breites Spektrum an Kunden. Teils sind es Menschen, die sehr bewusst einkaufen, und genau wissen wollen, wie das Produkt hergestellt wurde, teils gefallen ganz einfach das Design und die praktischen Aspekte.
![]()
![]() Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre welches wäre das und weshalb?
Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre welches wäre das und weshalb?
Hanna: Ein Hamster. Wir hatten das Gefühl, dass alles still steht und gleichzeitig sind wir immer schneller gerannt in unserem sich immer schneller drehenden Rad (lacht).
Christian: Ein Blauwal. Mir hat es vor Augen geführt, wie wenig wir Menschen wissen und wie klein wir eigentlich sind.
![]()
Welche Atmosphäre findet sich im Pop-Up Store und welche Musik widerspiegelt diese am besten?
Hanna: Christian, du hast da vielleicht eine gute Antwort? Ich bin nicht so musikalisch. Vielleicht arbeiten deswegen so viele Musiker*innen bei uns, dann muss ich mich nicht mehr um die Musik kümmern (lacht).
Christian: Die Atmosphäre ist auf jeden Fall kreativ und positiv. Die vielen Pflanzen, welche für unsere Produkte ja die erneuerbare Rohstoff-Basis bilden, haben eine sehr beruhigende Wirkung, sind aber gleichzeitig auch vielfältig und raffiniert. «Age of Consent» von New Order bringt das gut rüber.
![]()
Wenn ihr 10 Jahre in die Zukunft schaut, was seht ihr?
Beide: Wir machen das Gleiche, aber noch besser und vielleicht anders. Wahrscheinlich sind wir auch in anderen Feldern tätig als nur Taschen, Kosmetika und Kleider. Wir basieren ja unsere Unternehmen auf einer Philosophie und Überzeugung. Dies kann man auf alles übertragen, was uns interessiert. Und es interessiert uns vieles, wir wollen uns weiter entwickeln, das treibt uns an.
Wie wär’s mal mit...
Hanna: Kaffee!
Christian: ...weniger aber besser!
![]()
Vielen Dank an Christian und Hanna für die spanennden Einblicke und Projekte rund um die Schweizer Brands «QWSTION» und «Soeder» und auf viele weitere nachhaltige Produkte.
_
von Ana Brankovic
am 26.10.2020
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Die beiden Schweizer Brands «QWSTION» und «Soeder» schliessen sich für einen Pop-Up Store in Basel zusammen. Vor Ort gibt es nicht nur zahlreiche tolle Produkte sondern auch Einblicke in Designprozesse sowie einen Showroom. Christian Kaegi von «QWSTION» und Hanna Åkerström von «Soeder» erzählen uns in einem Gespräch mehr über Nachhaltigkeit, die Liebe zum Detail und Materialien sowie zur Zusammenarbeit vor allem in Zeiten von Social Distancing.

Lieber Christian, liebe Hanna, wer seid ihr und was inspiriert euch so im Leben?
Christian: Ich bin mit Werkstatt und Nähmaschine in der Nähe von Zürich aufgewachsen und habe schon als Kind die wildesten Ideen aufskizziert, oft auch gebaut oder eher gebastelt (lacht). Dass sowas mal mein Beruf werden könnte, habe ich erst viel später realisiert und dann Industrial Design studiert. Mich interessieren Materialien, Herstellungsprozesse, kultureller Kontext, Zusammenhänge. All dies spielt in meinem Designverständnis eine Rolle und ich kann mich bei «QWSTION» ständig damit befassen. Hanna und ich haben uns vor mehr als 10 Jahren über gemeinsame Freund*innen kennengelernt, und hatten beide immer Freude an gut gestalteten, sinnvollen Dingen.

Hanna: Ich bin Schweden aufgewachsen, habe aber habe mein ganzes Erwachsenenleben in der Schweiz verbracht. Als 19 Jährige habe ich ein Austauschsemester in der Schweiz gemacht und bin natürlich hängen geblieben. Nach einem Jahr in den Bergen folgten 6 Jahre an der Architekturabteilung der ETH in Zürich. Danach arbeitete ich einige Jahre als Architektin in Zürich, habe einen schwedischen Mann getroffen, Kinder bekommen und nebenbei noch «Soeder» mit ihm gegründet. Ich bin gerne leidenschaftlich kreativ, komme aber leider nicht oft dazu wegen allem anderen im Leben. Meine Tage verbringe ich glücklicherweise mit dem sehr sehr vielfältigen Job bei «Soeder. Der Job ist kreativ, sehr vielfältig und spannend. Freizeit? Das Wort sagt mir schon was, hatte ich früher öfters, bevor mein Leben zusammengeschmolzen ist mit «Soeder». Nun ist «Soeder» das, was wir machen, womit unsere Kinder gross werden und das, was wir im Sommer mit in die Ferien nehmen.

Wie sind «QWSTION» bzw. «Soeder» in Zürich entstanden?
Christian: Ich war auf der Suche nach einer Tasche, welche den Spagat zwischen Funktionalität und zeitlosem Design macht und genauso auf dem Fahrrad überzeugt, wie in einem formelleren Kontext. Verantwortungsvolle Herstellung war für mich immer zwingend und erneuerbare, natürliche Ressourcen sollten die Basis bilden. Auch meine Mitgründer Hannes, Matthias, Fabrice und Sebastian konnten eine solche Tasche nicht finden, weshalb wir uns 2008 daran machten, diese selber herzustellen.
Hanna: Wir haben in 2013 die Firma gegründet und auch den «Soeder» Store aufgemacht. Alles basierte auf unserer Überzeugung, dass zukunftsfähiger Konsum nachhaltig sein muss. Unsere Produkte wurden seither immer langlebig designt, aus nachhaltigen Materialien produziert und in Europa hergestellt.


«QWSTION» – weshalb der Name?
Christian: Wir haben seit Anbeginn stets geltende Normen hinterfragt, um neue Antworten zu finden, da schien uns der Name «QWSTION» passend.

Wie kam es zur Idee «QWSTION» x «Soeder» Pop-Up Store in Basel und was bietet dieser?
Hanna: Wir kennen uns seit langem, schon vor den Zeiten von «QWSTION» und «Soeder». Es ist eine Freundschaft entstanden, die uns verbindet und dazu noch das beidseitige Verständnis für Nachhaltigkeit. Beide Firmen arbeiten auch auf einer freundschaftlichen Basis, es erfüllt uns zur Arbeit zu gehen. Das heisst, dass wir natürlich gerne mit guten Leuten arbeiten und es war nun wieder an die Zeit gemeinsam etwas zu machen.
Christian: Wir wollen mit unserem Temporary Shop zeigen, wie gross das Potential von Pflanzen als Rohstoff für gute Alltagsprodukte ist, und dass man bei vielen Dingen auf Plastik oder andere erdöl-basierte Inhaltsstoffe gänzlich verzichten kann. Zudem bringen wir das Handwerk zurück in die Stadt. Wir verfolgen beide das Ziel eines verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, wozu ebenso gehört, dass wir im Pop-Up Store Reparaturen, Refills und Recycling anbieten.


Worauf legt ihr persönlich Wert beim Einkaufen von Produkten für den Store bzw. privat?
Hanna: Langlebigkeit und gesunde Rohstoffe. Es ist nur frustrierend, wenn Produkte kaputt gehen vor der eigentlichen Lebenszeit. Sachen wegwerfen tut weh und somit kaufe ich stets für einen langen Zeithorizont ein. Lieber länger auf etwas warten, statt spontan und schnellebig einzukaufen, das ist meine Devise. Für den Store kaufen wir nichts ein, wir designen und produzieren selber oder lassen es bei bekannten Betrieben produzieren.
Christian: Privat kaufe ich generell bei kleinen Läden oder Brands und meide die grossen Konzerne. Die Kleinen sind oft transparenter, was Ressourcen und Lieferketten angeht.

Wo in Basel treibt ihr euch am liebsten rum?
Hanna: Ich liebe Kunst und da ich selber mit der Arbeit keine Zeit habe, selber etwas zu schaffen, gehe ich gern in Museen. Basel ist ja extrem gut in diesem Bereich. Das neue Kunstmuseum ist traumhaft ebenso Fondation Beyeler, Tinguely, S AM, Schaulager oder Museum der Kulturen – die Aufzählung hört ja nicht auf in Basel. Auch die Architektur in Basel ist etwas, was man sich stundenlang anschauen kann. Der «Soeder» Store war ja früher in einem super schönen Haus von Herzog de Meuron an der Schützenmattstrasse in Basel. Nun sind wir um die Ecke von einem meiner Lieblingsorte von mir, der Jazzcampus von Buol&Zünd Architekten.
Christian: Architektonisch hat Basel wirklich sehr viel zu bieten. Mir gefällt der Mut zum Unkonventionellen. Die Läden in der St. Johanns-Vorstadt sind meine Favoriten, wenn ich etwas brauche, insbesondere Ooid Store und Grimsel.


Und wo in Zürich muss man unbedingt hin, wenn man nicht gerade bei QWSTION oder Soeder einkauft?
Christian: Eine Führung durch die Sammlung des Museums für Gestaltung ist sehr inspirierend, da sind zum Beispiel einzigartige Möbel von LeCorbusier/Perriand/Jeanneret, Willy Guhl und Trix&Robert Haussmann. Im charmanten, kleinen «Coffee» an der Grüngasse ist der Name Programm, aber auch der Brunch am Samstag ist für mich ein Highlight. Für Aperitif gehe ich gerne in die «Gamper-Bar», für radikal saisonal und lokales Essen in die «Wirtschaft im Franz», und für Cocktails in die «Central Bar».
Hanna: Im «Hammam Stadtbad» Zürich kann man sich nach dem Einkaufen sehr schön entspannen. Dann etwas kleines bei «Maison Manesse» essen gehen und sich ein Glas Wein in der Cafe Bar «Meierei» gönnen. So sieht ein traumhafter Tag für mich aus.

Beschreibt eure Kundschaft in 3 treffenden Worten.
Hanna: Fast jedes alter, Geschlecht und Hintergrund. Vor allem mit den Pflegeprodukten stossen wir auf breites Interesse. Im Bad zuhause wie im 5 Sterne Hotel sind wir zu finden.
Christian: Neugierig, verantwortungsvoll, stilbewusst. Ich denke unsere Brands haben beide ein sehr breites Spektrum an Kunden. Teils sind es Menschen, die sehr bewusst einkaufen, und genau wissen wollen, wie das Produkt hergestellt wurde, teils gefallen ganz einfach das Design und die praktischen Aspekte.
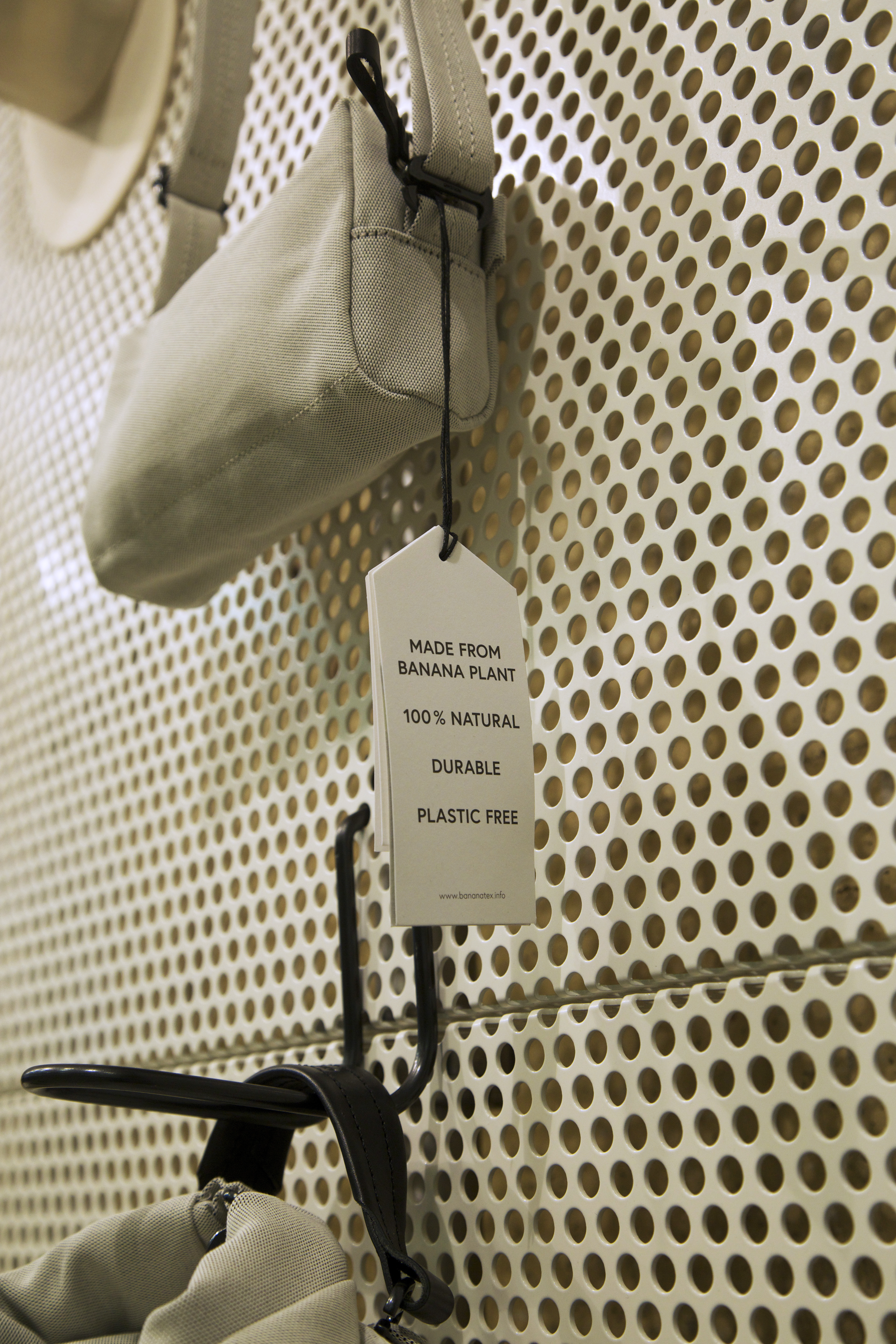
 Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre welches wäre das und weshalb?
Wenn das Jahr 2020 ein Tier wäre welches wäre das und weshalb? Hanna: Ein Hamster. Wir hatten das Gefühl, dass alles still steht und gleichzeitig sind wir immer schneller gerannt in unserem sich immer schneller drehenden Rad (lacht).
Christian: Ein Blauwal. Mir hat es vor Augen geführt, wie wenig wir Menschen wissen und wie klein wir eigentlich sind.

Welche Atmosphäre findet sich im Pop-Up Store und welche Musik widerspiegelt diese am besten?
Hanna: Christian, du hast da vielleicht eine gute Antwort? Ich bin nicht so musikalisch. Vielleicht arbeiten deswegen so viele Musiker*innen bei uns, dann muss ich mich nicht mehr um die Musik kümmern (lacht).
Christian: Die Atmosphäre ist auf jeden Fall kreativ und positiv. Die vielen Pflanzen, welche für unsere Produkte ja die erneuerbare Rohstoff-Basis bilden, haben eine sehr beruhigende Wirkung, sind aber gleichzeitig auch vielfältig und raffiniert. «Age of Consent» von New Order bringt das gut rüber.

Wenn ihr 10 Jahre in die Zukunft schaut, was seht ihr?
Beide: Wir machen das Gleiche, aber noch besser und vielleicht anders. Wahrscheinlich sind wir auch in anderen Feldern tätig als nur Taschen, Kosmetika und Kleider. Wir basieren ja unsere Unternehmen auf einer Philosophie und Überzeugung. Dies kann man auf alles übertragen, was uns interessiert. Und es interessiert uns vieles, wir wollen uns weiter entwickeln, das treibt uns an.
Wie wär’s mal mit...
Hanna: Kaffee!
Christian: ...weniger aber besser!

Vielen Dank an Christian und Hanna für die spanennden Einblicke und Projekte rund um die Schweizer Brands «QWSTION» und «Soeder» und auf viele weitere nachhaltige Produkte.
_
von Ana Brankovic
am 26.10.2020
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Kunsthaus Baselland: Im Gespräch mit Ines Goldbach
Ob Events wie die Oslo Night oder Ausstellungen sowie weitere spannende Formate, das Dreispitz in Basel befindet sich in stetigem Wandel. Nun zieht auch das «Kunsthaus Baselland» von Muttenz in die Dreispitzhalle. Wir sprachen mit Direktorin Ines Goldbach über Wandel, das Hier und Jetzt, Kunst und Kultur in Zeiten von COVID-19 und vieles mehr.
Liebe Ines Goldbach, wer bist du und was inspiriert dich im Alltag?
Wer ich bin? Hoffentlich heute nicht jene, die ich gestern war, sondern schon einen Schritt weiter (lacht). Mein wichtigster Motor sind sicher Familie, Kinder, Freund*innen und der stete Austausch mit Künstler*innen, gemischt mit einer grossen Passion für die Sache und reichlich Humor – bei all dem, was täglich auf einen einstürzt, darf das Lachen nie kurz kommen.
![]()
Du bist Direktorin des «Kunsthaus Baselland». Wie kam es dazu?
Wenn ich Dinge mitgestalten kann, inspiriert mich das schon sehr. Das «Kunsthaus Baselland» ist in meinen Augen das perfekte Instrument dafür: Ich kann sowohl mit den Künstler*innen arbeiten, die in der Region und direkt hier vor Ort tätig sind – das ist ein ständiger toller Austausch; und zugleich kann ich sie mit internationalen Positionen zusammenführen und daraus wiederum Neues entstehen lassen. Das direkte Miteinander von Nah und Fern ist mir eine wichtige Triebfeder.
Bevor ich vor einigen Jahren ans Kunsthaus kam, war ich viele Jahre an den Hallen für Neue Kunst in Schaffhausen für die Raussmüller Collection tätig und konnte dort auf Tuchfühlung mit Künstler*innen gehen, darunter Robert Ryman oder Jannis Kounellis. Das hat mich schon sehr geprägt. Auch hatte ich das grosse Glück, durch einen Stiefvater als Künstler in einem künstlerischen Umfeld aufzuwachsen – die tagtägliche Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Kunst und vor allem der tägliche Austausch mit Künstler*innen ist mir daher nicht nur vertraut, sondern gehört untrennbar zu meinem Leben und Alltag.
![]()
Welche Veränderungen siehst du für Kunst und Kultur in Zeiten von Covid-19?
Für viele Künstler*innen und Kulturschaffende allgemein war und ist diese Zeit dramatisch, und es wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben. Finanziell ist die Lage für sehr viele aktuell äusserst prekär, Ausstellungen und Projekte wurden abgesagt oder verschoben, Galerien müssen teilweise Konkurs anmelden und sich damit von Künstler*innen trennen. Das Planbare fällt aktuell weg; was heute noch stimmt, kann morgen aufgrund von neuesten Entwicklungen wieder ganz anders sein. Diese Unsicherheit ist sehr ungewohnt und eine neue Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Positiv betrachtet verlangt diese Zeit, die gerade erst begonnen hat, von uns eine grösstmögliche Agilität und damit auch Flexibilität. Meines Erachtens ist es daher auch noch mehr gefragt, dass wir zusammenhalten und gemeinsam Projekte stemmen. Reüssieren in dieser Zeit können wir nur gemeinsam.
![]()
Wie haben die Pandemie und die damit einhergehenden Massnahmen sowohl deinen Arbeitsalltag, die Kunst und Kultur sowie deinen persönlichen Alltag geprägt?
Einerseits verlangen uns all die Massnahmen, die immer wieder beschlossen, umgesetzt, evaluiert und dann wieder angepasst werden mussten und müssen, sehr viel Kraft und auch finanzielle Ressourcen ab. Ein Kunsthaus zu leiten, hat Ähnlichkeiten damit, ein Unternehmen zu leiten: Man hat Verantwortung für die MitarbeiterInnen, muss das Budget im Griff haben, viele Entscheidungen treffen, ob man nun dies oder jenes macht, Ausstellungen respektive andere Veranstaltungen verschiebt oder doch ansetzt, wie die Prognosen sind usw. Alle Kunst- und Kulturinstitutionen mussten und müssen in dieser Zeit viel (ver-)schieben, ändern, wieder schieben usw. Um aber auch hier einen positiven Aspekt hineinzubringen: Diese Zeit erlaubt es auch, Dinge auszuprobieren und Formate zu entwickeln, die es bislang noch nicht gab, weil sie vielleicht nicht notwendig erschienen. So haben wir neben zahlreichen Online-Angeboten, Live-Streams, Online-Führungen, Künstler*inneninterviews als Videoserie, einer Kunstseitenserie in der Basellandschaftlichen Zeitung, auch das Kulturtelefon ins Leben gerufen, eine Art wöchentliche Kunsthotline, bei der man sich mit uns direkt über Kunstwerke in den Ausstellungen unterhalten konnte. Einige dieser Angeboten waren so erfolgreich, dass wir versuchen werden, sie weiterzuführen, wenn es die Finanzen zulassen.
![]()
Was war oder ist dein persönliches Highlight der Oslo Night und was ist neu in diesem Jahr 2020?
Das «Kunsthaus Baselland» ist nun seit drei Jahren an der Oslo Night mit dabei, in den Räumlichkeiten der Dreispitzhalle, dem zukünftigen Zuhause des Kunsthauses. Das grösste Highlight ist der Abend selbst, und dabei der Zusammenschluss der unterschiedlichsten Institutionen wie dem HeK, der Hochschule, dem Radio X, Atelier Mondial usw. Natürlich freue ich mich auch sehr auf unsere beiden Gemeinschaftsprojekte mit meiner Kollegin, Sabine Himmelsbach, Direktorin des HeK: wir haben einerseits die Künstlerin Simone Steinegger eingeladen, speziell für die Oslo Night ein neues Werk zu produzieren; andererseits hat die Kuratorin Chantal Molleur ein Screening aus speziellen kürzeren und längeren Filmarbeiten zusammengestellt, die teils noch nicht in der Schweiz zu sehen waren. Zwei unheimlich spannende Kooperationsprojekte also. Ein solcher Abend wie die Oslo Night in seiner vollen Breite zeigt doch genau, was dieses Areal kann und welches Potenzial es hat, eben genau dann, wenn alle Partner zusammenspannen, die Öffentlichkeit und im Speziellen auch die AnwohnerInnen runter auf den Platz kommen und diesen Abend geniessen. Das ist doch eine grossartige Vision dafür, wie wir in Zukunft Kultur zusammen gestalten und vermitteln können – nicht nur für einen Abend.
![]()
Vieles spielt sich zurzeit rund um den Freilager-Platz im Dreispitz ab. Welches Potenzial siehst du für diesen Ort?
Es stimmt, dass momentan vieles auf den Platz hin ausgerichtet ist, aber auch hier sehe ich ein wunderbares Potenzial für die Zukunft – dass sich der Blick weiten und in alle Richtungen ausstrecken lässt. Der aktuelle Zugang zur Dreispitzhalle etwa ist auf der gegenüber liegenden Helsinki-Strasse, und der Plan für das neue Kunsthaus ist es, zwei Eingänge zu haben – von beiden Seiten also. Vielleicht könnte man sagen, dass der Platz sich in konzentrischen Zeiten weiter ausdehnt und mit ihm die Aktivitäten auf dem gesamten Areal. Das ist eben jene Chance der Mitgestaltung, die ich vorhin meinte, und auch das, was die BesucherInnen an einem solchen Abend wie der Oslo Night geniessen: einerseits die tollen Orte rund um den Platz, aber auch das weiterentdecken in andere Richtungen wie die Helsinki-Strasse, das Elysia. Und auch das grossartige Schaulager ist ja nur wenige Schritte weit entfernt.
![]()
Auch das «Kunsthaus Baselland» wird von Muttenz in die Dreispitzhalle ziehen. Weshalb macht das Sinn, und wie siehst du die Entwicklung dieses kreativen Areals rund um die Hochschule für Gestaltung und Kunst, den Club Elysia sowie das Haus für elektronische Künste oder Radio X in 5 bis 10 Jahren?
Das Dreispitzareal muss man eher als eine neue Stadt in der Stadt ansehen, die mitten am Entstehen ist und die wir aktiv mitgestalten können. Selbstverständlich ist daher in diesem Moment noch vieles nicht fertig, noch roh, aber genau das hat seinen Reiz – fast kommt mir der Ort vor wie ein grosser Freiraum, in welchem in Zukunft noch viel möglich sein kann. Dafür braucht es Offenheit, ja, auch Mittel, es braucht aber auch all jene, die sich für diesen Ort mitentscheiden und vor allem auch entscheiden, ihn mitzugestalten und ihm sein unverwechselbares Gesicht zu geben. Ich bin davon überzeugt, dass wir – wenn alle jene, die dort schon sind, und auch jene, die mittel- und langfristig dort hinkommen werden, das Momentum einer gemeinsamen Vision nutzen – dort einen Ort schaffen können, der Wohn-, Arbeits- und vor allem eine hohe Lebensqualität hat, angereichert mit viel Kunst und Kultur.
![]()
Wo in Basel hältst du dich am liebsten auf, wenn du gerade nicht im «Kunsthaus Baselland» oder an der «Oslo Night» anzutreffen bist?
Am liebsten halte ich mich tatsächlich in der Kunst auf und komme dafür hier in Basel natürlich wunderbar auf meine Kosten. Ein Ausstellungs- oder Museumsbesuch bewirkt für mich oft das Gleiche wie ein Spaziergang am Wasser oder inmitten der Natur – wie ein frischer Wind, der einem um den Kopf weht. Das geniesse ich auch so, wenn ich aktuell öfters vom jetzigen Kunsthaus zum Dreispitz wechseln muss und ein bisschen mehr Zeit habe: Dann gönne ich mir einen Spaziergang quer durch die Merian Gärten – was für eine wunderbare Oase! Da gibt es ja auch Ideen, wie dieser Ort noch besser vom Dreispitz aus erschlossen werden kann – das wäre ein grosser Gewinn. Und natürlich springe ich an warmen Tagen auch gerne mal ins Wasser.
![]()
Wieso sollte man deiner Meinung nach Kunst und Kultur im Jahr 2020 mehr denn je feiern und unterstützen?
Feiern ist vielleicht nicht der Begriff, den ich wählen würde, aber nutzen. Ja, das glaube ich, dass wir gerade aktuell Kunst und Kultur besonders für uns nutzen und davon Gebrauch machen sollten. Die Auseinandersetzung kann eine geistige, erholsame und auch äusserst inspirierende Nahrung für uns sein. Das sieht man vielleicht nicht immer so, sondern denkt, Kunst und Ausstellungen zu besichtigen, sei eher anstrengend. Genau aber in Krisenzeiten können Künstler*innen uns Wege aufzeigen, wie wir gewohnte Bahnen aufgeben und zu neuen Ufern aufbrechen können – das scheint mit hier und heute eine sehr wichtige Qualität.
![]()
Welches Potenzial siehst du vor allem in Basel und der Schweiz für junge Künstler*innen und Kreativschaffende?
Zu allererst sehe ich vor allem deswegen ein grosses Potenzial in der Schweiz in Sachen Kunstschaffen, gerade weil es eben so viele hochkarätige Kunstschaffende gibt, die sowohl aus der Schweiz stammen als auch aus dem Ausland hier für eine kürzere oder längere Zeit hier leben und sich hier auch zusammen austauschen, einander begegnen. Das ist in dieser Form nicht mit anderen Ländern zu vergleichen – wenn man dazu bereit ist, kann man hier unheimlich gut zusammenarbeiten und zusammenwirken, sei es als Kunst- oder auch als Kulturschaffende.
![]()
Was muss sich in Kunst- und Kulturinstitutionen drastisch ändern, um eine Veränderung bzw. einen Fortschritt zu bewirken – vielleicht auch gerade in Zusammenhang mit «Institutional Racism» und der «Black Lives Matter» Bewegung?
In Sachen Veränderungen müssen wir uns sicher immer mehr von dem Glauben lösen, dass alles planbar und kontrollierbar ist – das gilt natürlich nicht für die Kulturinstitutionen. Wir müssen besser lernen, mit dem Spontanen umzugehen – das ist für eine Institution nicht einfach, deren Überleben oft vom Planen, finanziellen Absichern und auch von Kontinuität abhängt. Das ist sicher ein Spagat, den es zu schaffen gilt. Das andere, was du ansprichst, geht für mich in eine sehr wichtige andere Richtung, bei der es nicht nur um die Frage geht, wie wir uns vor dem Hintergrund von Black Lives Matter verhalten sollen und müssen: Wir müssen einander noch mit weitaus mehr Verantwortung und Respekt gegenübertreten und die Gesellschaft als Ganzes sehen. Für eine Institution sehe ich hier die wichtige Aufgabe, dass man den Weitblick nicht nur schärft, sondern auch lebt – neben Künstlern ganz selbstverständlich auch Künstlerinnen zeigt, neben jüngeren Positionen auch ältere, neben internationalen Kunstschaffenden auch regionale usw.; oder dass man im Team junge Frauen und ausdrücklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert. Es gibt unzählige Themen und Bereiche, auf die wir heute besser und auch sensibler reagieren können und müssen. Und die Kunst kann uns oftmals gerade zu dieser Bewusstseinsschärfung und Offenheit helfen. Wir sind in so vielen Bereichen noch lange nicht dort, wo wir sein könnten.
![]()
Wenn du die «Oslo Night» als ein Tier beschreiben müsstest, welches wäre das?
Ein Chamäleon, das sich am Nachmittag bunt und lustig mit den Familien tummelt, gegen Abend sein Kleid wechselt, um uns in Räume zu führen, die wir so noch nicht gesehen haben – und verführerisch aufregend in einem neuen Gewand in die Nacht hinübergleitet.
![]()
Wenn es für die Kulturbranche etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das?
Finanzen geben immer Freiheiten, um etwas umsetzen zu können, Kreativität braucht es, um die Finanzen auch intelligent und innovativ einzusetzen. Ich wünsche also der Kulturbranche einen warmen Sommerregen aus eben diesen beiden wichtigen Triebfedern.
![]()
Wie wär’s mal mit..?
...einem grossen Zusammenhalt, in welchem wir lustvoll, mit Energie und Passion gemeinsam ins Morgen gehen – oder durch eine Nacht wie die die «Oslo Night». Heute, hier und jetzt. Fürs Zusammenhalten braucht es keine Distanzregelung.
![]()
Vielen Dank an Ines Goldbach für die spanennden Einblicke in den Kunst- und Kulturbereich und das Vorantreiben von spannenden Projekten und Formaten.
_
von Ana Brankovic
am 14.09.2020
Fotos
© Marcause Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Ob Events wie die Oslo Night oder Ausstellungen sowie weitere spannende Formate, das Dreispitz in Basel befindet sich in stetigem Wandel. Nun zieht auch das «Kunsthaus Baselland» von Muttenz in die Dreispitzhalle. Wir sprachen mit Direktorin Ines Goldbach über Wandel, das Hier und Jetzt, Kunst und Kultur in Zeiten von COVID-19 und vieles mehr.
Liebe Ines Goldbach, wer bist du und was inspiriert dich im Alltag?
Wer ich bin? Hoffentlich heute nicht jene, die ich gestern war, sondern schon einen Schritt weiter (lacht). Mein wichtigster Motor sind sicher Familie, Kinder, Freund*innen und der stete Austausch mit Künstler*innen, gemischt mit einer grossen Passion für die Sache und reichlich Humor – bei all dem, was täglich auf einen einstürzt, darf das Lachen nie kurz kommen.

Du bist Direktorin des «Kunsthaus Baselland». Wie kam es dazu?
Wenn ich Dinge mitgestalten kann, inspiriert mich das schon sehr. Das «Kunsthaus Baselland» ist in meinen Augen das perfekte Instrument dafür: Ich kann sowohl mit den Künstler*innen arbeiten, die in der Region und direkt hier vor Ort tätig sind – das ist ein ständiger toller Austausch; und zugleich kann ich sie mit internationalen Positionen zusammenführen und daraus wiederum Neues entstehen lassen. Das direkte Miteinander von Nah und Fern ist mir eine wichtige Triebfeder.
Bevor ich vor einigen Jahren ans Kunsthaus kam, war ich viele Jahre an den Hallen für Neue Kunst in Schaffhausen für die Raussmüller Collection tätig und konnte dort auf Tuchfühlung mit Künstler*innen gehen, darunter Robert Ryman oder Jannis Kounellis. Das hat mich schon sehr geprägt. Auch hatte ich das grosse Glück, durch einen Stiefvater als Künstler in einem künstlerischen Umfeld aufzuwachsen – die tagtägliche Beschäftigung und Auseinandersetzung mit Kunst und vor allem der tägliche Austausch mit Künstler*innen ist mir daher nicht nur vertraut, sondern gehört untrennbar zu meinem Leben und Alltag.

Welche Veränderungen siehst du für Kunst und Kultur in Zeiten von Covid-19?
Für viele Künstler*innen und Kulturschaffende allgemein war und ist diese Zeit dramatisch, und es wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben. Finanziell ist die Lage für sehr viele aktuell äusserst prekär, Ausstellungen und Projekte wurden abgesagt oder verschoben, Galerien müssen teilweise Konkurs anmelden und sich damit von Künstler*innen trennen. Das Planbare fällt aktuell weg; was heute noch stimmt, kann morgen aufgrund von neuesten Entwicklungen wieder ganz anders sein. Diese Unsicherheit ist sehr ungewohnt und eine neue Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Positiv betrachtet verlangt diese Zeit, die gerade erst begonnen hat, von uns eine grösstmögliche Agilität und damit auch Flexibilität. Meines Erachtens ist es daher auch noch mehr gefragt, dass wir zusammenhalten und gemeinsam Projekte stemmen. Reüssieren in dieser Zeit können wir nur gemeinsam.

Wie haben die Pandemie und die damit einhergehenden Massnahmen sowohl deinen Arbeitsalltag, die Kunst und Kultur sowie deinen persönlichen Alltag geprägt?
Einerseits verlangen uns all die Massnahmen, die immer wieder beschlossen, umgesetzt, evaluiert und dann wieder angepasst werden mussten und müssen, sehr viel Kraft und auch finanzielle Ressourcen ab. Ein Kunsthaus zu leiten, hat Ähnlichkeiten damit, ein Unternehmen zu leiten: Man hat Verantwortung für die MitarbeiterInnen, muss das Budget im Griff haben, viele Entscheidungen treffen, ob man nun dies oder jenes macht, Ausstellungen respektive andere Veranstaltungen verschiebt oder doch ansetzt, wie die Prognosen sind usw. Alle Kunst- und Kulturinstitutionen mussten und müssen in dieser Zeit viel (ver-)schieben, ändern, wieder schieben usw. Um aber auch hier einen positiven Aspekt hineinzubringen: Diese Zeit erlaubt es auch, Dinge auszuprobieren und Formate zu entwickeln, die es bislang noch nicht gab, weil sie vielleicht nicht notwendig erschienen. So haben wir neben zahlreichen Online-Angeboten, Live-Streams, Online-Führungen, Künstler*inneninterviews als Videoserie, einer Kunstseitenserie in der Basellandschaftlichen Zeitung, auch das Kulturtelefon ins Leben gerufen, eine Art wöchentliche Kunsthotline, bei der man sich mit uns direkt über Kunstwerke in den Ausstellungen unterhalten konnte. Einige dieser Angeboten waren so erfolgreich, dass wir versuchen werden, sie weiterzuführen, wenn es die Finanzen zulassen.

Was war oder ist dein persönliches Highlight der Oslo Night und was ist neu in diesem Jahr 2020?
Das «Kunsthaus Baselland» ist nun seit drei Jahren an der Oslo Night mit dabei, in den Räumlichkeiten der Dreispitzhalle, dem zukünftigen Zuhause des Kunsthauses. Das grösste Highlight ist der Abend selbst, und dabei der Zusammenschluss der unterschiedlichsten Institutionen wie dem HeK, der Hochschule, dem Radio X, Atelier Mondial usw. Natürlich freue ich mich auch sehr auf unsere beiden Gemeinschaftsprojekte mit meiner Kollegin, Sabine Himmelsbach, Direktorin des HeK: wir haben einerseits die Künstlerin Simone Steinegger eingeladen, speziell für die Oslo Night ein neues Werk zu produzieren; andererseits hat die Kuratorin Chantal Molleur ein Screening aus speziellen kürzeren und längeren Filmarbeiten zusammengestellt, die teils noch nicht in der Schweiz zu sehen waren. Zwei unheimlich spannende Kooperationsprojekte also. Ein solcher Abend wie die Oslo Night in seiner vollen Breite zeigt doch genau, was dieses Areal kann und welches Potenzial es hat, eben genau dann, wenn alle Partner zusammenspannen, die Öffentlichkeit und im Speziellen auch die AnwohnerInnen runter auf den Platz kommen und diesen Abend geniessen. Das ist doch eine grossartige Vision dafür, wie wir in Zukunft Kultur zusammen gestalten und vermitteln können – nicht nur für einen Abend.

Vieles spielt sich zurzeit rund um den Freilager-Platz im Dreispitz ab. Welches Potenzial siehst du für diesen Ort?
Es stimmt, dass momentan vieles auf den Platz hin ausgerichtet ist, aber auch hier sehe ich ein wunderbares Potenzial für die Zukunft – dass sich der Blick weiten und in alle Richtungen ausstrecken lässt. Der aktuelle Zugang zur Dreispitzhalle etwa ist auf der gegenüber liegenden Helsinki-Strasse, und der Plan für das neue Kunsthaus ist es, zwei Eingänge zu haben – von beiden Seiten also. Vielleicht könnte man sagen, dass der Platz sich in konzentrischen Zeiten weiter ausdehnt und mit ihm die Aktivitäten auf dem gesamten Areal. Das ist eben jene Chance der Mitgestaltung, die ich vorhin meinte, und auch das, was die BesucherInnen an einem solchen Abend wie der Oslo Night geniessen: einerseits die tollen Orte rund um den Platz, aber auch das weiterentdecken in andere Richtungen wie die Helsinki-Strasse, das Elysia. Und auch das grossartige Schaulager ist ja nur wenige Schritte weit entfernt.

Auch das «Kunsthaus Baselland» wird von Muttenz in die Dreispitzhalle ziehen. Weshalb macht das Sinn, und wie siehst du die Entwicklung dieses kreativen Areals rund um die Hochschule für Gestaltung und Kunst, den Club Elysia sowie das Haus für elektronische Künste oder Radio X in 5 bis 10 Jahren?
Das Dreispitzareal muss man eher als eine neue Stadt in der Stadt ansehen, die mitten am Entstehen ist und die wir aktiv mitgestalten können. Selbstverständlich ist daher in diesem Moment noch vieles nicht fertig, noch roh, aber genau das hat seinen Reiz – fast kommt mir der Ort vor wie ein grosser Freiraum, in welchem in Zukunft noch viel möglich sein kann. Dafür braucht es Offenheit, ja, auch Mittel, es braucht aber auch all jene, die sich für diesen Ort mitentscheiden und vor allem auch entscheiden, ihn mitzugestalten und ihm sein unverwechselbares Gesicht zu geben. Ich bin davon überzeugt, dass wir – wenn alle jene, die dort schon sind, und auch jene, die mittel- und langfristig dort hinkommen werden, das Momentum einer gemeinsamen Vision nutzen – dort einen Ort schaffen können, der Wohn-, Arbeits- und vor allem eine hohe Lebensqualität hat, angereichert mit viel Kunst und Kultur.

Wo in Basel hältst du dich am liebsten auf, wenn du gerade nicht im «Kunsthaus Baselland» oder an der «Oslo Night» anzutreffen bist?
Am liebsten halte ich mich tatsächlich in der Kunst auf und komme dafür hier in Basel natürlich wunderbar auf meine Kosten. Ein Ausstellungs- oder Museumsbesuch bewirkt für mich oft das Gleiche wie ein Spaziergang am Wasser oder inmitten der Natur – wie ein frischer Wind, der einem um den Kopf weht. Das geniesse ich auch so, wenn ich aktuell öfters vom jetzigen Kunsthaus zum Dreispitz wechseln muss und ein bisschen mehr Zeit habe: Dann gönne ich mir einen Spaziergang quer durch die Merian Gärten – was für eine wunderbare Oase! Da gibt es ja auch Ideen, wie dieser Ort noch besser vom Dreispitz aus erschlossen werden kann – das wäre ein grosser Gewinn. Und natürlich springe ich an warmen Tagen auch gerne mal ins Wasser.

Wieso sollte man deiner Meinung nach Kunst und Kultur im Jahr 2020 mehr denn je feiern und unterstützen?
Feiern ist vielleicht nicht der Begriff, den ich wählen würde, aber nutzen. Ja, das glaube ich, dass wir gerade aktuell Kunst und Kultur besonders für uns nutzen und davon Gebrauch machen sollten. Die Auseinandersetzung kann eine geistige, erholsame und auch äusserst inspirierende Nahrung für uns sein. Das sieht man vielleicht nicht immer so, sondern denkt, Kunst und Ausstellungen zu besichtigen, sei eher anstrengend. Genau aber in Krisenzeiten können Künstler*innen uns Wege aufzeigen, wie wir gewohnte Bahnen aufgeben und zu neuen Ufern aufbrechen können – das scheint mit hier und heute eine sehr wichtige Qualität.

Welches Potenzial siehst du vor allem in Basel und der Schweiz für junge Künstler*innen und Kreativschaffende?
Zu allererst sehe ich vor allem deswegen ein grosses Potenzial in der Schweiz in Sachen Kunstschaffen, gerade weil es eben so viele hochkarätige Kunstschaffende gibt, die sowohl aus der Schweiz stammen als auch aus dem Ausland hier für eine kürzere oder längere Zeit hier leben und sich hier auch zusammen austauschen, einander begegnen. Das ist in dieser Form nicht mit anderen Ländern zu vergleichen – wenn man dazu bereit ist, kann man hier unheimlich gut zusammenarbeiten und zusammenwirken, sei es als Kunst- oder auch als Kulturschaffende.

Was muss sich in Kunst- und Kulturinstitutionen drastisch ändern, um eine Veränderung bzw. einen Fortschritt zu bewirken – vielleicht auch gerade in Zusammenhang mit «Institutional Racism» und der «Black Lives Matter» Bewegung?
In Sachen Veränderungen müssen wir uns sicher immer mehr von dem Glauben lösen, dass alles planbar und kontrollierbar ist – das gilt natürlich nicht für die Kulturinstitutionen. Wir müssen besser lernen, mit dem Spontanen umzugehen – das ist für eine Institution nicht einfach, deren Überleben oft vom Planen, finanziellen Absichern und auch von Kontinuität abhängt. Das ist sicher ein Spagat, den es zu schaffen gilt. Das andere, was du ansprichst, geht für mich in eine sehr wichtige andere Richtung, bei der es nicht nur um die Frage geht, wie wir uns vor dem Hintergrund von Black Lives Matter verhalten sollen und müssen: Wir müssen einander noch mit weitaus mehr Verantwortung und Respekt gegenübertreten und die Gesellschaft als Ganzes sehen. Für eine Institution sehe ich hier die wichtige Aufgabe, dass man den Weitblick nicht nur schärft, sondern auch lebt – neben Künstlern ganz selbstverständlich auch Künstlerinnen zeigt, neben jüngeren Positionen auch ältere, neben internationalen Kunstschaffenden auch regionale usw.; oder dass man im Team junge Frauen und ausdrücklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert. Es gibt unzählige Themen und Bereiche, auf die wir heute besser und auch sensibler reagieren können und müssen. Und die Kunst kann uns oftmals gerade zu dieser Bewusstseinsschärfung und Offenheit helfen. Wir sind in so vielen Bereichen noch lange nicht dort, wo wir sein könnten.

Wenn du die «Oslo Night» als ein Tier beschreiben müsstest, welches wäre das?
Ein Chamäleon, das sich am Nachmittag bunt und lustig mit den Familien tummelt, gegen Abend sein Kleid wechselt, um uns in Räume zu führen, die wir so noch nicht gesehen haben – und verführerisch aufregend in einem neuen Gewand in die Nacht hinübergleitet.

Wenn es für die Kulturbranche etwas vom Himmel regnen könnte, was wäre das?
Finanzen geben immer Freiheiten, um etwas umsetzen zu können, Kreativität braucht es, um die Finanzen auch intelligent und innovativ einzusetzen. Ich wünsche also der Kulturbranche einen warmen Sommerregen aus eben diesen beiden wichtigen Triebfedern.

Wie wär’s mal mit..?
...einem grossen Zusammenhalt, in welchem wir lustvoll, mit Energie und Passion gemeinsam ins Morgen gehen – oder durch eine Nacht wie die die «Oslo Night». Heute, hier und jetzt. Fürs Zusammenhalten braucht es keine Distanzregelung.

Vielen Dank an Ines Goldbach für die spanennden Einblicke in den Kunst- und Kulturbereich und das Vorantreiben von spannenden Projekten und Formaten.
_
von Ana Brankovic
am 14.09.2020
Fotos
© Marcause Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Kaserne Basel: Im Gespräch mit Musiker Carl Craig
Carl Craig ist Komponist, Künstler und Visionär. Mannigfaltige Kapitel und Inspirationen treffen in seiner Musik und seinen Projekten aufeinander. In der Kaserne Basel trat er mit dem Basler Sinfonieorchester auf. Wie Techno und Klassik zusammenkommen und welche Platte er sich zuletzt gekauft hat? Wir trafen den talentierten Künstler zu einem Gespräch über spannende Klangwelten. (English version see below)
![]()
Lieber Carl, du hast mit dem Basler Sinfonieorchester in der Kaserne Basel gespielt. Was öffnete dein Gehör für klassische Musik?
Damals in den 70ern hörte ich die Musik des Jazzpianisten Ramsey Lewis mit Orchesterbegleitung. Oder Musiker wie Yusef Lateef oder Motown Records, die Künstler arbeiteten oft mit einem Orchester zusammen. Ramsey Lewis’ Orchesterversionen von Songs der Beatles haben mich beinahe mehr begeistert als die Originale.
Auf was achtest du während den Proben?
Ich versuche, zu hören und zu spüren, ob die Übersetzung die gleiche Wirkung erzeugt, die sie in mir auslöste, als ich sie damals Zuhause im Keller meiner Mutter oder bei meiner Freundin geschrieben habe. Es ist etwa wie ein Roman zu lesen. In dem Augenblick des Lesens dreht es sich hauptsächlich um die Geschichte. Versucht man die Geschichte zu interpretieren und in ein anderes Format zu bringen, dann gleicht dieser Prozess der Übersetzung meiner Musik in ein klassisches Format. Was das Orchester ausmacht, ist nicht nur das musikalische Wissen der einzelnen Musizierenden und ihre Erfahrungen, sondern auch die Gabe ihre persönlichen Emotionen ins Spielen miteinfliessen zu lassen. Die Herausforderung dabei ist meine Komposition und Gefühle mit dem Spiel und den Emotionen der anderen vierzig Musiker*innen in eine Harmonie zu bringen.
![]()
Was macht die Stadt Basel für dich aus?
Nordstern, weil ich für diesen Club schon viel gebucht wurde, meistens leider bedingt meine Agenda am nächsten Tag bereits einen nächsten Stopp. Das Kunstmuseum Basel birgt eine tolle Sammlung, da war ich auch bereits.
Deine erste Erinnerung an Clubs?
Ich war etwa 14 oder 15 und habe meinem Cousin mit dem Licht geholfen. Der erste Event war der «Icebreaker» am College, eine Party, die jährlich im September stattfindet und das erste grosse Fest des neuen Schuljahres ist, da habe ich das erste Mal Scratching gesehen. Im gleichen Jahr war ich das allerste Mal in einem Club namens «Cheeks», wo ich Jeff Mills zum ersten Mal getroffen habe, das war 1984.
Was bedeutet dir bildende Kunst?
Kunst ist das Arbeiten mit einem starken Statement! Das kann Installation, Malerei oder Performance sein. Maler wie Rothko, die sich stringent der Erfahrung der Malerei widmeten. Oder eine aktuelle Installation von Warhol-Bildern bei Dia:Beacon in New York. Ich selber mache auch Soundinstallationen.
![]()
Die letzte Platte die du gekauft hast?
Ein Repress des Klassikers «Gemini» (1974) von Marcus Belgrave, das ich selber pressen liess. Eine komplette Neumasterung der Originale, 180gr Vinyl, die die höchste Form von akustischer Klangreinheit darstellen soll. Hergestellt bei Jack Whites Vinyl Factory in Detroit.
Und wir sagen: Wie wär’s mal mit...
...Zuhören und daraus etwas Neues kreieren!
![]()
Vielen Dank an Carl Craig für das Interessante Gespräch über Klangwellen, Beats und Streichmelodien.
(English version)
Kaserne Basel: In conversation with musician Carl Craig
Carl Craig is a composer, artist and visionary. A variety of chapters and inspirations come together in his music and projects. He performed with the Basel Symphony Orchestra in the Kaserne Basel. How do techno and classical music come together and which record did he buy last? We met the talented artist for a conversation about exciting sound worlds.
![]()
Dear Carl, you played with the symphony orchestra in the Basel barracks. What moment opened the door to classical music?
Way back in the Seventies I heard the sound of a jazz pianist called Ramsey Lewis accompanied by an orchestra. Or musicians like Yusef Lateef or Motown Records – both artists often co-working with an orchestra. Ramsey Lewis’ versions of the Beatles’ songs accompanied by an orchestra excited me almost more than the originals.
On what do you focus during rehearsals?
I try to hear and feel, if the translation produced the same effect it had on me when I wrote it at home in my mother's cellar or with my girlfriend. Like reading a novel. The moment of reading is mainly about the story read. If you try to interpret the story and bring it into another format, then this process is like translating my music into a classic format. What makes an orchestra special is not only the musical knowledge of the individual musicians and their experiences, but also the ability to incorporate their personal emotions into the playing. So my composition and emotion meet their play which is certainly a challenge to bring into harmony.
![]()
What do you have in store on the city Basel?
Nordstern because I've been booked a lot by this club. Unfortunately, my agenda requires often a next stop already on the next day. The Kunstmuseum Basel has a great collection, I've visited this place, too.
Your first club experience or memory you hold close to your heart?
At 14 or 15 helping my cousin with lightning. The first event was at the college and was called «Icebreaker», which takes place annually in September and is the first big party of the new school year. That was the first time I've seen scratching. The same year, I was in a club for the first time. It was called «Cheeks» and this was also the first time I met Jeff Mills. That was back in 1984.
What are you looking for in art?
Art means working with a strong statement! That can be anything from installation to painting to performance. Painters like Rothko who devoted themselves stringently to the experience of painting. Or a recent installation of Warhol images at Dia:Beacon in New York, a wave of color in those grand halls.
![]()
Latest vinyl you bought?
A repress of the classic «Gemini» (1974) by Marcus Belgrave that I let press myself. A complete remastering of the original, 180g vinyl, the highest form of acoustic sound purity. Made at Jack White's Vinyl Press Plant in Detroit.
And we say: How about...
...listening and creating something new out of it!
![]()
Many thanks to Carl Craig for the interesting conversation about sound waves, beats and string melodies.
_
von Shirin Zaid
am 11.11.2019
Korrektorat und Übersetzung: Simone Kuster
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Carl Craig ist Komponist, Künstler und Visionär. Mannigfaltige Kapitel und Inspirationen treffen in seiner Musik und seinen Projekten aufeinander. In der Kaserne Basel trat er mit dem Basler Sinfonieorchester auf. Wie Techno und Klassik zusammenkommen und welche Platte er sich zuletzt gekauft hat? Wir trafen den talentierten Künstler zu einem Gespräch über spannende Klangwelten. (English version see below)

Lieber Carl, du hast mit dem Basler Sinfonieorchester in der Kaserne Basel gespielt. Was öffnete dein Gehör für klassische Musik?
Damals in den 70ern hörte ich die Musik des Jazzpianisten Ramsey Lewis mit Orchesterbegleitung. Oder Musiker wie Yusef Lateef oder Motown Records, die Künstler arbeiteten oft mit einem Orchester zusammen. Ramsey Lewis’ Orchesterversionen von Songs der Beatles haben mich beinahe mehr begeistert als die Originale.
Auf was achtest du während den Proben?
Ich versuche, zu hören und zu spüren, ob die Übersetzung die gleiche Wirkung erzeugt, die sie in mir auslöste, als ich sie damals Zuhause im Keller meiner Mutter oder bei meiner Freundin geschrieben habe. Es ist etwa wie ein Roman zu lesen. In dem Augenblick des Lesens dreht es sich hauptsächlich um die Geschichte. Versucht man die Geschichte zu interpretieren und in ein anderes Format zu bringen, dann gleicht dieser Prozess der Übersetzung meiner Musik in ein klassisches Format. Was das Orchester ausmacht, ist nicht nur das musikalische Wissen der einzelnen Musizierenden und ihre Erfahrungen, sondern auch die Gabe ihre persönlichen Emotionen ins Spielen miteinfliessen zu lassen. Die Herausforderung dabei ist meine Komposition und Gefühle mit dem Spiel und den Emotionen der anderen vierzig Musiker*innen in eine Harmonie zu bringen.

Was macht die Stadt Basel für dich aus?
Nordstern, weil ich für diesen Club schon viel gebucht wurde, meistens leider bedingt meine Agenda am nächsten Tag bereits einen nächsten Stopp. Das Kunstmuseum Basel birgt eine tolle Sammlung, da war ich auch bereits.
Deine erste Erinnerung an Clubs?
Ich war etwa 14 oder 15 und habe meinem Cousin mit dem Licht geholfen. Der erste Event war der «Icebreaker» am College, eine Party, die jährlich im September stattfindet und das erste grosse Fest des neuen Schuljahres ist, da habe ich das erste Mal Scratching gesehen. Im gleichen Jahr war ich das allerste Mal in einem Club namens «Cheeks», wo ich Jeff Mills zum ersten Mal getroffen habe, das war 1984.
Was bedeutet dir bildende Kunst?
Kunst ist das Arbeiten mit einem starken Statement! Das kann Installation, Malerei oder Performance sein. Maler wie Rothko, die sich stringent der Erfahrung der Malerei widmeten. Oder eine aktuelle Installation von Warhol-Bildern bei Dia:Beacon in New York. Ich selber mache auch Soundinstallationen.
Die letzte Platte die du gekauft hast?
Ein Repress des Klassikers «Gemini» (1974) von Marcus Belgrave, das ich selber pressen liess. Eine komplette Neumasterung der Originale, 180gr Vinyl, die die höchste Form von akustischer Klangreinheit darstellen soll. Hergestellt bei Jack Whites Vinyl Factory in Detroit.
Und wir sagen: Wie wär’s mal mit...
...Zuhören und daraus etwas Neues kreieren!
Vielen Dank an Carl Craig für das Interessante Gespräch über Klangwellen, Beats und Streichmelodien.
(English version)
Kaserne Basel: In conversation with musician Carl Craig
Carl Craig is a composer, artist and visionary. A variety of chapters and inspirations come together in his music and projects. He performed with the Basel Symphony Orchestra in the Kaserne Basel. How do techno and classical music come together and which record did he buy last? We met the talented artist for a conversation about exciting sound worlds.

Dear Carl, you played with the symphony orchestra in the Basel barracks. What moment opened the door to classical music?
Way back in the Seventies I heard the sound of a jazz pianist called Ramsey Lewis accompanied by an orchestra. Or musicians like Yusef Lateef or Motown Records – both artists often co-working with an orchestra. Ramsey Lewis’ versions of the Beatles’ songs accompanied by an orchestra excited me almost more than the originals.
On what do you focus during rehearsals?
I try to hear and feel, if the translation produced the same effect it had on me when I wrote it at home in my mother's cellar or with my girlfriend. Like reading a novel. The moment of reading is mainly about the story read. If you try to interpret the story and bring it into another format, then this process is like translating my music into a classic format. What makes an orchestra special is not only the musical knowledge of the individual musicians and their experiences, but also the ability to incorporate their personal emotions into the playing. So my composition and emotion meet their play which is certainly a challenge to bring into harmony.

What do you have in store on the city Basel?
Nordstern because I've been booked a lot by this club. Unfortunately, my agenda requires often a next stop already on the next day. The Kunstmuseum Basel has a great collection, I've visited this place, too.
Your first club experience or memory you hold close to your heart?
At 14 or 15 helping my cousin with lightning. The first event was at the college and was called «Icebreaker», which takes place annually in September and is the first big party of the new school year. That was the first time I've seen scratching. The same year, I was in a club for the first time. It was called «Cheeks» and this was also the first time I met Jeff Mills. That was back in 1984.
What are you looking for in art?
Art means working with a strong statement! That can be anything from installation to painting to performance. Painters like Rothko who devoted themselves stringently to the experience of painting. Or a recent installation of Warhol images at Dia:Beacon in New York, a wave of color in those grand halls.
Latest vinyl you bought?
A repress of the classic «Gemini» (1974) by Marcus Belgrave that I let press myself. A complete remastering of the original, 180g vinyl, the highest form of acoustic sound purity. Made at Jack White's Vinyl Press Plant in Detroit.
And we say: How about...
...listening and creating something new out of it!
Many thanks to Carl Craig for the interesting conversation about sound waves, beats and string melodies.
_
von Shirin Zaid
am 11.11.2019
Korrektorat und Übersetzung: Simone Kuster
Fotos
© Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Re-Designing Mental Health: Im Gespräch mit Zürcher Trendforscherin Angel Rio Schmocker
Immer häufiger mischen sich unter die geschönten, immer-perfekten Welten auf Instagram Inhalte, die das Gegenteil zeigen: Videos von weinenden Personen, Bilder aufgeritzter Arme oder verlaufener Schminke, ganze Texte und Geständnisse, wie schlecht es einem geht. Was hat das alles zu bedeuten? Genau hier setzt die Arbeit von Trendforscherin Angel Rio Schmocker an.
![]()
Liebe Angel, wer bist du und was machst du?
Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut «Trends & Identity» an der Zürcher Hochschule der Künste. Mein Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit der Frage, wie auf Social Media Mental-Health-Situationen inszeniert und gezeigt werden. Daneben arbeite ich als Nanny und als Freelancerin für Kampagnen.
Wie bist du auf das Thema Mental Health gekommen?
Ursprünglich war es das Thema meiner Masterarbeit im Master Trendforschung gewesen. Ich hatte mehrere Projektideen in der engeren Auswahl und beim Gespräch mit meiner Dozentin hat sich herausgestellt, dass das Phänomen von Menschen, die extrem emotionale und rohe Geständnisse sowie Bilder von sich teilen, noch weitestgehend unerforscht und auch unbekannt ist. Dieser Versuch, den Menschen zu erklären, was dieses Thema genau sein könnte und wie vielschichtig es ist, wurde schliesslich zum roten Faden für meine Masterthesis. Es ist ein Thema, das mich auch persönlich sehr interessiert.
![]()
Inwiefern hast du einen persönlichen Bezug zum Thema?
Ich habe selbst lange Zeit unter Depressionen und Angststörungen gelitten, teilweise leide ich heute noch daran. Und ich denke, dass die psychische Gesundheit etwas ist, das alle Menschen betrifft – genauso wie die physische. Wahrscheinlich kennt jede*r eine Person, die schon extremere Momente mit seiner psychischen Gesundheit durchlebt hat oder ist selbst schon an einem solchen Punkt gewesen. Jede*r hat auf irgendeine Art Erfahrung mit diesem Thema und das macht es persönlich.
Deine Masterthesis trägt den Titel «Sick Style – Welcome to the New World of Sadness». Was verstehst du unter «Sick Style»?
«Sick Style» kommt von unserem kürzlich abgeschlossenen Trendmapping. Wir haben versucht, sogenannte Health Styles – also Trends im Bereich Gesundheit – abzubilden. Das passende Gegenstück dazu sind die «Sick Styles». Wenn alle gesund bleiben und nur noch die schönen Seiten zeigen wollen, wo hat da noch das Kranke Platz? Wo zeigt sich das Unperfekte, das Unschöne? Deshalb der Begriff. Man kann sich die «Sick Styles» wie eine Skala oder ein Fadenkreuz vorstellen: Es gibt auf der einen Seite ganz extreme Geständnisse und Bilder, die Leute aus der Klinik posten. Auf der anderen Seite existieren aber auch sehr herzige und aufmunternde Inhalte, die einem ein gutes Gefühl geben, zeigen, dass man nicht alleine ist und auf eine Entstigmatisierung ausgerichtet sind. Dazwischen liegt ein ganzes Spektrum.
![]()
Du hast dieses «Kranke» gefunden. Welches sind die dominierenden Themen?
Mit dieser Frage beschäftigen wir uns zu einem grossen Teil in unserer aktuellen Forschung. In einem ersten Teil wollten wir verstehen, wie vielschichtig das Thema ist. Dann haben wir versucht, in einem Trendreport für die Gesundheitsförderung übergreifende Motive zu identifizieren. Einer der zentralsten Punkte ist die Fluidität – es geht nicht mehr nur noch alleine um Mental Health. Da gibt es feministische Communities, diejenigen, die sich mit Klima-, Nachhaltigkeitsthemen, Veganismus oder der Politik beschäftigen. Zunehmend geht es um die Fragen, wie man ein gutes und gesundes Leben führen kann, wie man ein guter Mensch in dieser Welt ist und auf welche Art man «Awareness» betreiben kann. Das ganze Spektrum vom Menschsein wird angesprochen und Mental Health ist ein grosser Teil davon.
![]()
Kannst du ein Beispiel für übergreifende Motive in Zusammenhang mit Mental Health nennen?
Das ist der Fall, wenn etwa eine Person Probleme mit ihrer Psyche hat, weil sie als Frau sexuell belästigt wurde oder wenn man als Frau am Arbeitsplatz nicht ernst genommen wird und darum an «Social Anxiety», sprich einer sozialen Angststörung leidet. Weiter gibt es Teenies, die in Social Media Posts erzählen, dass sie «Anxiety» und Depressionen haben, weil sie mit einem sterbenden Planeten keine Zukunft sehen.
Wie sieht es mit den Grenzen von analogem und digitalem Leben aus?
Auch das digitale Ich und das analoge Ich werden nicht mehr gross voneinander unterschieden, vor allem nicht bei den «Digital Natives». Früher sagten die Leute noch: «Ich gehe ins Internet», heute macht man das nicht mehr, du bist im Internet, das Internet ist bei dir. Das ist eine der Schubladen, auf die wir in unserem Projekt gestossen sind. Man ist im Internet oder nicht, spricht über Mental Health oder nicht, aber tatsächlich sind das Grenzen, die nicht mehr existieren.
![]()
Deine Forschungsthemen sind in der Gesellschaft oft stigmatisiert, teilweise sogar tabuisiert. Warum ist es wichtig, mehr über dieses Thema herauszufinden und es mehr zu thematisieren?
Um den Leuten zu zeigen, dass es anderen auch so ergeht wie ihnen. Das ist wie mit Allem, über das man nicht redet; ist man anders, hat man das Gefühl, komisch zu sein, weiss nicht, an wen man sich wenden kann und traut sich auch nicht. Dabei trägt nur schon das Wissen, dass es Anderen auch so gehen kann, enorm zur Normalisierung bei. Diese Dinge erfährt nicht nur ein kleiner Prozentsatz der Menschheit, sondern es betrifft jede Person. Denn früher oder später hat jeder einmal eine Krise oder eine schlechte Phase – egal ob Trennung, Seasonal Depression Burnout oder einfach nur ein schlechter Tag. Diese Dinge sind ganz normal, sie sind Zeichen von Entwicklung.
Hat sich auch die Art und Weise geändert, wie über Mental Health gesprochen wird?
Meiner persönlichen Einschätzung nach hat sich in der Schweiz noch nicht viel verändert. Hierzulande ist es immer noch eine Seltenheit, wenn Personen sagen: «Hey, ich gehe heute in die Therapie». Das haben uns auch die befragten Teenager bestätigt. Untereinander sprechen sie oft und offen über ihre Probleme, mit den Eltern aber haben sie weitaus mehr Mühe.
Warum haben betroffene Personen Mühe über ihre Probleme zu sprechen?
Sie haben Angst davor, die Eltern könnten sie dann als Problem ansehen. Sie wollen nicht als die Person definiert werden, die psychisch krank ist, oder allein auf dieses Merkmal reduziert werden. Diese Trennung ist einer der Gründe, aufgrund dessen wir annehmen, dass es so stark in den sozialen Medien stattfindet. Im analogen Leben gibt es noch nicht so viel Platz für Mental-Health-Themen, im digitalen dafür umso mehr.
![]()
Welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien?
Je aktueller und präsenter ein Thema ist, desto mehr wird dazu geforscht und desto mehr Fördergelder fliessen. Und mit mehr Forschung gibt es auch mehr Beratungsstellen, die Leute wissen, wo sie sich informieren können, das trägt alles zur Normalisierung des Themas in der Bevölkerung bei. Und genau hier können die sozialen Medien Enormes leisten, indem sie den Themen eine niederschwellige Plattform geben, auf der man einfach mit Inhalten konfrontiert wird, auf Bild- wie auf Textebene. Diese Mischung ist es auch, die Instagram so attraktiv macht. Mit Wort, Bild und Video können emotionale Inhalte sehr intensiv dargestellt werden, die Message kommt besser an.
![]()
Wer sind diese Personen, die auf Social Media über ihre Probleme sprechen?
Personen aus allen sozialen Gruppen. In unserem Forschungsschwerpunkt haben wir uns auf Jugendliche konzentriert. Bei unserer Analyse von YouTube und Instagram ist uns jedoch aufgefallen, dass sich die ganze Bandbreite zu Mental-Health-Themen äussert; vom Bauarbeiter*innen über alte wie junge Frauen, Männer, Transgenderpersonen, Deutsche, Schweizer*innen, Australier*innen, Engländer*innen. Oft hat man die Neigung, nur von den jungen Leuten zu sprechen, weil es die Neuen Medien sind und weil man bei jungen Menschen Trends besser analysieren kann. Defacto sind es aber alle.
Gibt es so etwas wie einen guten Umgang mit Social Media?
Ja, etwa das Buch «Teen Mental Health in an Online World: Supporting Young People around their Use of Social Media, Apps, Gaming, Texting and the Rest», in dem die Autoren eine Art Regelkatalog vorstellen – die Idee ist, die Jugendlichen in ihrem Umgang zu unterstützen, statt ihnen Social Media zu verbieten. Weiter erklären sie, was die Gefahren sind und zeigen auf, was alles passiert und passieren kann, wenn man online ist.
![]()
Was kann eine Hürde sein, über psychische Probleme in der analogen Welt zu sprechen?
Eine Jugendliche, die wir für unser Projekt befragt hatten, sagte uns, dass es für sie unmöglich wäre, mit ihrem Vertrauenslehrer oder dem Schulpsychologen über ihre Anorexie zu sprechen, wenn diese nicht mal wissen, was Instagram ist und auch kein Social Media nutzen. Denn die ganzen Thinspo- (Mischwort aus Engl. thin = dünn und Inspiration) und Triggerinhalte, die ihre Essstörung beeinflussen, befinden sich auf diesen Kanälen. Es mache also keinen Sinn, über etwas zu sprechen, dass der einen Person zuerst noch erklärt werden muss.
Gab es auch schon Momente, an denen du selbst mit deiner Arbeit aufhören wolltest?
Ja. Bei meiner Masterthesis war es noch nicht ganz so schlimm, da war ich noch distanzierter. Und da ich etwas in einem Fachkontext analysieren will, gelingt es mir auch oft, diese Distanz zu wahren. Die Befragungen in unserem letzten Projekt fanden als narrative Einzelinterviews statt. Das geht einem dann schon sehr nahe, wenn man zwei Stunden mit einer Person über ihre Probleme spricht, und das mehrere Male. Auch sehr intensiv war die Erstellung des Quellenverzeichnisses für unseren Trendreport: Da die Inhalte der Bilder, die ich selektierte, so persönlich waren, musste ich mehrmals Pausen einlegen.
![]()
Und was gefällt dir besonders gut an deiner Arbeit?
Die Verbindung von allem. Mir gefällt das Visuelle, die Sprache und auch die Themen sagen mir zu, da es mich ja auch persönlich betrifft. Und da es eine Art Neuland ist, kann man enorm experimentieren, das motiviert.
Du hast das Projekt Ende September abgeschlossen. Woran wirst du als nächstes forschen?
Für uns stellte dieses Projekt eine Art Grundlagenforschung dar. Jetzt wird es mehr in Richtung angewandte Forschung gehen, wo wir uns auf einen Aspekt vertiefen werden. Wohin es genau gehen wird, kann ich noch nicht sagen. Klar ist, dass das ganze Team nach den Befragungen und Mappings sich sehr auch auf den gestalterischen Aspekt freut, schliesslich kommen wir ja aus dem Design.
![]()
Nun zu dir: Hast du einen Lieblingsort in Zürich?
Ich finde es in Wiedikon unglaublich toll. Das Quartier hat gute Vibes, auch weil in den letzten Jahren viele meiner Kollegen hierher gezogen sind. Ansonsten mache ich gerne Spaziergänge beim Sihlhölzli am Wasser oder in der Laubegg.
Gibt es eine Bar, in der man dich spontan mal antreffen könnte?
Zurzeit bin ich sehr oft im Acid an der Langstrasse, da fast mein halber Freundeskreis in dieser Bar arbeitet.
Wie wär’s mal mit...
...mehr Ruhe?
![]()
Vielen lieben Dank an Angel für das tolle Gespräch und die Einblicke in ihre Welt.
_
von Valérie Hug
am 04.11.2019
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Immer häufiger mischen sich unter die geschönten, immer-perfekten Welten auf Instagram Inhalte, die das Gegenteil zeigen: Videos von weinenden Personen, Bilder aufgeritzter Arme oder verlaufener Schminke, ganze Texte und Geständnisse, wie schlecht es einem geht. Was hat das alles zu bedeuten? Genau hier setzt die Arbeit von Trendforscherin Angel Rio Schmocker an.

Liebe Angel, wer bist du und was machst du?
Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut «Trends & Identity» an der Zürcher Hochschule der Künste. Mein Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit der Frage, wie auf Social Media Mental-Health-Situationen inszeniert und gezeigt werden. Daneben arbeite ich als Nanny und als Freelancerin für Kampagnen.
Wie bist du auf das Thema Mental Health gekommen?
Ursprünglich war es das Thema meiner Masterarbeit im Master Trendforschung gewesen. Ich hatte mehrere Projektideen in der engeren Auswahl und beim Gespräch mit meiner Dozentin hat sich herausgestellt, dass das Phänomen von Menschen, die extrem emotionale und rohe Geständnisse sowie Bilder von sich teilen, noch weitestgehend unerforscht und auch unbekannt ist. Dieser Versuch, den Menschen zu erklären, was dieses Thema genau sein könnte und wie vielschichtig es ist, wurde schliesslich zum roten Faden für meine Masterthesis. Es ist ein Thema, das mich auch persönlich sehr interessiert.

Inwiefern hast du einen persönlichen Bezug zum Thema?
Ich habe selbst lange Zeit unter Depressionen und Angststörungen gelitten, teilweise leide ich heute noch daran. Und ich denke, dass die psychische Gesundheit etwas ist, das alle Menschen betrifft – genauso wie die physische. Wahrscheinlich kennt jede*r eine Person, die schon extremere Momente mit seiner psychischen Gesundheit durchlebt hat oder ist selbst schon an einem solchen Punkt gewesen. Jede*r hat auf irgendeine Art Erfahrung mit diesem Thema und das macht es persönlich.
Deine Masterthesis trägt den Titel «Sick Style – Welcome to the New World of Sadness». Was verstehst du unter «Sick Style»?
«Sick Style» kommt von unserem kürzlich abgeschlossenen Trendmapping. Wir haben versucht, sogenannte Health Styles – also Trends im Bereich Gesundheit – abzubilden. Das passende Gegenstück dazu sind die «Sick Styles». Wenn alle gesund bleiben und nur noch die schönen Seiten zeigen wollen, wo hat da noch das Kranke Platz? Wo zeigt sich das Unperfekte, das Unschöne? Deshalb der Begriff. Man kann sich die «Sick Styles» wie eine Skala oder ein Fadenkreuz vorstellen: Es gibt auf der einen Seite ganz extreme Geständnisse und Bilder, die Leute aus der Klinik posten. Auf der anderen Seite existieren aber auch sehr herzige und aufmunternde Inhalte, die einem ein gutes Gefühl geben, zeigen, dass man nicht alleine ist und auf eine Entstigmatisierung ausgerichtet sind. Dazwischen liegt ein ganzes Spektrum.

Du hast dieses «Kranke» gefunden. Welches sind die dominierenden Themen?
Mit dieser Frage beschäftigen wir uns zu einem grossen Teil in unserer aktuellen Forschung. In einem ersten Teil wollten wir verstehen, wie vielschichtig das Thema ist. Dann haben wir versucht, in einem Trendreport für die Gesundheitsförderung übergreifende Motive zu identifizieren. Einer der zentralsten Punkte ist die Fluidität – es geht nicht mehr nur noch alleine um Mental Health. Da gibt es feministische Communities, diejenigen, die sich mit Klima-, Nachhaltigkeitsthemen, Veganismus oder der Politik beschäftigen. Zunehmend geht es um die Fragen, wie man ein gutes und gesundes Leben führen kann, wie man ein guter Mensch in dieser Welt ist und auf welche Art man «Awareness» betreiben kann. Das ganze Spektrum vom Menschsein wird angesprochen und Mental Health ist ein grosser Teil davon.

Kannst du ein Beispiel für übergreifende Motive in Zusammenhang mit Mental Health nennen?
Das ist der Fall, wenn etwa eine Person Probleme mit ihrer Psyche hat, weil sie als Frau sexuell belästigt wurde oder wenn man als Frau am Arbeitsplatz nicht ernst genommen wird und darum an «Social Anxiety», sprich einer sozialen Angststörung leidet. Weiter gibt es Teenies, die in Social Media Posts erzählen, dass sie «Anxiety» und Depressionen haben, weil sie mit einem sterbenden Planeten keine Zukunft sehen.
Wie sieht es mit den Grenzen von analogem und digitalem Leben aus?
Auch das digitale Ich und das analoge Ich werden nicht mehr gross voneinander unterschieden, vor allem nicht bei den «Digital Natives». Früher sagten die Leute noch: «Ich gehe ins Internet», heute macht man das nicht mehr, du bist im Internet, das Internet ist bei dir. Das ist eine der Schubladen, auf die wir in unserem Projekt gestossen sind. Man ist im Internet oder nicht, spricht über Mental Health oder nicht, aber tatsächlich sind das Grenzen, die nicht mehr existieren.

Deine Forschungsthemen sind in der Gesellschaft oft stigmatisiert, teilweise sogar tabuisiert. Warum ist es wichtig, mehr über dieses Thema herauszufinden und es mehr zu thematisieren?
Um den Leuten zu zeigen, dass es anderen auch so ergeht wie ihnen. Das ist wie mit Allem, über das man nicht redet; ist man anders, hat man das Gefühl, komisch zu sein, weiss nicht, an wen man sich wenden kann und traut sich auch nicht. Dabei trägt nur schon das Wissen, dass es Anderen auch so gehen kann, enorm zur Normalisierung bei. Diese Dinge erfährt nicht nur ein kleiner Prozentsatz der Menschheit, sondern es betrifft jede Person. Denn früher oder später hat jeder einmal eine Krise oder eine schlechte Phase – egal ob Trennung, Seasonal Depression Burnout oder einfach nur ein schlechter Tag. Diese Dinge sind ganz normal, sie sind Zeichen von Entwicklung.
Hat sich auch die Art und Weise geändert, wie über Mental Health gesprochen wird?
Meiner persönlichen Einschätzung nach hat sich in der Schweiz noch nicht viel verändert. Hierzulande ist es immer noch eine Seltenheit, wenn Personen sagen: «Hey, ich gehe heute in die Therapie». Das haben uns auch die befragten Teenager bestätigt. Untereinander sprechen sie oft und offen über ihre Probleme, mit den Eltern aber haben sie weitaus mehr Mühe.
Warum haben betroffene Personen Mühe über ihre Probleme zu sprechen?
Sie haben Angst davor, die Eltern könnten sie dann als Problem ansehen. Sie wollen nicht als die Person definiert werden, die psychisch krank ist, oder allein auf dieses Merkmal reduziert werden. Diese Trennung ist einer der Gründe, aufgrund dessen wir annehmen, dass es so stark in den sozialen Medien stattfindet. Im analogen Leben gibt es noch nicht so viel Platz für Mental-Health-Themen, im digitalen dafür umso mehr.

Welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien?
Je aktueller und präsenter ein Thema ist, desto mehr wird dazu geforscht und desto mehr Fördergelder fliessen. Und mit mehr Forschung gibt es auch mehr Beratungsstellen, die Leute wissen, wo sie sich informieren können, das trägt alles zur Normalisierung des Themas in der Bevölkerung bei. Und genau hier können die sozialen Medien Enormes leisten, indem sie den Themen eine niederschwellige Plattform geben, auf der man einfach mit Inhalten konfrontiert wird, auf Bild- wie auf Textebene. Diese Mischung ist es auch, die Instagram so attraktiv macht. Mit Wort, Bild und Video können emotionale Inhalte sehr intensiv dargestellt werden, die Message kommt besser an.

Wer sind diese Personen, die auf Social Media über ihre Probleme sprechen?
Personen aus allen sozialen Gruppen. In unserem Forschungsschwerpunkt haben wir uns auf Jugendliche konzentriert. Bei unserer Analyse von YouTube und Instagram ist uns jedoch aufgefallen, dass sich die ganze Bandbreite zu Mental-Health-Themen äussert; vom Bauarbeiter*innen über alte wie junge Frauen, Männer, Transgenderpersonen, Deutsche, Schweizer*innen, Australier*innen, Engländer*innen. Oft hat man die Neigung, nur von den jungen Leuten zu sprechen, weil es die Neuen Medien sind und weil man bei jungen Menschen Trends besser analysieren kann. Defacto sind es aber alle.
Gibt es so etwas wie einen guten Umgang mit Social Media?
Ja, etwa das Buch «Teen Mental Health in an Online World: Supporting Young People around their Use of Social Media, Apps, Gaming, Texting and the Rest», in dem die Autoren eine Art Regelkatalog vorstellen – die Idee ist, die Jugendlichen in ihrem Umgang zu unterstützen, statt ihnen Social Media zu verbieten. Weiter erklären sie, was die Gefahren sind und zeigen auf, was alles passiert und passieren kann, wenn man online ist.

Was kann eine Hürde sein, über psychische Probleme in der analogen Welt zu sprechen?
Eine Jugendliche, die wir für unser Projekt befragt hatten, sagte uns, dass es für sie unmöglich wäre, mit ihrem Vertrauenslehrer oder dem Schulpsychologen über ihre Anorexie zu sprechen, wenn diese nicht mal wissen, was Instagram ist und auch kein Social Media nutzen. Denn die ganzen Thinspo- (Mischwort aus Engl. thin = dünn und Inspiration) und Triggerinhalte, die ihre Essstörung beeinflussen, befinden sich auf diesen Kanälen. Es mache also keinen Sinn, über etwas zu sprechen, dass der einen Person zuerst noch erklärt werden muss.
Gab es auch schon Momente, an denen du selbst mit deiner Arbeit aufhören wolltest?
Ja. Bei meiner Masterthesis war es noch nicht ganz so schlimm, da war ich noch distanzierter. Und da ich etwas in einem Fachkontext analysieren will, gelingt es mir auch oft, diese Distanz zu wahren. Die Befragungen in unserem letzten Projekt fanden als narrative Einzelinterviews statt. Das geht einem dann schon sehr nahe, wenn man zwei Stunden mit einer Person über ihre Probleme spricht, und das mehrere Male. Auch sehr intensiv war die Erstellung des Quellenverzeichnisses für unseren Trendreport: Da die Inhalte der Bilder, die ich selektierte, so persönlich waren, musste ich mehrmals Pausen einlegen.

Und was gefällt dir besonders gut an deiner Arbeit?
Die Verbindung von allem. Mir gefällt das Visuelle, die Sprache und auch die Themen sagen mir zu, da es mich ja auch persönlich betrifft. Und da es eine Art Neuland ist, kann man enorm experimentieren, das motiviert.
Du hast das Projekt Ende September abgeschlossen. Woran wirst du als nächstes forschen?
Für uns stellte dieses Projekt eine Art Grundlagenforschung dar. Jetzt wird es mehr in Richtung angewandte Forschung gehen, wo wir uns auf einen Aspekt vertiefen werden. Wohin es genau gehen wird, kann ich noch nicht sagen. Klar ist, dass das ganze Team nach den Befragungen und Mappings sich sehr auch auf den gestalterischen Aspekt freut, schliesslich kommen wir ja aus dem Design.

Nun zu dir: Hast du einen Lieblingsort in Zürich?
Ich finde es in Wiedikon unglaublich toll. Das Quartier hat gute Vibes, auch weil in den letzten Jahren viele meiner Kollegen hierher gezogen sind. Ansonsten mache ich gerne Spaziergänge beim Sihlhölzli am Wasser oder in der Laubegg.
Gibt es eine Bar, in der man dich spontan mal antreffen könnte?
Zurzeit bin ich sehr oft im Acid an der Langstrasse, da fast mein halber Freundeskreis in dieser Bar arbeitet.
Wie wär’s mal mit...
...mehr Ruhe?

Vielen lieben Dank an Angel für das tolle Gespräch und die Einblicke in ihre Welt.
_
von Valérie Hug
am 04.11.2019
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Street-Files: Im Gespräch mit Alex Braunschmidt und Dominik Doppler
Es war einmal an der Badenerstrasse in Zürich auf rund 15qm ein kleiner Store namens Street-Files, das war im Jahre 2008. Woher er seinen Namen hat und was seither alles passiert ist? Geschäftsführer Alex Braunschmidt und Basler Storemanager Dominik Doppler erzählen uns die Geschichte im Folgenden gerne selber.
![]()
Lieber Alex, lieber Dominik, was sind eure Rollen bei Street-Files?
Alex: Geschäftsführer
Dominik: Shopmanager Basel
Seit wann existiert Street-Files und wie kam es zur Idee?
Alex: Im 2006 und nach unzähligen geschäftlichen Reisen nach Nordeuropa habe ich viele Labels für mich entdeckt, die es dazumals nicht in der Schweiz zu kaufen gab. Anfangs waren die Sachen nur in unserem Online Shop erhältlich, übrigens war das der erste Streetwear Online Shop der Schweiz. Ab 2008 eröffnete ich auf winzigen 15qm den Street-Files MINI MART an der Badenerstrasse in Zürich. Der Rest ist Geschichte. Auch heute noch ist Street-Files eine selbstinitiierte und selbstfinanzierte Company.
![]()
Wir verkaufen auch weiterhin einen auserlesenen Mix aus Newcomerbrands, etablierten Marken und selektiver Labels. 2018 wurde der Laden in Basel an die grössere Location am Spalenberg 59 umgezogen. Die Motivation der Crew ist und bleibt, immer wieder mit neuen Innovationen zu überraschen.
![]()
Street-Files – weshalb der Name?
Alex: Ich habe auf meinen Reisen jeweils die coolsten Looks und Outfits von Leuten fotografiert. Diese habe ich ausgedruckt und in meinem Ordner «Street-Files» gesammelt. Street-Files, die Strassen durchforsten und styletechnisch Einordnen. Die Idee für Namen und Laden war somit geboren.
Beschreibt das Team in 3 Worten.
Alex: Herzlich, offen, fleissig.
Dominik: Stylisch, modisch, herzlich.
![]()
Wart ihr schon immer im Modebereich tätig?
Alex: Ich hatte meinen Einstieg 2003 bei FREITAG. Das Umfeld hat mir sofort sehr gut gefallen und ich schätze auch noch heute die Branche. Mode ist vielfältig, kreativ und muss sich auch stetig neuen Herausforderungen stellen: Onlineshopping, Nachhaltigkeit und ständig neue Trends machen den Job vielfältig und bestimmt nie langweilig.
Dominik: Nein. Ich habe bei Street-Files meinen Einstieg in den Modebereich machen dürfen. Alex gab mir vor 5 Jahren die Chance mich bei Street-Files zu beweisen und Fuss in der Modebranche zu fassen.
![]()
Wenn Street-Files ein Song wäre, welcher wäre es und weshalb?
Alex: Es müsste ein Electronic Indie Song von Cut Copy, Simian Mobile Disco, Neon Neon, Phoenix oder was von Tame Impala sein. Das läuft bei uns in der Endlosschlaufe. Zumindest, wenn ich über die Musik verfügen darf.
Beschreibt die Street-Files Kunden in 3 Worten.
a. in Basel
Alex: «Das chönnti passe.»
b. in Zürich
Alex: «Voll easy Style, Altä.»
![]()
Welches Street-Files Produkt inspiriert euch persönlich am meisten und weshalb?
Alex: Ich mag die Colorful Standard Range, da es ein Produkt ist, das für alles steht, was wir bieten wollen: Optimale Qualität zu einem tollen Preis. Zudem ist das Produkt aus Organic Cotton gefertigt und eine umweltbewusste Produktion ist uns sehr am Herzen.
Dominik: Vom Sandqvist Rucksack, zum Basic T-Shirt von Colorful Standard, über unsere Best-Seller Hose von Legends weiter zu unserer neusten Errungenschaft den Sneakers von BRANDBLACK - für mich ist es das Gesamt-Bild und das ganze, harmonische Sortiment.
![]()
Wer ist für das Interior und die Szenografie von Street-Files zuständig?
Alex: Das ist Michael Singh, ein Mitarbeiter der schon seit 2011 im Unternehmen ist und Street-Files wesentlich mitprägt.
![]()
Wo seid ihr privat gerne unterwegs?
a. in Basel
Alex: Cafe Avant’Gouz, Damatti und Theater Basel.
Dominik: Elysia und Schmatz, Viertelkreis, Alte Markthalle, Vito, Klara, Alles von der Rhyschänzli Gruppe, Fondation Beyeler, Ca’puccino für einen leckeren Kaffee, Open Store, Grün80 & Merian Gärten, Restaurant Nordbahnhof, Isbilir und Aziz Döner, im Sommer am Rheinbord vom Altrhein bis zu den Isteiner Schwellen oder auch mal im Naturbad in Riehen. Am Flughafen in Richtung Ferien (lacht).
![]()
b. in Zürich
Alex: Cafe Noir, Acid, Grandcafe Lochergut, Rosis, Sportbar, Kosmos, Fat Tony
Dominik: Ich bin nur gelegentlich in Zürich. Aber lass mich da gerne einfach mitziehen und treiben, so kommt man unverhofft an schöne und interessante Orte. Meine Street-Files Family kennt sich da etwas besser aus, da verlasse ich mich voll und ganz auf sie, wie auch sonst.
![]()
Was findet findet man garantiert nicht im Street-Files?
Alex: Knitterschals, ein Set für „Rote Mesh zum selber machen“ oder Butterfly Knife und Schlagringe.
Dominik: Schlechte Laune, modische Faux-pas, schlechte Beratung.
![]()
Wie wär’s mal mit…
Alex: ...gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Wenn es Street-Files schafft, Männer und Frauen die gleichen Löhne zu zahlen, sollte da auch in jedem anderem Unternehmen möglich sein.
Dominik: ...Gleichberechtiung!
![]()
Vielen Dank an Alex und Dominik für den sympathischen Einblick in die Welt von Street-Files.
_
von Ana Brankovic
am 28.10.2019
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Es war einmal an der Badenerstrasse in Zürich auf rund 15qm ein kleiner Store namens Street-Files, das war im Jahre 2008. Woher er seinen Namen hat und was seither alles passiert ist? Geschäftsführer Alex Braunschmidt und Basler Storemanager Dominik Doppler erzählen uns die Geschichte im Folgenden gerne selber.

Lieber Alex, lieber Dominik, was sind eure Rollen bei Street-Files?
Alex: Geschäftsführer
Dominik: Shopmanager Basel
Seit wann existiert Street-Files und wie kam es zur Idee?
Alex: Im 2006 und nach unzähligen geschäftlichen Reisen nach Nordeuropa habe ich viele Labels für mich entdeckt, die es dazumals nicht in der Schweiz zu kaufen gab. Anfangs waren die Sachen nur in unserem Online Shop erhältlich, übrigens war das der erste Streetwear Online Shop der Schweiz. Ab 2008 eröffnete ich auf winzigen 15qm den Street-Files MINI MART an der Badenerstrasse in Zürich. Der Rest ist Geschichte. Auch heute noch ist Street-Files eine selbstinitiierte und selbstfinanzierte Company.

Wir verkaufen auch weiterhin einen auserlesenen Mix aus Newcomerbrands, etablierten Marken und selektiver Labels. 2018 wurde der Laden in Basel an die grössere Location am Spalenberg 59 umgezogen. Die Motivation der Crew ist und bleibt, immer wieder mit neuen Innovationen zu überraschen.

Street-Files – weshalb der Name?
Alex: Ich habe auf meinen Reisen jeweils die coolsten Looks und Outfits von Leuten fotografiert. Diese habe ich ausgedruckt und in meinem Ordner «Street-Files» gesammelt. Street-Files, die Strassen durchforsten und styletechnisch Einordnen. Die Idee für Namen und Laden war somit geboren.
Beschreibt das Team in 3 Worten.
Alex: Herzlich, offen, fleissig.
Dominik: Stylisch, modisch, herzlich.

Wart ihr schon immer im Modebereich tätig?
Alex: Ich hatte meinen Einstieg 2003 bei FREITAG. Das Umfeld hat mir sofort sehr gut gefallen und ich schätze auch noch heute die Branche. Mode ist vielfältig, kreativ und muss sich auch stetig neuen Herausforderungen stellen: Onlineshopping, Nachhaltigkeit und ständig neue Trends machen den Job vielfältig und bestimmt nie langweilig.
Dominik: Nein. Ich habe bei Street-Files meinen Einstieg in den Modebereich machen dürfen. Alex gab mir vor 5 Jahren die Chance mich bei Street-Files zu beweisen und Fuss in der Modebranche zu fassen.

Wenn Street-Files ein Song wäre, welcher wäre es und weshalb?
Alex: Es müsste ein Electronic Indie Song von Cut Copy, Simian Mobile Disco, Neon Neon, Phoenix oder was von Tame Impala sein. Das läuft bei uns in der Endlosschlaufe. Zumindest, wenn ich über die Musik verfügen darf.
Beschreibt die Street-Files Kunden in 3 Worten.
a. in Basel
Alex: «Das chönnti passe.»
b. in Zürich
Alex: «Voll easy Style, Altä.»

Welches Street-Files Produkt inspiriert euch persönlich am meisten und weshalb?
Alex: Ich mag die Colorful Standard Range, da es ein Produkt ist, das für alles steht, was wir bieten wollen: Optimale Qualität zu einem tollen Preis. Zudem ist das Produkt aus Organic Cotton gefertigt und eine umweltbewusste Produktion ist uns sehr am Herzen.
Dominik: Vom Sandqvist Rucksack, zum Basic T-Shirt von Colorful Standard, über unsere Best-Seller Hose von Legends weiter zu unserer neusten Errungenschaft den Sneakers von BRANDBLACK - für mich ist es das Gesamt-Bild und das ganze, harmonische Sortiment.

Wer ist für das Interior und die Szenografie von Street-Files zuständig?
Alex: Das ist Michael Singh, ein Mitarbeiter der schon seit 2011 im Unternehmen ist und Street-Files wesentlich mitprägt.

Wo seid ihr privat gerne unterwegs?
a. in Basel
Alex: Cafe Avant’Gouz, Damatti und Theater Basel.
Dominik: Elysia und Schmatz, Viertelkreis, Alte Markthalle, Vito, Klara, Alles von der Rhyschänzli Gruppe, Fondation Beyeler, Ca’puccino für einen leckeren Kaffee, Open Store, Grün80 & Merian Gärten, Restaurant Nordbahnhof, Isbilir und Aziz Döner, im Sommer am Rheinbord vom Altrhein bis zu den Isteiner Schwellen oder auch mal im Naturbad in Riehen. Am Flughafen in Richtung Ferien (lacht).

b. in Zürich
Alex: Cafe Noir, Acid, Grandcafe Lochergut, Rosis, Sportbar, Kosmos, Fat Tony
Dominik: Ich bin nur gelegentlich in Zürich. Aber lass mich da gerne einfach mitziehen und treiben, so kommt man unverhofft an schöne und interessante Orte. Meine Street-Files Family kennt sich da etwas besser aus, da verlasse ich mich voll und ganz auf sie, wie auch sonst.

Was findet findet man garantiert nicht im Street-Files?
Alex: Knitterschals, ein Set für „Rote Mesh zum selber machen“ oder Butterfly Knife und Schlagringe.
Dominik: Schlechte Laune, modische Faux-pas, schlechte Beratung.

Wie wär’s mal mit…
Alex: ...gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Wenn es Street-Files schafft, Männer und Frauen die gleichen Löhne zu zahlen, sollte da auch in jedem anderem Unternehmen möglich sein.
Dominik: ...Gleichberechtiung!

Vielen Dank an Alex und Dominik für den sympathischen Einblick in die Welt von Street-Files.
_
von Ana Brankovic
am 28.10.2019
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
«Circle» The Sustainable Shop: Im Gespräch mit Mitbegründer Alessandro
Ghiani
Alessandro Ghiani, Mitbegründer des Ladens «Circle – The Sustainable Shop», im Zürcher Niederdorf traf uns zu einem spannenden Austausch rund um Nachhaltigkeit und vieles mehr. Was im März 2014 mit einem Bambusvelo startete, führte die fünf Gründer bis heute zu einem Ladenkonzept mit nachhaltigem und fairem Sortiment. Wir sprachen mit Alessandro über die tragende Rolle, die jeder der fünf in der Entwicklung spielt und wie sich ein bewussterer Lebensstil im Alltag ausprägen kann.
![]()
Lieber Alessandro, würdest du uns etwas mehr über dich erzählen?
Mir ist das Zusammenspiel von Mensch und Natur schon immer sehr wichtig gewesen. Nach meiner Lehre arbeitete ich im Lebensmittelbereich. Zu Beginn wollte ich etwas gegen Foodwaste unternehmen und habe diesbezüglich die strengen Regeln des Schweizer Gesetzes kennengelernt. Seit gut fünf Jahren hat sich uns mit den Läden im Niederdörfli und im Sihlcity ein spannendes neues Projekt eröffnet.
![]()
Wie kam es zum Ladenkonzept von «Circle –The Sustainable Shop»?
Severin und ich waren mit einem Bambusvelo in der Stadt Zürich unterwegs, auf der Suche nach einem Ort, an dem wir es ausstellen konnten. Dem damaligen Besitzer dieses Ladens gefielen das Velo und die Idee dahinter sehr gut und wir durften es bei ihm im Schaufenster platzieren. Das Interesse der Kundschaft bestand von Beginn an. Es war der beste Tag von «Não» in der ganzen Shopgeschichte. Nach einer gemeinsamen Zeit konnten wir das Ladenlokal übernehmen.
Heute bietet ihr im «Circle» eine breitere Produktpallette an.
Einmal begonnen, wollten wir unsere Idee mehr vorantreiben. Die angebotenen Produkte sollen faire und nachhaltig hergestellte Alternativen zu Massenwaren bieten. Die Auswahl wurde mit der Nachfrage erweitert. Mit einem Velo gestartet, geht es heute von Zahnbürsten über Kopfhörer hin zu Schokolade, Kleidern, Taschen, Sonnenbrillen und so einigem mehr.
![]()
Was bringt euch zusammen?
Wir konnten nicht nur das Angebot vergrössern, sondern auch unser Team wuchs. Severin, Marc, Lamar, Patrick und ich teilten uns die Aufgaben untereinander auf und positionierten uns als Firma neu. Auch wenn wir alle Individuen sind, sehen wir für uns in einem nachhaltigeren Lebensstil eine grössere Zufriedenheit. Jemand lebt vegetarisch, jemand isst regelmässig Fleisch, ein anderer einmal in der Woche. Diese individuellen Vorstellungen in Bezug auf Nachhaltigkeit auf einen Punkt zu bringen, war unsere Challenge. Ein Frage, die sich uns zum Beispiel stellte, war, ob und warum Leder verkaufen? Leder kann etwas Nachhaltiges sein, wenn man die Haut der Tiere benutzt, welche für die Fleischindustrie sterben. Ich finde es nicht okay, wenn ein Tier ausschliesslich für die Leder- oder Pelzproduktion sterben muss. Wir haben regional Jäger, die den Wildbestand sichern.
![]()
Die Kadaver müssen von den Jägern weggeworfen werden, damit sie ihre Entschädigung bekommen. Man könnte diese Felle für Pelze benutzen und damit ein Statement setzen. In der Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit entstehen in meinen Augen immer wieder neue Chancen. Beim Leder weiter gedacht, kommt man zur Art und Weise wie es gegerbt wird. Weltweit 95% davon werden in Südamerika und Asien auf Chrom-, Laugen- und Arsenbasis hergestellt, obwohl dies auch auf einer vegetabilen Basis möglich ist. Die Chemie gelangt über die Flüsse ungefiltert ins Meer. Arbeiter*innen und Einwohner*innen dieser Regionen haben Vergiftungen mit schwerwiegenden körperlichen Folgen. Wir wiederum kaufen im Lebensmittelladen einen Pangasiusfisch, der genau aus diesen Gewässern stammt. Ich denke, jeder Mensch bildet einen Teil eines Kreislaufs, der alles wiederbringt.
![]()
Welche Werte teilt ihr mit euren Geschäftspartner*innen?
In unseren Laden kommen Menschen aller Altersklassen, die grundsätzlich offen für bewussteren Konsum sind. Einen Wert, den wir mit unseren Partner*innen und Kund*innen in erster Linie teilen, ist sicherlich der des fairen und nachhaltigen Umgangs mit Mensch und Natur. Ausserdem ist für uns die Zusammenarbeit mit Locals wichtig, weshalb wir Produkte aus Zürich ins Sortiment mit einbeziehen.
Was bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit bedeutet für mich die Zukunft sichern. Mir ist es im Besonderen ein Anliegen auf das Thema «Konsum» aufmerksam zu machen. Die Energie von Geld würde länger halten, wenn wir nicht alles kaufen, nur weil wir es wollen, ohne es offensichtlich für unser Wohl zu brauchen. Wenn man ein T-Shirt für 5.- Fr sieht, kann man sich schon fragen, wie solch ein Preis zustande kommen kann. Statt 20 Shirts kaufe ich mir lieber zwei, die etwas mehr kosten und meinen Qualitäts- und Wertansprüchen genügen. Auch ein Nike Schuh kann zehn Jahre lang halten. Wenn man ihn gekauft hat, sollte man ihn auch wertschätzen und nutzen so lange es geht, damit sich die Herstellung gelohnt hat.
![]()
Trotz Werbung und breitem Angebot des Detailhandels entscheidet die Konsument*innen, was sie kaufen. Jede und jeder sollte selbst herausfiltern, was für sie und ihn gut ist und was nicht. Ein bewusstes Konsumverhalten von jedem einzelnen und jeder einzelnen kann in meinen Augen schier unvorstellbaren Wandel bringen.
Was hat es mit dem Namen des Ladens «Circle – The Sustainable Shop» auf sich?
Der Begriff Circle leitet sich vom Kreislauf ab, von dem wir gerade gesprochen haben. Das «C» von «Circle» ist ein Kreis, der nicht ganz geschlossen ist. Diese Öffnung steht da, weil man als Selbstversorger*in leben müsste, um hundertprozentig nachhaltig leben zu können. Ein gewisser Energieverlust geht mit dem Einkauf von Lebensmitteln und Kleidern automatisch einher. Die Öffnung des Kreises steht bei fünf vor zwölf. Es ist Zeit aufzuwachen. ‹Circle› wird spiegelverkehrt geschrieben, da wir neue Akzente setzen und gegen den Strom schwimmen wollen. Weg von diesem klassischen Konsum.
Wie meinst du das, «weg vom klassischen Konsum»?
Weg vom klassischen Konsum hin zu ethisch vertretbaren Produkten im rechten Mass. Ich hoffe, dass wir mit unseren gelebten Werten und unserem Angebot bei den Leuten einen Samen pflanzen können. Die Kunden in einer sogenannten Wegwerf- oder Konsumgesellschaft sind darauf angewiesen, sich selbst zu informieren und bezüglich eines Produktes Fragen zu stellen wie zum Beispiel: Wer hat es gemacht? Woher kommt es? Was musste passieren, damit ich dieses Produkt in meinen Händen halten kann?
![]()
Viele sagen, dass wir in der Schweiz nichts verändern können. Die rund acht Millionen Einwohner*innen der Schweiz haben genauso einen Einfluss wie jede*r andere. Neue Lebensweisen von Individuen können im Grossen viel verändern. Der Wandel ist im Gange und durch alle Altersklassen spürbar.
Euer Laden ist mitten in der Zürcher Altstadt zuhause, kannst du uns deine Geschichte zum «Niederdörfli» erzählen?
Das schönste am Niederdorf für mich ist, dass es sich immer noch wie ein Dorf anfühlt. Wir haben einen sehr familiären Umgang miteinander. Man grüsst sich auf den Gassen und hilft sich gegenseitig aus. Ich finde es etwas sehr Wichtiges, dass wir uns wieder mehr ins Gesicht und die Augen schauen und miteinander reden, anstatt nur an das Handy zu denken. Zuneigung und Gefühle können nur durch persönlichen Kontakt wirklich erlebt werden. Ich schätze den Austausch mit den Besucher*innen und ihre Geschichten, die sie in den Laden bringen.
![]()
Brauchen eure Kund*innen eine Einkaufstasche, wenn sie bei euch einkaufen?
Viele bringen eine eigene Tasche mit. Wenn die Kund*innen zum Beispiel beim Kauf einer Jacke oder grösseren Dingen eine benötigen, bekommen sie auf jeden Fall eine Papiertasche. Im Vergleich der Standorte haben im Niederdorf geschätzt 90% eine Tasche dabei. Dieser Prozentsatz ist in einem Konsumtempel wie dem Sihlcity etwas geringer.
Wo ist dein Verhalten nicht nachhaltig?
Meine Wurzeln stammen von einer Insel, was für mich mit gelegentlichen Reisen verbunden ist. Von den zwei Möglichkeiten, nach Sardinien zu gelangen, versuche ich auf das Flugzeug zu verzichten. Das Meer und die Natur sind für mich gerade wegen meiner Herkunft sehr wichtig. Ich versuche mir bei der Planung von Reisen Gedanken zu machen, wie ich einen Trip unternehme.
![]()
Wenn man einen Monat nach Thailand reist, wäre man mit dem Velo vielleicht ein Jahr unterwegs. Da scheint es fast notwendig, per Flugzeug zu reisen. Man soll sich nicht alles selbst verbieten, vielmehr geht es für mich wie so oft um das richtige Mass. Ich lasse dort etwas weg, wo es mir möglich erscheint. Wir können nicht alles von heute auf morgen komplett drehen, aber wir können Pioniere sein und unser Verhalten für uns sprechen lassen.
Wo in Zürich bist du gerne?
Ich bin auch in meiner Freizeit gerne im Niederdorf. Historisch und kulturell gesehen ist es ein wichtiger Ort für Zürich. Hier liebe ich das Altstädtische und die Abwechslung. Als extremer Naturfreund bin ich gerne im Wald oder am See unterwegs. Dinge, die in Zürich alle zu finden sind. Ich liebe diese Stadt und sie ist tief in meinem Herzen verankert. Auch wenn ich nicht alles komplett positiv empfinde, erlebe ich in Zürich oft Respekt, Toleranz und Akzeptanz.
![]()
Machst du dir Gedanken über Glück?
Für das eigene Glück ist jede*r selbst verantwortlich. Seit ich diesen Laden mitbegründet habe, ist mir das was-im-Moment-IST noch wichtiger geworden. Ich bin auf dieser Erde geboren und möchte mir nicht vorstellen, auf einem anderen Planeten Zuflucht finden zu müssen. Deshalb will ich für Veränderung einstehen. Vieles war schon vorgegeben, als wir auf diese Welt kamen, und wir müssen nicht alles so weitermachen, wie es andere damals für sich entschieden haben. Wenn wir offen sind für die Möglichkeiten, die in der Veränderung liegen, können wir die Lösungen kanalisieren und umsetzen.
Wie wärs mal mit...
...bewusster Wertschätzung und weniger ist mehr.
![]()
Vielen Dank an Alessandro für den Einblick in sein nachhaltiges Denken und Handeln in Zürich.
_
von Fabienne Steiner
am 14.10.2019
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Alessandro Ghiani, Mitbegründer des Ladens «Circle – The Sustainable Shop», im Zürcher Niederdorf traf uns zu einem spannenden Austausch rund um Nachhaltigkeit und vieles mehr. Was im März 2014 mit einem Bambusvelo startete, führte die fünf Gründer bis heute zu einem Ladenkonzept mit nachhaltigem und fairem Sortiment. Wir sprachen mit Alessandro über die tragende Rolle, die jeder der fünf in der Entwicklung spielt und wie sich ein bewussterer Lebensstil im Alltag ausprägen kann.

Lieber Alessandro, würdest du uns etwas mehr über dich erzählen?
Mir ist das Zusammenspiel von Mensch und Natur schon immer sehr wichtig gewesen. Nach meiner Lehre arbeitete ich im Lebensmittelbereich. Zu Beginn wollte ich etwas gegen Foodwaste unternehmen und habe diesbezüglich die strengen Regeln des Schweizer Gesetzes kennengelernt. Seit gut fünf Jahren hat sich uns mit den Läden im Niederdörfli und im Sihlcity ein spannendes neues Projekt eröffnet.

Wie kam es zum Ladenkonzept von «Circle –The Sustainable Shop»?
Severin und ich waren mit einem Bambusvelo in der Stadt Zürich unterwegs, auf der Suche nach einem Ort, an dem wir es ausstellen konnten. Dem damaligen Besitzer dieses Ladens gefielen das Velo und die Idee dahinter sehr gut und wir durften es bei ihm im Schaufenster platzieren. Das Interesse der Kundschaft bestand von Beginn an. Es war der beste Tag von «Não» in der ganzen Shopgeschichte. Nach einer gemeinsamen Zeit konnten wir das Ladenlokal übernehmen.
Heute bietet ihr im «Circle» eine breitere Produktpallette an.
Einmal begonnen, wollten wir unsere Idee mehr vorantreiben. Die angebotenen Produkte sollen faire und nachhaltig hergestellte Alternativen zu Massenwaren bieten. Die Auswahl wurde mit der Nachfrage erweitert. Mit einem Velo gestartet, geht es heute von Zahnbürsten über Kopfhörer hin zu Schokolade, Kleidern, Taschen, Sonnenbrillen und so einigem mehr.

Was bringt euch zusammen?
Wir konnten nicht nur das Angebot vergrössern, sondern auch unser Team wuchs. Severin, Marc, Lamar, Patrick und ich teilten uns die Aufgaben untereinander auf und positionierten uns als Firma neu. Auch wenn wir alle Individuen sind, sehen wir für uns in einem nachhaltigeren Lebensstil eine grössere Zufriedenheit. Jemand lebt vegetarisch, jemand isst regelmässig Fleisch, ein anderer einmal in der Woche. Diese individuellen Vorstellungen in Bezug auf Nachhaltigkeit auf einen Punkt zu bringen, war unsere Challenge. Ein Frage, die sich uns zum Beispiel stellte, war, ob und warum Leder verkaufen? Leder kann etwas Nachhaltiges sein, wenn man die Haut der Tiere benutzt, welche für die Fleischindustrie sterben. Ich finde es nicht okay, wenn ein Tier ausschliesslich für die Leder- oder Pelzproduktion sterben muss. Wir haben regional Jäger, die den Wildbestand sichern.

Die Kadaver müssen von den Jägern weggeworfen werden, damit sie ihre Entschädigung bekommen. Man könnte diese Felle für Pelze benutzen und damit ein Statement setzen. In der Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit entstehen in meinen Augen immer wieder neue Chancen. Beim Leder weiter gedacht, kommt man zur Art und Weise wie es gegerbt wird. Weltweit 95% davon werden in Südamerika und Asien auf Chrom-, Laugen- und Arsenbasis hergestellt, obwohl dies auch auf einer vegetabilen Basis möglich ist. Die Chemie gelangt über die Flüsse ungefiltert ins Meer. Arbeiter*innen und Einwohner*innen dieser Regionen haben Vergiftungen mit schwerwiegenden körperlichen Folgen. Wir wiederum kaufen im Lebensmittelladen einen Pangasiusfisch, der genau aus diesen Gewässern stammt. Ich denke, jeder Mensch bildet einen Teil eines Kreislaufs, der alles wiederbringt.

Welche Werte teilt ihr mit euren Geschäftspartner*innen?
In unseren Laden kommen Menschen aller Altersklassen, die grundsätzlich offen für bewussteren Konsum sind. Einen Wert, den wir mit unseren Partner*innen und Kund*innen in erster Linie teilen, ist sicherlich der des fairen und nachhaltigen Umgangs mit Mensch und Natur. Ausserdem ist für uns die Zusammenarbeit mit Locals wichtig, weshalb wir Produkte aus Zürich ins Sortiment mit einbeziehen.
Was bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit bedeutet für mich die Zukunft sichern. Mir ist es im Besonderen ein Anliegen auf das Thema «Konsum» aufmerksam zu machen. Die Energie von Geld würde länger halten, wenn wir nicht alles kaufen, nur weil wir es wollen, ohne es offensichtlich für unser Wohl zu brauchen. Wenn man ein T-Shirt für 5.- Fr sieht, kann man sich schon fragen, wie solch ein Preis zustande kommen kann. Statt 20 Shirts kaufe ich mir lieber zwei, die etwas mehr kosten und meinen Qualitäts- und Wertansprüchen genügen. Auch ein Nike Schuh kann zehn Jahre lang halten. Wenn man ihn gekauft hat, sollte man ihn auch wertschätzen und nutzen so lange es geht, damit sich die Herstellung gelohnt hat.

Trotz Werbung und breitem Angebot des Detailhandels entscheidet die Konsument*innen, was sie kaufen. Jede und jeder sollte selbst herausfiltern, was für sie und ihn gut ist und was nicht. Ein bewusstes Konsumverhalten von jedem einzelnen und jeder einzelnen kann in meinen Augen schier unvorstellbaren Wandel bringen.
Was hat es mit dem Namen des Ladens «Circle – The Sustainable Shop» auf sich?
Der Begriff Circle leitet sich vom Kreislauf ab, von dem wir gerade gesprochen haben. Das «C» von «Circle» ist ein Kreis, der nicht ganz geschlossen ist. Diese Öffnung steht da, weil man als Selbstversorger*in leben müsste, um hundertprozentig nachhaltig leben zu können. Ein gewisser Energieverlust geht mit dem Einkauf von Lebensmitteln und Kleidern automatisch einher. Die Öffnung des Kreises steht bei fünf vor zwölf. Es ist Zeit aufzuwachen. ‹Circle› wird spiegelverkehrt geschrieben, da wir neue Akzente setzen und gegen den Strom schwimmen wollen. Weg von diesem klassischen Konsum.
Wie meinst du das, «weg vom klassischen Konsum»?
Weg vom klassischen Konsum hin zu ethisch vertretbaren Produkten im rechten Mass. Ich hoffe, dass wir mit unseren gelebten Werten und unserem Angebot bei den Leuten einen Samen pflanzen können. Die Kunden in einer sogenannten Wegwerf- oder Konsumgesellschaft sind darauf angewiesen, sich selbst zu informieren und bezüglich eines Produktes Fragen zu stellen wie zum Beispiel: Wer hat es gemacht? Woher kommt es? Was musste passieren, damit ich dieses Produkt in meinen Händen halten kann?

Viele sagen, dass wir in der Schweiz nichts verändern können. Die rund acht Millionen Einwohner*innen der Schweiz haben genauso einen Einfluss wie jede*r andere. Neue Lebensweisen von Individuen können im Grossen viel verändern. Der Wandel ist im Gange und durch alle Altersklassen spürbar.
Euer Laden ist mitten in der Zürcher Altstadt zuhause, kannst du uns deine Geschichte zum «Niederdörfli» erzählen?
Das schönste am Niederdorf für mich ist, dass es sich immer noch wie ein Dorf anfühlt. Wir haben einen sehr familiären Umgang miteinander. Man grüsst sich auf den Gassen und hilft sich gegenseitig aus. Ich finde es etwas sehr Wichtiges, dass wir uns wieder mehr ins Gesicht und die Augen schauen und miteinander reden, anstatt nur an das Handy zu denken. Zuneigung und Gefühle können nur durch persönlichen Kontakt wirklich erlebt werden. Ich schätze den Austausch mit den Besucher*innen und ihre Geschichten, die sie in den Laden bringen.

Brauchen eure Kund*innen eine Einkaufstasche, wenn sie bei euch einkaufen?
Viele bringen eine eigene Tasche mit. Wenn die Kund*innen zum Beispiel beim Kauf einer Jacke oder grösseren Dingen eine benötigen, bekommen sie auf jeden Fall eine Papiertasche. Im Vergleich der Standorte haben im Niederdorf geschätzt 90% eine Tasche dabei. Dieser Prozentsatz ist in einem Konsumtempel wie dem Sihlcity etwas geringer.
Wo ist dein Verhalten nicht nachhaltig?
Meine Wurzeln stammen von einer Insel, was für mich mit gelegentlichen Reisen verbunden ist. Von den zwei Möglichkeiten, nach Sardinien zu gelangen, versuche ich auf das Flugzeug zu verzichten. Das Meer und die Natur sind für mich gerade wegen meiner Herkunft sehr wichtig. Ich versuche mir bei der Planung von Reisen Gedanken zu machen, wie ich einen Trip unternehme.

Wenn man einen Monat nach Thailand reist, wäre man mit dem Velo vielleicht ein Jahr unterwegs. Da scheint es fast notwendig, per Flugzeug zu reisen. Man soll sich nicht alles selbst verbieten, vielmehr geht es für mich wie so oft um das richtige Mass. Ich lasse dort etwas weg, wo es mir möglich erscheint. Wir können nicht alles von heute auf morgen komplett drehen, aber wir können Pioniere sein und unser Verhalten für uns sprechen lassen.
Wo in Zürich bist du gerne?
Ich bin auch in meiner Freizeit gerne im Niederdorf. Historisch und kulturell gesehen ist es ein wichtiger Ort für Zürich. Hier liebe ich das Altstädtische und die Abwechslung. Als extremer Naturfreund bin ich gerne im Wald oder am See unterwegs. Dinge, die in Zürich alle zu finden sind. Ich liebe diese Stadt und sie ist tief in meinem Herzen verankert. Auch wenn ich nicht alles komplett positiv empfinde, erlebe ich in Zürich oft Respekt, Toleranz und Akzeptanz.

Machst du dir Gedanken über Glück?
Für das eigene Glück ist jede*r selbst verantwortlich. Seit ich diesen Laden mitbegründet habe, ist mir das was-im-Moment-IST noch wichtiger geworden. Ich bin auf dieser Erde geboren und möchte mir nicht vorstellen, auf einem anderen Planeten Zuflucht finden zu müssen. Deshalb will ich für Veränderung einstehen. Vieles war schon vorgegeben, als wir auf diese Welt kamen, und wir müssen nicht alles so weitermachen, wie es andere damals für sich entschieden haben. Wenn wir offen sind für die Möglichkeiten, die in der Veränderung liegen, können wir die Lösungen kanalisieren und umsetzen.
Wie wärs mal mit...
...bewusster Wertschätzung und weniger ist mehr.

Vielen Dank an Alessandro für den Einblick in sein nachhaltiges Denken und Handeln in Zürich.
_
von Fabienne Steiner
am 14.10.2019
Fotos
© Marcos Pérez für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Praxis «Dynamis»: Im Gespräch mit den Homöopathinnen Sonja Madörin und Rita Manhart
Geht es um Homöopathie scheiden sich die Geister. Die einen sind überzeugt von deren heilenden Wirkung – mitunter weil sie diese aus Patienten- oder Ärzteperspektive selber erlebt haben – die anderen tun die Homöopathie als Humbug ab und zitieren wissenschaftliche Studien, wonach erfolgreiche homöopathische Behandlungen mit dem Placebo-Effekt gleichzusetzen seien. Gemäss Bundesamt für Statistik nimmt knapp ein Drittel aller Schweizer*innen jährlich mindestens eine Behandlung der Kategorie Komplementärmedizin in Anspruch. Am häufigsten werden dabei Homöopath*innen aufgesucht. Um mehr über diese Alternativmedizin zu erfahren, trafen wir Rita und Sonja in ihrer Homöopathie Praxis im Gundeldingerfeld.
![]()
Liebe Sonja und Rita, ihr führt zusammen die Homöopathie-Praxis «Dynamis» mit drei Standorten in Basel, Muttenz und Sissach. Wofür steht «Dynamis»?
Sonja: «Dynamis» steht in der Homöopathie für die Lebenskraft des Menschen. Diese ist für die Gesundheit verantwortlich. Ausserdem steht «Dynamis» für Dynamik, Bewegung und Leben. Deshalb ist «Dynamis» ein passender Name für unsere Praxis.
Rita: Der Begriff wurde von Samuel Hahnemann geprägt, dem Begründer der Homöopathie. Wenn die Lebenskraft geschwächt ist, kann aus homöopathischer Sicht Krankheit entstehen. Durch die Stärkung der Lebenskraft kann Gesundheit wieder erlangt werden.
![]()
Ihr habt beide eine berufliche Vergangenheit, die nichts mit Homöopathie zu tun hat. Wie seid ihr dazu gekommen «Dynamis» ins Leben zu rufen?
Rita: Zur Homöopathie bin ich durch meine Kinder gekommen. Es war, als diese noch klein waren und ich mit ihnen einige prägende Erfahrungen bei medizinischen Behandlungen machte. Als ich zum Beispiel mit meinem jüngeren Sohn wiederholt wegen Ohrenschmerzen unseren schulmedizinischen Arzt konsultierte, war ich über die ständig verschriebenen standardisierten Verschreibungen von starken Medikamenten überrascht. Zumal diese nicht ohne Nebenwirkungen daherkamen. Ausserdem wurde mein Sohn nicht gesünder, sondern eher anfälliger und wir mussten deshalb den Arzt zunehmend häufiger aufsuchen. Aus dieser Not heraus war ich neugierig und schaute mich nach Alternativen zur Schulmedizin um. So habe ich die Homöopathie entdeckt. Mit homöopathischen Behandlungen konnten meine Kinder rasch und nachhaltig gesund werden. Das hat mich fasziniert. Die Faszination liess mich nicht mehr los, sodass ich Jahre später das 4-jährige Studium zur Homöopathin absolvierte.
Sonja: Bei mir war das genau gleich, auch ich habe den Weg zur Homöopathie durch meine Kinder gefunden. Um auf deine Frage zurück zu kommen, wie es zur Gründung von «Dynamis» kam: Wir lernten uns während des Studiums kennen und verstanden uns von Anfang an sehr gut. Weil wir ein Dream-Team waren, gründeten wir die Praxis und machten uns selbstständig.
![]()
Worin seht ihr gegenseitig eure Stärken?
Sonja: Wir sind grundverschiedene Charaktere. Es ist für mich sehr wertvoll, mit Rita zusammenzuarbeiten. In der Regel machen wir jeden Monat eine Intervision und besprechen dabei schwierige Fälle. Rita arbeitet sehr exakt, ruhig und sie führt eine eigene Materia Medica. Dies ist eine umfassende Sammlung von Arzneimittelbildern die für die homöopathische Arbeit sehr wertvoll ist. Ich hingegen bin auch mal von einer kreativen Lösungsidee begeistert und entscheide dann schnell. Bei den Intervisionen stelle ich fest, dass sich die sorgfältige, detailhafte Arbeit von Rita und meine kreative, schnelle Arbeitsweise perfekt ergänzen.
![]()
Rita: Das erlebe ich – einfach umgekehrt – genauso. Ausserdem schätze ich es, dass mich Sonja dazu bringt, zum Beispiel bei geschäftlichen Aspekten risikofreudiger zu sein. Ich zum Beispiel könnte monatelang abwägen, ob wir eine neue Website brauchen oder nicht. Dank Sonjas Drive gelingt es uns, solche Dinge mit Schwung durchzuziehen.
Ihr ergänzt euch also ziemlich gut. Wann habt ihr diese Dynamik bemerkt?
Sonja: Ich vermute schon am ersten Tag des Studiums. Ich weiss noch, wie ich in den Vorlesungssaal hineingekommen bin und Rita am Tisch sitzen sah. Da habe ich mir gedacht: Die ist interessant.
![]()
![]()
Welches sind die grundlegenden Elemente einer homöopathischen Behandlung?
Sonja: Wenn ein Patient das erste Mal zu uns kommt, erfolgt zuerst die Fallaufnahme, die sogenannte Erstanamnese. Durch die genaue Befragung des Patienten erhalten wir anhand der Gesamtheit der Symptome ein detailliertes Bild der individuellen Persönlichkeit. Nach dem Termin erarbeiten wir das passende homöopathische Mittel, welches dann dem Patienten verschrieben wird. Dieser zweite Teil der Arbeit ist sehr wichtig und dauert entsprechend lange. In Abständen von ca. vier Wochen gibt es Folgekonsultationen, bei denen Veränderungen des Befindens besprochen werden, damit bei Bedarf das Mittel angepasst werden kann.
![]()
Eure Patient*innen werden angewiesen, sich selber in der Zwischenzeit gut zu beobachten?
Sonja: Nicht unbedingt; bei der zweiten Sitzung erzählen die Patient*innen spontan, wie es ihnen ergangen ist. Dabei muss man nicht unbedingt Buch führen. Allein schon die Tatsache, dass jemand nicht mehr kommt oder dass jemand sehr bald wieder kommt und wie die Person dann von ihrem Erleben berichtet, zeigt an, ob man das richtige Mittel gefunden hat.
![]()
Was fasziniert euch an der homöopathischen Vorgehensweise?
Rita: Wir suchen in der Behandlung nach dem roten Faden im Erleben des Patienten. So wie der Patient den Schmerz erlebt, erlebt er auch Stress im Geschäft oder Streit in der Beziehung. Auf zehn unterschiedliche Patienten mit Magenbeschwerden gibt es deshalb zehn unterschiedliche Verschreibungen, weil jeder dieser Patienten die Magenbeschwerden individuell erlebt und beschreibt. Nur durch die Deckungsgleichheit des homöopathischen Mittels mit den beschriebenen Beschwerden ist eine Heilung möglich.
![]()
Welche*r Homöopath*in ist eine Inspiration für euch und wie ist die Homöopathie in der Schweiz organisiert?
Rita und Sonja: Der indische Homöopath Dr. Rajan Sankaran ist definitiv eine Inspiration für uns, weil er die Forschung und die Systematisierung der Homöopathie vorantreibt. In der Schweiz gibt es den Dachverband der Homöopath*innen. Dieser setzt sich für den Berufsstand ein. Zum Beispiel hat der Dachverband erreicht, dass es eine Eidgenössische Prüfung für Homöopathie gibt.
![]()
Kürzlich wurde eine Meta-Statistik des renommierten Cochrane Instituts publik, wonach Antidepressiva in einer klinischen Studie nur gering stärker wirkten als die Placebos der Kontrollgruppen. Der Unterschied sei sogar so gering, dass ein Arzt keinen Unterschied feststellen könne. 2005 wurde im Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) mittels klinischen Studien festgestellt, dass die homöopathischen Arzneimittel gleich gut wirkten wie die Placebos der Kontrollgruppen. Demgegenüber kommt die PEK-Studie unter Einbezug qualitativer Patientenbefragung und weiteren Erkenntnismaterials jedoch auch zum Schluss, dass die Homöopathie in einigen Gebieten sogar besser abschneidet als herkömmliche, schulmedizinische Behandlungen. Es gibt also durchaus Potential für Diskussionen.
Sonja: Die Homöopathie wird für die klinischen Studien der evidenzbasierten Medizin mit den Instrumenten der Schulmedizin gemessen. Dies funktioniert aber nicht, weil die Axiome der Schulmedizin um die Idee herum konstruiert sind, dass Medikamente Symptome unterdrücken sollen. Die Homöopathie ist jedoch eine individuelle Heilmethode, welche die Selbstheilung des Menschen unterstützt. Die Funktionsweise der Homöopathie ist derjenigen der klassischen Medizin genau entgegengesetzt. Es ist durchaus möglich, dass mehrere Leute wegen ähnlichen Asthmabeschwerden zu uns kommen und alle ganz unterschiedliche homöopathische Arzneimittel erhalten.
![]()
Rita: Es gibt wenig Interesse von Seiten des medizinischen Establishments, dass die komplementären Heilmethoden wissenschaftlich belegbar werden. Im Endeffekt ist es immer auch eine Frage des Geldes. Bei diesem Thema beziehe ich mich auch immer gerne auf ein Zitat: “Wenn ein Chemiker die homöopathische Arznei untersucht, findet er nur Wasser und Alkohol; wenn er eine Diskette untersucht, nur Eisenoxid und Vinyl. Beide können jedoch jede Menge Informationen bergen.” – Dr. Peter Fisher, Forschungsleiter am Royal London Homeopathic Hospital.
![]()
Gemäss Bundesamt für Statistik nehmen 25% der Schweizer*innen wöchentlich Schmerzmittel ein. Wird der Mensch mit dem Bedürfnis nach Tabletten geboren?
Rita: Schmerzen schwächen uns – deshalb möchten wir sie so schnell wie möglich loswerden. Zudem tendiert der Mensch dazu, Lösungen anzunehmen, die ihm angeboten werden. Homöopathie bietet eine alternative Möglichkeit, mit Krankheit umzugehen. Im Gegensatz zur Unterdrückung der Symptome mit Schmerzmitteln, wirkt die Homöopathie stärkend auf die Lebenskraft, was wiederum die Selbstheilung möglich macht. Dadurch kann der ursprüngliche, gesunde Zustand eines Menschen wieder hergestellt werden.
![]()
Sonja: Die Schulmedizin und die Homöopathie sind zwei komplett unterschiedliche oder wie bereits gesagt gegensätzliche Systeme. Während die Schulmedizin einen eher segmentierten Ansatz bei der Behandlung von Patienten verfolgt, sucht die Homöopathie nach Zusammenhängen auf allen Ebenen des menschlichen Erlebens.
![]()
In der Schweiz gehört die homöopathische Behandlung seit den Bestrebungen von Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss kurz vor der Jahrtausendwende zum Katalog der Grundversicherung. Pascal Couchepin kippte diese 2005 im Alleingang wieder hinaus. Im Jahr 2009 entschied sich das Volk an der Urne, die Komplementärmedizin in der Bundesverfassung zu verankern. Hat der Umstand, dass die Homöopathie nach wie vor umstritten ist, Auswirkungen auf euren Alltag?
Sonja: Für unseren Arbeitsalltag ist diese Sache eher zweitrangig. Wir machen seit Jahren die Erfahrung, dass unsere Patient*innen mit Hilfe unserer Behandlung gesund werden. In anderen Bereichen des täglichen Lebens gibt es jedoch grosse Auswirkungen. Wir werden ständig damit konfrontiert.
![]()
Rita: Eine wiederkehrende Situation die ich erlebe ist zum Beispiel, dass sich die Leute bei einem gemütlichen Essen gegenseitig vorstellen und erzählen, was sie arbeiten. Wenn ich dann erzähle, dass ich Homöopathin bin, reagieren einige Leute mit einem langen Schweigen oder wechseln kommentarlos das Thema. Ich denke, dass viele Menschen Alternativen scheuen, da man sich auf diesem Weg eine eigene Meinung bilden und quellenkritisch werden muss. Ich persönlich finde das befreiend, kann aber verstehen, dass das auch Angst machen kann.
![]()
Wer kommt zu euch in die Behandlung?
Sonja: Es kommen Leute, die gesund werden wollen. Häufig hören wir von den Leuten, dass sie unzufrieden sind mit den schulmedizinischen Behandlungen, welche sie zuvor in Anspruch genommen haben. Es kommen auch Leute, die einfach eine Entwicklung machen wollen. Es kommen Mütter mit kleinen Kindern oder Babys. Es kommen Leute mit Bauchschmerzen, mit Augenentzündungen.
Wenn eure Behandlung eine Reisedestination wäre, wohin würden eure Klienten reisen?
Sonja: Bei mir würden sie in ihr eigenes Inneres reisen.
Rita: An den individuellen Wohlfühlort.
![]()
Welche Frage würdet ihr euch gegenseitig stellen, wenn ihr an meiner Stelle das Interview führen würdet?
Sonja an Rita: Was bedeutet für dich Homöopathie, was hat sie für einen Stellenwert in deinem Leben?
Rita: Für mich bedeutet es, dass ich einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen kann. Dass ich zum Beispiel direkt helfen kann, durch meine Tätigkeit die Menge an Antibiotikum im Trinkwasser zu reduzieren. Dass ich meiner Umwelt etwas Gutes tun kann. Und dass ich irgendwann – ich habe vor diesem Interview nachgeschaut, was auf dem Grabstein von Samuel Hahnemann steht – sagen darf: „Non inutilis vixi“ (dt.: „Ich habe nicht unnütz gelebt.“).
![]()
Rita an Sonja: Würdest du denselben Weg noch einmal gehen?
Sonja: Diese Frage kann ich nicht beantworten.
Wie wärs mal mit...
...Homöopathie?
![]()
Vielen Dank an Rita und Sonja für das spannende Gespräch über Alternativmedizin in ihrer Praxis.
_
von Timon Sutter
am 07.10.2019
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Geht es um Homöopathie scheiden sich die Geister. Die einen sind überzeugt von deren heilenden Wirkung – mitunter weil sie diese aus Patienten- oder Ärzteperspektive selber erlebt haben – die anderen tun die Homöopathie als Humbug ab und zitieren wissenschaftliche Studien, wonach erfolgreiche homöopathische Behandlungen mit dem Placebo-Effekt gleichzusetzen seien. Gemäss Bundesamt für Statistik nimmt knapp ein Drittel aller Schweizer*innen jährlich mindestens eine Behandlung der Kategorie Komplementärmedizin in Anspruch. Am häufigsten werden dabei Homöopath*innen aufgesucht. Um mehr über diese Alternativmedizin zu erfahren, trafen wir Rita und Sonja in ihrer Homöopathie Praxis im Gundeldingerfeld.
Liebe Sonja und Rita, ihr führt zusammen die Homöopathie-Praxis «Dynamis» mit drei Standorten in Basel, Muttenz und Sissach. Wofür steht «Dynamis»?
Sonja: «Dynamis» steht in der Homöopathie für die Lebenskraft des Menschen. Diese ist für die Gesundheit verantwortlich. Ausserdem steht «Dynamis» für Dynamik, Bewegung und Leben. Deshalb ist «Dynamis» ein passender Name für unsere Praxis.
Rita: Der Begriff wurde von Samuel Hahnemann geprägt, dem Begründer der Homöopathie. Wenn die Lebenskraft geschwächt ist, kann aus homöopathischer Sicht Krankheit entstehen. Durch die Stärkung der Lebenskraft kann Gesundheit wieder erlangt werden.
Ihr habt beide eine berufliche Vergangenheit, die nichts mit Homöopathie zu tun hat. Wie seid ihr dazu gekommen «Dynamis» ins Leben zu rufen?
Rita: Zur Homöopathie bin ich durch meine Kinder gekommen. Es war, als diese noch klein waren und ich mit ihnen einige prägende Erfahrungen bei medizinischen Behandlungen machte. Als ich zum Beispiel mit meinem jüngeren Sohn wiederholt wegen Ohrenschmerzen unseren schulmedizinischen Arzt konsultierte, war ich über die ständig verschriebenen standardisierten Verschreibungen von starken Medikamenten überrascht. Zumal diese nicht ohne Nebenwirkungen daherkamen. Ausserdem wurde mein Sohn nicht gesünder, sondern eher anfälliger und wir mussten deshalb den Arzt zunehmend häufiger aufsuchen. Aus dieser Not heraus war ich neugierig und schaute mich nach Alternativen zur Schulmedizin um. So habe ich die Homöopathie entdeckt. Mit homöopathischen Behandlungen konnten meine Kinder rasch und nachhaltig gesund werden. Das hat mich fasziniert. Die Faszination liess mich nicht mehr los, sodass ich Jahre später das 4-jährige Studium zur Homöopathin absolvierte.
Sonja: Bei mir war das genau gleich, auch ich habe den Weg zur Homöopathie durch meine Kinder gefunden. Um auf deine Frage zurück zu kommen, wie es zur Gründung von «Dynamis» kam: Wir lernten uns während des Studiums kennen und verstanden uns von Anfang an sehr gut. Weil wir ein Dream-Team waren, gründeten wir die Praxis und machten uns selbstständig.
Worin seht ihr gegenseitig eure Stärken?
Sonja: Wir sind grundverschiedene Charaktere. Es ist für mich sehr wertvoll, mit Rita zusammenzuarbeiten. In der Regel machen wir jeden Monat eine Intervision und besprechen dabei schwierige Fälle. Rita arbeitet sehr exakt, ruhig und sie führt eine eigene Materia Medica. Dies ist eine umfassende Sammlung von Arzneimittelbildern die für die homöopathische Arbeit sehr wertvoll ist. Ich hingegen bin auch mal von einer kreativen Lösungsidee begeistert und entscheide dann schnell. Bei den Intervisionen stelle ich fest, dass sich die sorgfältige, detailhafte Arbeit von Rita und meine kreative, schnelle Arbeitsweise perfekt ergänzen.
Rita: Das erlebe ich – einfach umgekehrt – genauso. Ausserdem schätze ich es, dass mich Sonja dazu bringt, zum Beispiel bei geschäftlichen Aspekten risikofreudiger zu sein. Ich zum Beispiel könnte monatelang abwägen, ob wir eine neue Website brauchen oder nicht. Dank Sonjas Drive gelingt es uns, solche Dinge mit Schwung durchzuziehen.
Ihr ergänzt euch also ziemlich gut. Wann habt ihr diese Dynamik bemerkt?
Sonja: Ich vermute schon am ersten Tag des Studiums. Ich weiss noch, wie ich in den Vorlesungssaal hineingekommen bin und Rita am Tisch sitzen sah. Da habe ich mir gedacht: Die ist interessant.
Welches sind die grundlegenden Elemente einer homöopathischen Behandlung?
Sonja: Wenn ein Patient das erste Mal zu uns kommt, erfolgt zuerst die Fallaufnahme, die sogenannte Erstanamnese. Durch die genaue Befragung des Patienten erhalten wir anhand der Gesamtheit der Symptome ein detailliertes Bild der individuellen Persönlichkeit. Nach dem Termin erarbeiten wir das passende homöopathische Mittel, welches dann dem Patienten verschrieben wird. Dieser zweite Teil der Arbeit ist sehr wichtig und dauert entsprechend lange. In Abständen von ca. vier Wochen gibt es Folgekonsultationen, bei denen Veränderungen des Befindens besprochen werden, damit bei Bedarf das Mittel angepasst werden kann.
Eure Patient*innen werden angewiesen, sich selber in der Zwischenzeit gut zu beobachten?
Sonja: Nicht unbedingt; bei der zweiten Sitzung erzählen die Patient*innen spontan, wie es ihnen ergangen ist. Dabei muss man nicht unbedingt Buch führen. Allein schon die Tatsache, dass jemand nicht mehr kommt oder dass jemand sehr bald wieder kommt und wie die Person dann von ihrem Erleben berichtet, zeigt an, ob man das richtige Mittel gefunden hat.
Was fasziniert euch an der homöopathischen Vorgehensweise?
Rita: Wir suchen in der Behandlung nach dem roten Faden im Erleben des Patienten. So wie der Patient den Schmerz erlebt, erlebt er auch Stress im Geschäft oder Streit in der Beziehung. Auf zehn unterschiedliche Patienten mit Magenbeschwerden gibt es deshalb zehn unterschiedliche Verschreibungen, weil jeder dieser Patienten die Magenbeschwerden individuell erlebt und beschreibt. Nur durch die Deckungsgleichheit des homöopathischen Mittels mit den beschriebenen Beschwerden ist eine Heilung möglich.
Welche*r Homöopath*in ist eine Inspiration für euch und wie ist die Homöopathie in der Schweiz organisiert?
Rita und Sonja: Der indische Homöopath Dr. Rajan Sankaran ist definitiv eine Inspiration für uns, weil er die Forschung und die Systematisierung der Homöopathie vorantreibt. In der Schweiz gibt es den Dachverband der Homöopath*innen. Dieser setzt sich für den Berufsstand ein. Zum Beispiel hat der Dachverband erreicht, dass es eine Eidgenössische Prüfung für Homöopathie gibt.
Kürzlich wurde eine Meta-Statistik des renommierten Cochrane Instituts publik, wonach Antidepressiva in einer klinischen Studie nur gering stärker wirkten als die Placebos der Kontrollgruppen. Der Unterschied sei sogar so gering, dass ein Arzt keinen Unterschied feststellen könne. 2005 wurde im Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) mittels klinischen Studien festgestellt, dass die homöopathischen Arzneimittel gleich gut wirkten wie die Placebos der Kontrollgruppen. Demgegenüber kommt die PEK-Studie unter Einbezug qualitativer Patientenbefragung und weiteren Erkenntnismaterials jedoch auch zum Schluss, dass die Homöopathie in einigen Gebieten sogar besser abschneidet als herkömmliche, schulmedizinische Behandlungen. Es gibt also durchaus Potential für Diskussionen.
Sonja: Die Homöopathie wird für die klinischen Studien der evidenzbasierten Medizin mit den Instrumenten der Schulmedizin gemessen. Dies funktioniert aber nicht, weil die Axiome der Schulmedizin um die Idee herum konstruiert sind, dass Medikamente Symptome unterdrücken sollen. Die Homöopathie ist jedoch eine individuelle Heilmethode, welche die Selbstheilung des Menschen unterstützt. Die Funktionsweise der Homöopathie ist derjenigen der klassischen Medizin genau entgegengesetzt. Es ist durchaus möglich, dass mehrere Leute wegen ähnlichen Asthmabeschwerden zu uns kommen und alle ganz unterschiedliche homöopathische Arzneimittel erhalten.
Rita: Es gibt wenig Interesse von Seiten des medizinischen Establishments, dass die komplementären Heilmethoden wissenschaftlich belegbar werden. Im Endeffekt ist es immer auch eine Frage des Geldes. Bei diesem Thema beziehe ich mich auch immer gerne auf ein Zitat: “Wenn ein Chemiker die homöopathische Arznei untersucht, findet er nur Wasser und Alkohol; wenn er eine Diskette untersucht, nur Eisenoxid und Vinyl. Beide können jedoch jede Menge Informationen bergen.” – Dr. Peter Fisher, Forschungsleiter am Royal London Homeopathic Hospital.
Gemäss Bundesamt für Statistik nehmen 25% der Schweizer*innen wöchentlich Schmerzmittel ein. Wird der Mensch mit dem Bedürfnis nach Tabletten geboren?
Rita: Schmerzen schwächen uns – deshalb möchten wir sie so schnell wie möglich loswerden. Zudem tendiert der Mensch dazu, Lösungen anzunehmen, die ihm angeboten werden. Homöopathie bietet eine alternative Möglichkeit, mit Krankheit umzugehen. Im Gegensatz zur Unterdrückung der Symptome mit Schmerzmitteln, wirkt die Homöopathie stärkend auf die Lebenskraft, was wiederum die Selbstheilung möglich macht. Dadurch kann der ursprüngliche, gesunde Zustand eines Menschen wieder hergestellt werden.
Sonja: Die Schulmedizin und die Homöopathie sind zwei komplett unterschiedliche oder wie bereits gesagt gegensätzliche Systeme. Während die Schulmedizin einen eher segmentierten Ansatz bei der Behandlung von Patienten verfolgt, sucht die Homöopathie nach Zusammenhängen auf allen Ebenen des menschlichen Erlebens.
In der Schweiz gehört die homöopathische Behandlung seit den Bestrebungen von Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss kurz vor der Jahrtausendwende zum Katalog der Grundversicherung. Pascal Couchepin kippte diese 2005 im Alleingang wieder hinaus. Im Jahr 2009 entschied sich das Volk an der Urne, die Komplementärmedizin in der Bundesverfassung zu verankern. Hat der Umstand, dass die Homöopathie nach wie vor umstritten ist, Auswirkungen auf euren Alltag?
Sonja: Für unseren Arbeitsalltag ist diese Sache eher zweitrangig. Wir machen seit Jahren die Erfahrung, dass unsere Patient*innen mit Hilfe unserer Behandlung gesund werden. In anderen Bereichen des täglichen Lebens gibt es jedoch grosse Auswirkungen. Wir werden ständig damit konfrontiert.
Rita: Eine wiederkehrende Situation die ich erlebe ist zum Beispiel, dass sich die Leute bei einem gemütlichen Essen gegenseitig vorstellen und erzählen, was sie arbeiten. Wenn ich dann erzähle, dass ich Homöopathin bin, reagieren einige Leute mit einem langen Schweigen oder wechseln kommentarlos das Thema. Ich denke, dass viele Menschen Alternativen scheuen, da man sich auf diesem Weg eine eigene Meinung bilden und quellenkritisch werden muss. Ich persönlich finde das befreiend, kann aber verstehen, dass das auch Angst machen kann.
Wer kommt zu euch in die Behandlung?
Sonja: Es kommen Leute, die gesund werden wollen. Häufig hören wir von den Leuten, dass sie unzufrieden sind mit den schulmedizinischen Behandlungen, welche sie zuvor in Anspruch genommen haben. Es kommen auch Leute, die einfach eine Entwicklung machen wollen. Es kommen Mütter mit kleinen Kindern oder Babys. Es kommen Leute mit Bauchschmerzen, mit Augenentzündungen.
Wenn eure Behandlung eine Reisedestination wäre, wohin würden eure Klienten reisen?
Sonja: Bei mir würden sie in ihr eigenes Inneres reisen.
Rita: An den individuellen Wohlfühlort.
Welche Frage würdet ihr euch gegenseitig stellen, wenn ihr an meiner Stelle das Interview führen würdet?
Sonja an Rita: Was bedeutet für dich Homöopathie, was hat sie für einen Stellenwert in deinem Leben?
Rita: Für mich bedeutet es, dass ich einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen kann. Dass ich zum Beispiel direkt helfen kann, durch meine Tätigkeit die Menge an Antibiotikum im Trinkwasser zu reduzieren. Dass ich meiner Umwelt etwas Gutes tun kann. Und dass ich irgendwann – ich habe vor diesem Interview nachgeschaut, was auf dem Grabstein von Samuel Hahnemann steht – sagen darf: „Non inutilis vixi“ (dt.: „Ich habe nicht unnütz gelebt.“).
Rita an Sonja: Würdest du denselben Weg noch einmal gehen?
Sonja: Diese Frage kann ich nicht beantworten.
Wie wärs mal mit...
...Homöopathie?
Vielen Dank an Rita und Sonja für das spannende Gespräch über Alternativmedizin in ihrer Praxis.
_
von Timon Sutter
am 07.10.2019
Fotos
© Ana Brankovic für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Doodah: Im Gespräch mit Andreas Wider
Man hört sie schon von weitem mit ihren Holzbrettern auf vier Rollen und weiss auch wohin sie fahren. Die Skater sind auf dem Weg in den Skate- und Snowboardshop Doodah, welcher schon seit Jahren ein fester Bestandteil der Basler Innenstadt ist. Hier findet man nicht nur die neuesten Utensilien für seinen bevorzugten Brettsport, sondern auch ein aufgestelltes Team und einen Treffpunkt für die Skater der Umgebung. Vom Lehrling zum Shop-Manager, vom Tellerwäscher zum Millionär? Andreas Wider erzählt von seiner Laufbahn im Doodah und wie die Skate-Szene zur Familie wurde.
![]()
Hey, wer bist Du und was machst Du?
Ich heisse Andreas Wider, wohne hier in Basel und arbeite im Skate- und Snowboardshop Doodah. Ich bin in Asien aufgewachsen, geboren bin ich in Taiwan, meine Eltern sind jedoch Schweizer. Meine Familie hat dann einige Jahre in Bangkok und in Hongkong gelebt, bevor wir in die Schweiz kamen. Hier besuchte ich ein Internat in der Nähe von Frauenfeld, wo wir zur Belohnung für gutes Benehmen manchmal am Abend im Block 47 skaten gehen durften. Da hatte ich meinen ersten Kontakt mit der Skateboard-Szene. Einmal bekam ich sogar Rodney Mullens Unterschrift auf meine Jeans, darauf war ich ziemlich stolz. Und schliesslich bin ich nach Basel umgezogen. Wir waren schon früher oft während den Ferien in der Schweiz, daher kommt auch meine Liebe zum Schneesport und zu den «Brättli».
![]()
Und wie bist du zum Doodah Basel gekommen?
Meinen ersten Kontakt zum Doodah hatte ich in St. Gallen, wo wir manchmal einkaufen gingen. Als ich dann nach Basel kam und nach der Schule auf die Suche nach einer Lehrstelle ging, sah ich, dass es den Shop neu auch in Basel gab. Durch meine Leidenschaft für Snowboards und Skateboards war für mich klar, dass ich da arbeiten wollte. Ich war dann der erste Lehrling im Doodah Basel, kurz nachdem der Shop hier eröffnet wurde.
![]()
![]()
Was liebst du an deinem Beruf und was magst du eher weniger?
Das Beste hier sind auf jeden Fall die Leute. Ob das nun das Team ist oder die vielen spannenden Menschen, die man hier kennenlernt, das Skaten und Snowboarden verbindet einfach so viele verschiedene Leute. Das ist schon sehr schön. Zudem kann man sein Hobby in den Beruf integrieren und voll und ganz hinter den Produkten stehen, die man verkauft. Was mir an meinem Alltag weniger gut gefällt sind die Tage, an denen wenig los ist. Da muss man halt trotzdem präsent sein und kann nicht einfach nach Hause gehen. Zudem muss man eigentlich immer gut drauf sein, hat man mal einen schlechten Tag, darf man das nicht zeigen. Das ist nicht immer einfach.
![]()
Du bist ja schon lange dabei, gleich nach der Schule hast du hier deine Lehre absolviert, warst dann Mitarbeiter und nun Shop Manager. Was hat sich über die Jahre so verändert?
Jetzt abgesehen davon, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe, hat sich auch sonst einiges geändert. Früher haben die Kunden einem die Kleider aus den Kisten heraus gekauft und heute ist natürlich eine stärkere Gewichtung auf dem Online-Markt zu spüren. Die Dienstleistung, die Präsentation der Ware und das gesamte Einkaufserlebnis im Shop sind dadurch viel wichtiger geworden. Aber auch ein anderer Umgang mit Kleidern und der Ware ist mir aufgefallen. Da hat die Wertschätzung zum Teil abgenommen.
![]()
Welche Musik läuft im Doodah von morgens bis abends?
Früher sind wir immer zu Musik Hug gegangen, mit denen hatten wir den Deal, dass wir uns jede Woche fünf CDs aussuchen konnten. Und dann hat man halt sechs Tage lang nur das gehört. Das ist heute zum Glück einfacher geworden und jeder hat so seine Playlists, die er oder sie abspielt.
![]()
Wer ist in deinem Team und wieso ist es das beste Team von ganz Basel?
Wir sind drei Festangestellte und drei Lehrlinge. Zu meinem festen Team gehören zum Einen Nadia, sie kam damals vom Downtown zu uns und ist auch schon lange ein wichtiger Teil des Teams. Und zum Anderen ist seit einem Jahr Louis fix bei uns, er kam damals als Ersatz für Chris. Wir sind eigentlich alle offen, haben Spass am Skaten oder Snowboarden und sind so auch zu Freunden geworden, die gerne auch mal nach der Arbeit gemeinsam etwas unternehmen. Das habe ich bereits von meinen früheren Arbeitgebern gelernt, wenn das Team stimmt, macht die Arbeit einfach viel mehr Spass. Und da hatten wir bisher eigentlich immer Glück und gute Leute dabei, die auch zu einer Art Familie geworden sind.
![]()
![]()
Der Laden hat sich über die Jahre gegen ähnliche Shops durchgesetzt und ist auch stark in der lokalen Skate-Szene tätig. Welche Rolle übernehmt ihr dabei und wie stark bist du mit den Basler Skatern vernetzt?
Es ist interessant zu sehen, wie manche von den Skatern schon seit klein auf im Doodah einkaufen und plötzlich werden auch diese erwachsen. Unser Shop ist da auf jeden Fall auch ein Ort zum Verweilen, ein Treffpunkt für die Skater aus Basel und gleichzeitig finden hier Events rund ums Skaten statt. Zum Beispiel war kürzlich ein Board-Release und sonst gibt es manchmal Filmpremieren oder der Doodah dient als Ausgangspunkt für Skate-Contests. Man trifft sich hier und geht dann weiter. Meistens braucht dann einer der Skater noch eine neue Hose, ein Paar Socken der Marke Stance – das sind die Besten - oder einen Schuhbändel. Dafür sind wir immer die erste Adresse, aber auch hier sind die meisten Skater zu Freunden geworden und der Shop ist nicht nur ein Geschäft, sondern ein Ort des Zusammenseins. Weiter hat Doodah auch ein eigenes Team aus SnowboarderInnen und SkaterInnen, welches wir als Sponsoren unterstützen. Seit Jahren wird dabei der Nachwuchs gefördert und es macht Spass zu sehen, was aus ihnen geworden ist.
Was sind drei Dinge, die man im Doodah Basel immer findet?
Mich, Good Vibes und ein «Brättli».
![]()
Skatest du selbst auch?
Als Kind kam ich da leider zu wenig rein, das finde ich heute schon sehr schade. Aber jetzt würde ich sofort damit anfangen! Ich war schon immer mehr auf dem Schnee unterwegs und fürs Rollbrettfahren hatte ich einfach die Geduld nicht. Seit ich im Doodah arbeite, habe ich gemerkt, wie schön dieser Sport ist. Es ist nicht nur ein Hobby, man kann diesen Sport mit Freunden und Reisen verbinden, es ist ein ganz eigener Lifestyle. Mal schauen, ob ich nächsten Sommer heimlich irgendwo trainieren kann.
![]()
Wenn du nicht im Doodah stehst, gehst du gerne auf Reisen und besuchst traumhafte Inseln und Länder auf der ganzen Welt. An welchem Ort ausserhalb der Schweiz findet man die schönsten Plätze und wieso?
Wenn man gerne gut essen möchte, dann ist man in Asien nie falsch. Dazu habe ich natürlich auch eine spezielle Verbindung, da wir früher dort gelebt haben und das Essen ist wirklich ein Traum. Kürzlich war ich in Südafrika und in Nairobi und da hat es mir auch sehr gut gefallen! Die Leute dort machen es einfach aus. Und geht man einmal ein wenig aus der Stadt heraus, sieht man natürlich die Natur und die vielen schönen Tiere, das ist faszinierend. Aber es gibt so viele verschieden tolle Orte auf der Welt; es kommt immer darauf an, was man möchte.
![]()
Und wo sind die besten Orte in Basel?
Die gute alte Rio Bar gleich um die Ecke ist immer eine gute Anlaufstelle für ein Bier oder einen Pastis. Für Konzerte gehe ich am liebsten in die Kaserne. Und im Sommer findet man mich meistens am Rhein oder irgendwo am Hafen beim Portland.
![]()
Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
Für mich persönlich wünsche ich mir, dass es mir im Doodah weiterhin so gut gefällt wie bisher. Und für das Geschäft hoffe ich, dass es noch einige spannende Jahre hier in Basel geben wird und uns der Online-Markt nicht zu sehr Druck macht.
Wie wär’s mal mit...
...bitzli meh Liebi?
![]()
Vielen Dank für die interessanten Details aus deinem Leben. Auf viele weitere spannende Jahre im Doodah!
_
von Laura Schläpfer
am 19.11.2018
Fotos
© Ketty Bertossi für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Man hört sie schon von weitem mit ihren Holzbrettern auf vier Rollen und weiss auch wohin sie fahren. Die Skater sind auf dem Weg in den Skate- und Snowboardshop Doodah, welcher schon seit Jahren ein fester Bestandteil der Basler Innenstadt ist. Hier findet man nicht nur die neuesten Utensilien für seinen bevorzugten Brettsport, sondern auch ein aufgestelltes Team und einen Treffpunkt für die Skater der Umgebung. Vom Lehrling zum Shop-Manager, vom Tellerwäscher zum Millionär? Andreas Wider erzählt von seiner Laufbahn im Doodah und wie die Skate-Szene zur Familie wurde.

Hey, wer bist Du und was machst Du?
Ich heisse Andreas Wider, wohne hier in Basel und arbeite im Skate- und Snowboardshop Doodah. Ich bin in Asien aufgewachsen, geboren bin ich in Taiwan, meine Eltern sind jedoch Schweizer. Meine Familie hat dann einige Jahre in Bangkok und in Hongkong gelebt, bevor wir in die Schweiz kamen. Hier besuchte ich ein Internat in der Nähe von Frauenfeld, wo wir zur Belohnung für gutes Benehmen manchmal am Abend im Block 47 skaten gehen durften. Da hatte ich meinen ersten Kontakt mit der Skateboard-Szene. Einmal bekam ich sogar Rodney Mullens Unterschrift auf meine Jeans, darauf war ich ziemlich stolz. Und schliesslich bin ich nach Basel umgezogen. Wir waren schon früher oft während den Ferien in der Schweiz, daher kommt auch meine Liebe zum Schneesport und zu den «Brättli».

Und wie bist du zum Doodah Basel gekommen?
Meinen ersten Kontakt zum Doodah hatte ich in St. Gallen, wo wir manchmal einkaufen gingen. Als ich dann nach Basel kam und nach der Schule auf die Suche nach einer Lehrstelle ging, sah ich, dass es den Shop neu auch in Basel gab. Durch meine Leidenschaft für Snowboards und Skateboards war für mich klar, dass ich da arbeiten wollte. Ich war dann der erste Lehrling im Doodah Basel, kurz nachdem der Shop hier eröffnet wurde.


Was liebst du an deinem Beruf und was magst du eher weniger?
Das Beste hier sind auf jeden Fall die Leute. Ob das nun das Team ist oder die vielen spannenden Menschen, die man hier kennenlernt, das Skaten und Snowboarden verbindet einfach so viele verschiedene Leute. Das ist schon sehr schön. Zudem kann man sein Hobby in den Beruf integrieren und voll und ganz hinter den Produkten stehen, die man verkauft. Was mir an meinem Alltag weniger gut gefällt sind die Tage, an denen wenig los ist. Da muss man halt trotzdem präsent sein und kann nicht einfach nach Hause gehen. Zudem muss man eigentlich immer gut drauf sein, hat man mal einen schlechten Tag, darf man das nicht zeigen. Das ist nicht immer einfach.

Du bist ja schon lange dabei, gleich nach der Schule hast du hier deine Lehre absolviert, warst dann Mitarbeiter und nun Shop Manager. Was hat sich über die Jahre so verändert?
Jetzt abgesehen davon, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe, hat sich auch sonst einiges geändert. Früher haben die Kunden einem die Kleider aus den Kisten heraus gekauft und heute ist natürlich eine stärkere Gewichtung auf dem Online-Markt zu spüren. Die Dienstleistung, die Präsentation der Ware und das gesamte Einkaufserlebnis im Shop sind dadurch viel wichtiger geworden. Aber auch ein anderer Umgang mit Kleidern und der Ware ist mir aufgefallen. Da hat die Wertschätzung zum Teil abgenommen.

Welche Musik läuft im Doodah von morgens bis abends?
Früher sind wir immer zu Musik Hug gegangen, mit denen hatten wir den Deal, dass wir uns jede Woche fünf CDs aussuchen konnten. Und dann hat man halt sechs Tage lang nur das gehört. Das ist heute zum Glück einfacher geworden und jeder hat so seine Playlists, die er oder sie abspielt.

Wer ist in deinem Team und wieso ist es das beste Team von ganz Basel?
Wir sind drei Festangestellte und drei Lehrlinge. Zu meinem festen Team gehören zum Einen Nadia, sie kam damals vom Downtown zu uns und ist auch schon lange ein wichtiger Teil des Teams. Und zum Anderen ist seit einem Jahr Louis fix bei uns, er kam damals als Ersatz für Chris. Wir sind eigentlich alle offen, haben Spass am Skaten oder Snowboarden und sind so auch zu Freunden geworden, die gerne auch mal nach der Arbeit gemeinsam etwas unternehmen. Das habe ich bereits von meinen früheren Arbeitgebern gelernt, wenn das Team stimmt, macht die Arbeit einfach viel mehr Spass. Und da hatten wir bisher eigentlich immer Glück und gute Leute dabei, die auch zu einer Art Familie geworden sind.


Der Laden hat sich über die Jahre gegen ähnliche Shops durchgesetzt und ist auch stark in der lokalen Skate-Szene tätig. Welche Rolle übernehmt ihr dabei und wie stark bist du mit den Basler Skatern vernetzt?
Es ist interessant zu sehen, wie manche von den Skatern schon seit klein auf im Doodah einkaufen und plötzlich werden auch diese erwachsen. Unser Shop ist da auf jeden Fall auch ein Ort zum Verweilen, ein Treffpunkt für die Skater aus Basel und gleichzeitig finden hier Events rund ums Skaten statt. Zum Beispiel war kürzlich ein Board-Release und sonst gibt es manchmal Filmpremieren oder der Doodah dient als Ausgangspunkt für Skate-Contests. Man trifft sich hier und geht dann weiter. Meistens braucht dann einer der Skater noch eine neue Hose, ein Paar Socken der Marke Stance – das sind die Besten - oder einen Schuhbändel. Dafür sind wir immer die erste Adresse, aber auch hier sind die meisten Skater zu Freunden geworden und der Shop ist nicht nur ein Geschäft, sondern ein Ort des Zusammenseins. Weiter hat Doodah auch ein eigenes Team aus SnowboarderInnen und SkaterInnen, welches wir als Sponsoren unterstützen. Seit Jahren wird dabei der Nachwuchs gefördert und es macht Spass zu sehen, was aus ihnen geworden ist.
Was sind drei Dinge, die man im Doodah Basel immer findet?
Mich, Good Vibes und ein «Brättli».

Skatest du selbst auch?
Als Kind kam ich da leider zu wenig rein, das finde ich heute schon sehr schade. Aber jetzt würde ich sofort damit anfangen! Ich war schon immer mehr auf dem Schnee unterwegs und fürs Rollbrettfahren hatte ich einfach die Geduld nicht. Seit ich im Doodah arbeite, habe ich gemerkt, wie schön dieser Sport ist. Es ist nicht nur ein Hobby, man kann diesen Sport mit Freunden und Reisen verbinden, es ist ein ganz eigener Lifestyle. Mal schauen, ob ich nächsten Sommer heimlich irgendwo trainieren kann.

Wenn du nicht im Doodah stehst, gehst du gerne auf Reisen und besuchst traumhafte Inseln und Länder auf der ganzen Welt. An welchem Ort ausserhalb der Schweiz findet man die schönsten Plätze und wieso?
Wenn man gerne gut essen möchte, dann ist man in Asien nie falsch. Dazu habe ich natürlich auch eine spezielle Verbindung, da wir früher dort gelebt haben und das Essen ist wirklich ein Traum. Kürzlich war ich in Südafrika und in Nairobi und da hat es mir auch sehr gut gefallen! Die Leute dort machen es einfach aus. Und geht man einmal ein wenig aus der Stadt heraus, sieht man natürlich die Natur und die vielen schönen Tiere, das ist faszinierend. Aber es gibt so viele verschieden tolle Orte auf der Welt; es kommt immer darauf an, was man möchte.

Und wo sind die besten Orte in Basel?
Die gute alte Rio Bar gleich um die Ecke ist immer eine gute Anlaufstelle für ein Bier oder einen Pastis. Für Konzerte gehe ich am liebsten in die Kaserne. Und im Sommer findet man mich meistens am Rhein oder irgendwo am Hafen beim Portland.

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
Für mich persönlich wünsche ich mir, dass es mir im Doodah weiterhin so gut gefällt wie bisher. Und für das Geschäft hoffe ich, dass es noch einige spannende Jahre hier in Basel geben wird und uns der Online-Markt nicht zu sehr Druck macht.
Wie wär’s mal mit...
...bitzli meh Liebi?

Vielen Dank für die interessanten Details aus deinem Leben. Auf viele weitere spannende Jahre im Doodah!
_
von Laura Schläpfer
am 19.11.2018
Fotos
© Ketty Bertossi für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
NCCFN: Im Gespräch mit Modedesignerin Nina Jaun
Sind wir heute nicht alle ein bisschen global und unglobal zugleich? Wir sprachen mit Modedesignerin Nina Jaun über Konsum, NCCFN, Produktion, Material und Umgebung und darüber, wie Menschen aufeinander zugehen, um miteinander Dinge zu erleben.
![]()
Liebe Nina, wer seid ihr und was macht ihr?
Wir sind Menschen, die trotz der Erziehungsversuche des Staates, zu sich finden: Zeit finden, Energie finden, Prioritäten setzen, um auszuprobieren, zu erfinden und weiterzugehen. Wir sind Menschen, die mit dem Herz kapieren, wovon es mehr braucht und wovon wir mehr als genug haben. Menschen, die aufeinander zugehen, um miteinander die Dinge zu leben, die der Mensch alleine nicht erleben kann. Wir kommunizieren über unsere Skills und diese sind so unterschiedlich, wie die Leute, die sie beherrschen. Wie und wer wir sind, spiegelt sich in unserer Arbeit wieder. Global arbeiten, mit dem was uns umgibt. Echte Notwendigkeit oder echter Überfluss verleiten uns dazu. Es geht um Beziehungen: Die Beziehung von Menschen, die Beziehung zum Material. Oder die Beziehung vom Material zum Menschen. Wer bist du? Und was für eine Beziehung führst Du zu deiner Umgebung? Das sind die wichtige Fragen. Oder schau nach auf unserer Webseite niccefn.com oder auf Instagram @NCCFN.
Wer steckt alles hinter NCCFN?
Wir.
![]()
Wie habt ihr euch gefunden?
Manchmal zufällig, manchmal war es «Destiny». Schlussendlich sind es unsere Mütter, die sich schon vor langer Zeit gefunden haben.
Habt ihr schon vor dieser Kollektion zusammen Projekte realisiert?
Eigentlich machen wir keine «Projekte». Sondern tun und sind «Nic-ce-est». Wir lassen uns nicht aufteilen in Arbeit oder Freizeit, professionell oder Hobby, öffentlich oder privat. Wir lieben, was wir tun und wir tun dies höchst (un-)professionell.
![]()
Gerade hat eines eurer Mitglieder ihr Modedesign Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel abgeschlossen. Dort wurde auch eure Kollektion an der Graduate Show gezeigt – wie war das für euch?
Einige von uns fanden sich in einer ungewohnten Umgebung wieder. Also interessant.
![]()
Das letzte halbe Jahr habt ihr auf diesen Moment hingearbeitet. Was bleibt euch von den Monaten vor der Abschlusspräsentation in Erinnerung?
Gemeinsam produzieren, was immer es sei, schafft intensivere Beziehungen, als das gemeinsame konsumieren. «You consume more more more, we produce Amore».
![]()
Das Konzept eurer Kollektion fasst viele Themen zusammen. Könnt ihr das in einem Satz formulieren?
Nein, das können wir wirklich nicht.
Wie Beuys sagte, dass wir alle Künstler sind, sagt ihr «Wir sind alle Dealer.» – was meint ihr damit?
«Dealen» hat eine umfangreiche Bedeutung. Im deutschsprachigen Raum wird es mit dem Handeln von Drogen in Verbindung gesetzt. Im Englischen ist der Ausdruck vielfältiger anwendbar. Darauf spielen wir an. Ein Geschäft, ein Handel, ein Geben und Nehmen von Material und Produkten bis hin zu jeder Dienstleistung. Aber auch, was du selbst als Person zu bieten hast. Whats your deal? Staat und Gesellschaft legalisiert und kriminalisiert Dinge. Unser Tun. Wir relativieren dies und legitimieren uns selber. Hanf- und Baumwollblüten: Beides sind wunderbare Dinge. Dabei kommt es doch eher auf die Anwendung an. Es ist fragwürdig, wenn das eine legal ist und dabei die ganze Welt versklavt, das andere höchst kriminalisiert wird und dafür seine unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten auf der Strecke bleiben. Es geht uns dabei aber nicht um die Legalisierung von Cannabis, die wahrscheinlich auch in der Schweiz bald der Fall sein wird. Nicht wir, sondern Staatskasse, Pharma- und andere Konzerne werden davon profitieren. Dieser Vergleich zeigt lediglich die Relativität.
![]()
Legaliseren, Legitimieren, Normalisieren. Nur weil der Staat diese Pflanzen als Produkte betitelt, sie auf dem Markt zulässt und legalisiert, heisst das nicht, dass der Handel damit und die Produktion einfach legitimiert werden. Wer auf das Urteil von einem «Staat» hören muss, was richtig oder falsch sein soll, wird halt Alkoholiker. Kannst du als Person illegal sein? Kann eine Pflanze illegal sein? Oder kann unser Umgang damit legal sein? Es liegt in eurer Hand: was würdet ihr legalisieren und was sollte illegal sein? «Legitimize yourself». Wir alle haben die Fähigkeit und die Freiheit selbst zu entscheiden. Wissen kannst du dir aneignen und Intuition trägst du in dir. Eigentlich ist jeder fähig zu erkennen, was gut für die Welt ist. Nimm dir etwas me-time, nimm dir etwas we-time. Nimm dir etwas she-time und etwas he-time und dann gibt es auch noch they-time.
![]()
Ist NCCFN ein soziales Projekt?
NCCFN ist kein Projekt. Und nein, was bedeutet denn «sozial»? Asozial würde bedeuten, nicht in einer Gesellschaft/Gemeinschaft lebend zu sein/leben zu wollen? Was unter asozialem Verhalten verstanden wird, gehört zum «Leben miteinander» genauso dazu. Deshalb sind wir wohl lieber asozial, als uns mit dem Wort «sozial» schmücken zu wollen. Oder vielleicht bezeichnen wir uns ab jetzt als NGO, die Mode macht. Bezeichnungen wie «sozial» oder «nachhaltig» haben schon längst ihre Bedeutung verloren. Diese Wörter werden zu oft missbraucht. Somit fällt es uns schwer diese Sprache zu sprechen. Damit wir nicht missverstanden werden, kommunizieren wir eben auf andere Weise. Mit dem, was wir tun. Ziemlich unmodern, dass reden immer noch Macht bedeutet. Für uns ist machen Macht.
![]()
Ihr habt Restposten von Kleiderproduzenten als Basis für eure Kollektion verwendet. Wie hat das euren Designprozess beeinflusst?
Wir nennen die Marken nicht, die uns ihre Produkte-Materialien oder ihren Abfall «gesponsert» haben. Dies ist ziemlich langweilig und irrelevant. Unseren Designprozess machen wir abhängig von unserer Umgebung. Nicht umgekehrt, wie es oft gelehrt wird. Denn alles Bestehende bietet Fläche, als Rohmaterial genutzt zu werden. Wir eignen uns an, was uns gefällt und was uns nicht gefällt, machen wir zu dem, was uns gefällt. Der ganze Designprozess fließt umgekehrt: stop and flow. Ist ziemlich bis sehr interessant und auch relevant. Und interessant und relevant ist, was es jetzt ist.
![]()
Unverkauftes und Liegengebliebenes als Grundmaterial zu verwenden ist ja eigentlich ein klares Statement gegen Fast Fashion. Was sollte sich eurer Meinung nach in der Modebranche ändern?
Mode – Branche. Dass Mode nicht als Branche betrachtet wird, das sollte sich ändern. Wenn wir Mode machen, machen wir es weil wir frei sind. Frei in unseren, selbst für uns gezogenen Grenzen und frei diese zu durchdringen, wie Luft. Es geht eben nicht um die Modebranche. Es geht um uns Menschen auf dieser Welt. Ob Produzent oder Konsument, heute sind wir ja alle ein bitzeli beides oder? Es geht darum, dass wir Material aus aller Welt konsumieren und produzieren und darum, dass wir Menschen aus all dieser Welt, uns die Freiheit nicht gewähren so «global» wie unser Material zu sein. Selbstzerstörender Kreislauf. Wir sind jetzt ultra-extrem und radikal unglobal. Produkte sind global. Was aktuell passiert, genau hier und jetzt ist höchstkriminell und du bist nicht nur ein bitzeli, sondern sehr viel krimineller als du wohl weisst. Du bist kriminell, wenn du bei H&M einkaufst. Du bist auch kriminell, wenn du einmal in der Schule über die unmenschliche Geschichte des 2. Weltkrieges gelernt hast und heute Blick am Abend liest. Du bist kriminell, wenn du es zulässt, dass Gefängnisse neben dir gebaut werden für Menschen, die notwendigerweise global sind. Und du bist kriminell, wenn du unnotwendigerweise global bist.
![]()
Wie geht's weiter – was habt ihr noch für Pläne?
Pläne zu planen und an das Universum zu glauben, daraus entsteht dann Utopia.
Wo kriegt man eure Pullover und Dessous?
Momentan direkt von uns – über uns. Oder vielleicht irgendwo auf der Strasse.
Was sind eure Tipps für zukünftige Modedesign StudentInnen?
No tips. No generalized tips. Arbeite mit deiner Umgebung, das ist auch der Shit in New York jetzt.
![]()
Basel oder Bern?
Wir arbeiten, wo wir sind. Und wir sind, wo wir arbeiten.
Wie wär's mal mit...
...Constructive deconstructivism & collective individualism: east or west nccfn is best. Und wie wärs mal mit Fragen, die heute relevant sind.
![]()
Vielen Dank an Nina, die uns spannende Einblicke in ihr Atelier, ihr Schaffen und NCCFN gab.
_
von Una Lupo
am 12.11.2018
Fotos
© Una Lupo für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Sind wir heute nicht alle ein bisschen global und unglobal zugleich? Wir sprachen mit Modedesignerin Nina Jaun über Konsum, NCCFN, Produktion, Material und Umgebung und darüber, wie Menschen aufeinander zugehen, um miteinander Dinge zu erleben.
Liebe Nina, wer seid ihr und was macht ihr?
Wir sind Menschen, die trotz der Erziehungsversuche des Staates, zu sich finden: Zeit finden, Energie finden, Prioritäten setzen, um auszuprobieren, zu erfinden und weiterzugehen. Wir sind Menschen, die mit dem Herz kapieren, wovon es mehr braucht und wovon wir mehr als genug haben. Menschen, die aufeinander zugehen, um miteinander die Dinge zu leben, die der Mensch alleine nicht erleben kann. Wir kommunizieren über unsere Skills und diese sind so unterschiedlich, wie die Leute, die sie beherrschen. Wie und wer wir sind, spiegelt sich in unserer Arbeit wieder. Global arbeiten, mit dem was uns umgibt. Echte Notwendigkeit oder echter Überfluss verleiten uns dazu. Es geht um Beziehungen: Die Beziehung von Menschen, die Beziehung zum Material. Oder die Beziehung vom Material zum Menschen. Wer bist du? Und was für eine Beziehung führst Du zu deiner Umgebung? Das sind die wichtige Fragen. Oder schau nach auf unserer Webseite niccefn.com oder auf Instagram @NCCFN.
Wer steckt alles hinter NCCFN?
Wir.
Wie habt ihr euch gefunden?
Manchmal zufällig, manchmal war es «Destiny». Schlussendlich sind es unsere Mütter, die sich schon vor langer Zeit gefunden haben.
Habt ihr schon vor dieser Kollektion zusammen Projekte realisiert?
Eigentlich machen wir keine «Projekte». Sondern tun und sind «Nic-ce-est». Wir lassen uns nicht aufteilen in Arbeit oder Freizeit, professionell oder Hobby, öffentlich oder privat. Wir lieben, was wir tun und wir tun dies höchst (un-)professionell.
Gerade hat eines eurer Mitglieder ihr Modedesign Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel abgeschlossen. Dort wurde auch eure Kollektion an der Graduate Show gezeigt – wie war das für euch?
Einige von uns fanden sich in einer ungewohnten Umgebung wieder. Also interessant.
Das letzte halbe Jahr habt ihr auf diesen Moment hingearbeitet. Was bleibt euch von den Monaten vor der Abschlusspräsentation in Erinnerung?
Gemeinsam produzieren, was immer es sei, schafft intensivere Beziehungen, als das gemeinsame konsumieren. «You consume more more more, we produce Amore».
Das Konzept eurer Kollektion fasst viele Themen zusammen. Könnt ihr das in einem Satz formulieren?
Nein, das können wir wirklich nicht.
Wie Beuys sagte, dass wir alle Künstler sind, sagt ihr «Wir sind alle Dealer.» – was meint ihr damit?
«Dealen» hat eine umfangreiche Bedeutung. Im deutschsprachigen Raum wird es mit dem Handeln von Drogen in Verbindung gesetzt. Im Englischen ist der Ausdruck vielfältiger anwendbar. Darauf spielen wir an. Ein Geschäft, ein Handel, ein Geben und Nehmen von Material und Produkten bis hin zu jeder Dienstleistung. Aber auch, was du selbst als Person zu bieten hast. Whats your deal? Staat und Gesellschaft legalisiert und kriminalisiert Dinge. Unser Tun. Wir relativieren dies und legitimieren uns selber. Hanf- und Baumwollblüten: Beides sind wunderbare Dinge. Dabei kommt es doch eher auf die Anwendung an. Es ist fragwürdig, wenn das eine legal ist und dabei die ganze Welt versklavt, das andere höchst kriminalisiert wird und dafür seine unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten auf der Strecke bleiben. Es geht uns dabei aber nicht um die Legalisierung von Cannabis, die wahrscheinlich auch in der Schweiz bald der Fall sein wird. Nicht wir, sondern Staatskasse, Pharma- und andere Konzerne werden davon profitieren. Dieser Vergleich zeigt lediglich die Relativität.
Legaliseren, Legitimieren, Normalisieren. Nur weil der Staat diese Pflanzen als Produkte betitelt, sie auf dem Markt zulässt und legalisiert, heisst das nicht, dass der Handel damit und die Produktion einfach legitimiert werden. Wer auf das Urteil von einem «Staat» hören muss, was richtig oder falsch sein soll, wird halt Alkoholiker. Kannst du als Person illegal sein? Kann eine Pflanze illegal sein? Oder kann unser Umgang damit legal sein? Es liegt in eurer Hand: was würdet ihr legalisieren und was sollte illegal sein? «Legitimize yourself». Wir alle haben die Fähigkeit und die Freiheit selbst zu entscheiden. Wissen kannst du dir aneignen und Intuition trägst du in dir. Eigentlich ist jeder fähig zu erkennen, was gut für die Welt ist. Nimm dir etwas me-time, nimm dir etwas we-time. Nimm dir etwas she-time und etwas he-time und dann gibt es auch noch they-time.
Ist NCCFN ein soziales Projekt?
NCCFN ist kein Projekt. Und nein, was bedeutet denn «sozial»? Asozial würde bedeuten, nicht in einer Gesellschaft/Gemeinschaft lebend zu sein/leben zu wollen? Was unter asozialem Verhalten verstanden wird, gehört zum «Leben miteinander» genauso dazu. Deshalb sind wir wohl lieber asozial, als uns mit dem Wort «sozial» schmücken zu wollen. Oder vielleicht bezeichnen wir uns ab jetzt als NGO, die Mode macht. Bezeichnungen wie «sozial» oder «nachhaltig» haben schon längst ihre Bedeutung verloren. Diese Wörter werden zu oft missbraucht. Somit fällt es uns schwer diese Sprache zu sprechen. Damit wir nicht missverstanden werden, kommunizieren wir eben auf andere Weise. Mit dem, was wir tun. Ziemlich unmodern, dass reden immer noch Macht bedeutet. Für uns ist machen Macht.
Ihr habt Restposten von Kleiderproduzenten als Basis für eure Kollektion verwendet. Wie hat das euren Designprozess beeinflusst?
Wir nennen die Marken nicht, die uns ihre Produkte-Materialien oder ihren Abfall «gesponsert» haben. Dies ist ziemlich langweilig und irrelevant. Unseren Designprozess machen wir abhängig von unserer Umgebung. Nicht umgekehrt, wie es oft gelehrt wird. Denn alles Bestehende bietet Fläche, als Rohmaterial genutzt zu werden. Wir eignen uns an, was uns gefällt und was uns nicht gefällt, machen wir zu dem, was uns gefällt. Der ganze Designprozess fließt umgekehrt: stop and flow. Ist ziemlich bis sehr interessant und auch relevant. Und interessant und relevant ist, was es jetzt ist.
Unverkauftes und Liegengebliebenes als Grundmaterial zu verwenden ist ja eigentlich ein klares Statement gegen Fast Fashion. Was sollte sich eurer Meinung nach in der Modebranche ändern?
Mode – Branche. Dass Mode nicht als Branche betrachtet wird, das sollte sich ändern. Wenn wir Mode machen, machen wir es weil wir frei sind. Frei in unseren, selbst für uns gezogenen Grenzen und frei diese zu durchdringen, wie Luft. Es geht eben nicht um die Modebranche. Es geht um uns Menschen auf dieser Welt. Ob Produzent oder Konsument, heute sind wir ja alle ein bitzeli beides oder? Es geht darum, dass wir Material aus aller Welt konsumieren und produzieren und darum, dass wir Menschen aus all dieser Welt, uns die Freiheit nicht gewähren so «global» wie unser Material zu sein. Selbstzerstörender Kreislauf. Wir sind jetzt ultra-extrem und radikal unglobal. Produkte sind global. Was aktuell passiert, genau hier und jetzt ist höchstkriminell und du bist nicht nur ein bitzeli, sondern sehr viel krimineller als du wohl weisst. Du bist kriminell, wenn du bei H&M einkaufst. Du bist auch kriminell, wenn du einmal in der Schule über die unmenschliche Geschichte des 2. Weltkrieges gelernt hast und heute Blick am Abend liest. Du bist kriminell, wenn du es zulässt, dass Gefängnisse neben dir gebaut werden für Menschen, die notwendigerweise global sind. Und du bist kriminell, wenn du unnotwendigerweise global bist.
Wie geht's weiter – was habt ihr noch für Pläne?
Pläne zu planen und an das Universum zu glauben, daraus entsteht dann Utopia.
Wo kriegt man eure Pullover und Dessous?
Momentan direkt von uns – über uns. Oder vielleicht irgendwo auf der Strasse.
Was sind eure Tipps für zukünftige Modedesign StudentInnen?
No tips. No generalized tips. Arbeite mit deiner Umgebung, das ist auch der Shit in New York jetzt.
Basel oder Bern?
Wir arbeiten, wo wir sind. Und wir sind, wo wir arbeiten.
Wie wär's mal mit...
...Constructive deconstructivism & collective individualism: east or west nccfn is best. Und wie wärs mal mit Fragen, die heute relevant sind.
Vielen Dank an Nina, die uns spannende Einblicke in ihr Atelier, ihr Schaffen und NCCFN gab.
_
von Una Lupo
am 12.11.2018
Fotos
© Una Lupo für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Wiener Prater Geisterbahn: Im Gespräch mit Inhaber Pascal Steiner
Schausteller nennt man eine vielgestaltige Berufsgruppe von Personen, die Jahrmarkts- und Varieté-Attraktionen darbieten. Jedes Jahr an der Basler Herbstmesse kommen wir in den Genuss ihrer Darbietungen. Doch was sind dies eigentlich für Menschen, die jedes Jahr unter allen Wetterbedignungen bei ihren Attraktionen stehen? Wir trafen Pascal Steiner, den Inhaber der Wiener Prater Geisterbahn, an der Basler Herbstmesse zum Gespäch.
![]()
Lieber Pascal, erzähl uns kurz was zu dir.
Ich bin Pascal Steiner und wohne zurzeit in Münchenstein, Baselland. Ich bin in Basel geboren und habe schon immer hier in der Umgebung gewohnt, auch mal in Allschwil. Ein Jahr lang wohnte ich mit meiner Freundin in einem Wohnwagen, zum Teil in der Schweiz auf gewissen Campingplätzen sowie im Schwarzwald.
![]()
Du bist Besitzer der Wiener Prater Geisterbahn. Wie kam es dazu?
Eher Eigentümer oder Inhaber, der Besitzer ist der, der sie gearde hat, also derjenige der dann an der Kasse sitzt. Frau Romagnoli holte die Bahn 1952 aus Steiermark in Österreich nach Basel. Von 1952 bis 1992 war die Bahn an jeder Herbstmesse. Wir haben sie 92 gekauft, mein Bruder Philippe und ich. Er wollte dies unbedingt und ich habe mitgeholfen. Wir haben sie gemeinsam restauriert. Da wir keine Halle hatten, um die Bahn zu restaurieren, mussten wir dies draussen machen, was aber eher schlecht bis garnicht ging. Mein Bruder gab daraufhin auf und überschrieb mir die Bahn. Er verstarb 2007.
![]()
Ich konnte dann im 2010 beim Calypso Inhaber und Freund Paul Läuppi in Aarau in die Halle. Dort haben wir die Geisterbahn mit seinem Team und mit weiteren Leuten restauriert. Paul Läuppi hat mir auch geholfen Plätze zu finden, um die Bahn wieder in Betrieb nehmen zu können. Zunächst waren wir 2012 in Baden, draussen. Ab 2013 konnten wir wieder hier in die 80s Messehalle in Basel – 80s Halle heisst sie, da hier seit den 80ern Attraktionen drinnen sind, einige Ältere sowie Neuere. Mir gefällt’s hier in der Halle und die Bahn ist vor Wettereinflüssen geschützt.
![]()
Wie gross ist das Team zurzeit?
Beim Auf- und Abbau sind es ungefähr 8 Leute. Im Betrieb vor Ort zwischen 3–4, die die Kasse machen und die Wägeli anstossen. Es sind auch auch Freunde darunter, die ich schon lange kenne und die auch bei anderen Bahnen mithelfen.
![]()
Und du selber bist auch vor Ort?
Seit diesem Jahr konnte ich alles soweit planen und organisieren, dass ich nicht immer vor Ort sein muss. Es ist fast wie früher und macht mir wieder viel mehr Freude. Der Betrieb läuft mittlerweile, ohne dass ich ständig anwesend sein muss. Jedoch bin ich nach wie vor gerne abends vor Ort.
![]()
Wie kommt man zu so einem Beruf?
Ich war schon als Kind von der Schaustellerei begeistert. Das habe ich von meinem Bruder. Er half damals schon als 17-jähriger Junge in den 70ern bei einer Geisterbahn mit. Als Inhaberin Frau Romagnoli im 1983 verstarb, übernahm zunächst ihr Lebenspartner die Bahn. Er wollte die Bahn später jedoch altersbedingt verkaufen, woraufhin wir sie dann 1992 übernahmen.
![]()
![]()
Was hast du davor gemacht?
Ich habe eine Banklehre abgeschlossen und mich dann im Betrieb zum Programmierer umgeschult. So Organisatorisches passt dann schon auch ganz gut.
![]()
Wiener Prater Geisterbahn – weshalb der Name?
Die Bahn heisst seit immer schon so. Es ist möglich, dass sie in Wien stand, aber man weiss es nicht sicher.
![]()
Deine Lieblingserinnerung in all der Zeit als Geisterbahnbetreiber?
Die Herbstmesse war immer mein Höhepunkt im Jahr. Als ich dann aber mit der Bahn eher Stress hatte, war die Freude auch nicht mehr so gross. Ich war beinahe immer da. Mittlerweile ist es entspannter, fast so wie früher, da ich nicht stets vor Ort sein muss. Ich mag die Atmosphäre auf dem Chilbiplatz.
Wie definierst du Geister?
Für mich sind sie in der Wirklichkeit vorhanden. Sie sind immer hier.
![]()
Was löst bei den Besuchern Angst aus?
Ich denke vor allem die Dunkelheit. Viele neuere Bahnen sind zu hell. Die Wiener Prater Geisterbahn ist sehr dunkel, man weiss nicht vorher, was kommt. Manche Kinder setzen sich in den Wagen, bekommen Angst und steigen sofort wieder aus. Sie bekommen dann ihre Chips zurück. Man sollte niemanden auf die Bahn zwingen, der Angst hat. Die meisten Besucher kommen aber freudig wieder aus der Bahn.
![]()
Und wovor hast du Angst?
Dunkelheit. Mittlerweile nicht mehr so sehr, ich konnte viele Ängste in meinem Leben abbauen. Ich hatte als Kind auch Angst vor der Bahn, da sie so dunkel ist.
![]()
Welche Gestalten im Inneren der Bahn sind deine Lieblingsfiguren?
Ich mag diejenige Figur die auf der Schiene liegt. Sie erweckt den Eindruck, als würde man sie überfahren. Es ist ein von Hand geschnitzter uralter Frauenkopf. Es hat noch weitere sehr alte Figuren. Eine weitere ist gerade bei der ersten Kurve, es ist ein alter geschnitzter Kopf. Er trägt heute eine Maske und stellt einen Geist dar. Darunter ist aber ein Ureinwohner, da die Bahn früher als Djungelbahn lief. Es hat auch auf der Fassade noch Gestalten aus dem Djungel, wie beispielsweise die Schlange.
![]()
Was ist das besondere an der Geschichte der Bahn?
Wir wollten die Fassade originalgetreu beibehalten und haben sie lediglich restauriert. Die Figuren darauf, sind immernoch dieselben, eben auch Djungelfiguren von ganz früher. Wir haben auch Figuren von der Fassade neu in die Bahn mit eingebaut. Außerdem läuft die Bahn auf 100m Schienen, die mit einem uralten Stromwägeli betrieben werden. Das Stromwägeli haben mein Bruder und ich ebenfalls original beibehalten und restauriert.
![]()
![]()
Es hat scheinbar einen echten Totenkopf in der Bahn?
Ja, dieser liegt in einem Sarg. Es ist ein Frauenkopft, aber mehr weiss man über den Schädel nicht. Die Mama eines Mitarbeiters arbeitete früher einmal in einer Arztpraxis, wo ein Skelett stand. Sie durfte den Kopf mitnehmen und jetzt ist er Teil der Wiener Prater Geisterbahn.
![]()
Es gäbe also noch Figuren von der Fassade, die mit der Zeit auch in der Bahn auftauchen könnten?
Ja, zum Beispiel haben wir gerade die Fassadenfigur unten beim Ausgang, im zweiten Stock auf dem Balkon als tatsächliche Figur in der Bahn mitaufgenommen. Ein Basler Künstler hat diese angefertigt. Zurzeit sind ungefähr 13 Figuren drinnen.
![]()
Und der Spiegel?
Darin sieht man die wahren Geister.
Wo in Basel bist du am liebsten, wenn du nicht gerade an der Herbstmesse bist?
Ich bin mittlerweile lieber auf dem Land als in der Stadt. Aber früher waren wir oft hier im Restaurant Zum Wurzengraber, das hat jedoch zu gemacht. Mittlerweile sind die Besitzer beim Restaurant Bläsitörli an der Klybeckstrasse, da sind wir dann hin und wieder gerne. Es ist gleich gegenüber von der Kaserne Basel, neben dem Basilisk Hotel. Es sind immernoch die gleichen Leute da wie früher, auch die Kellner sind die gleichen. Man kennt einander.
![]()
Lieblingsbahnen sonst an der Herbstmesse und weshalb?
Calypso und der Skilift, sie sind beide aus den 60er Jahren, noch aus meiner Kindheit. Swing Up aus den 70ern ist ebenfalls eine ganz tolle Bahn. Diese Bahnen waren schon immer an der Herbstmesse. Ich denke die älteste Bahn ist jedoch das Rössli Karussel auf der Rosentalanlage, diese muss so um die 100 Jahre alt sein.
Wie wär’s mal mit…
...echten Geistern?
![]()
Vielen Dank an Pascal Steiner für die spannende Geschichte zur Wiener Prater Geisterbahn und einem tollen Einblick in sein Leben voller Veränderungen.
_
von Ana Brankovic
am 05.11.2018
Fotos
© Patricia Grabowicz für Wie wär's mal mit
© Wiener Prater Geisterbahn Archiv
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit oder Wiener Prater Geisterbahn einholen.
Schausteller nennt man eine vielgestaltige Berufsgruppe von Personen, die Jahrmarkts- und Varieté-Attraktionen darbieten. Jedes Jahr an der Basler Herbstmesse kommen wir in den Genuss ihrer Darbietungen. Doch was sind dies eigentlich für Menschen, die jedes Jahr unter allen Wetterbedignungen bei ihren Attraktionen stehen? Wir trafen Pascal Steiner, den Inhaber der Wiener Prater Geisterbahn, an der Basler Herbstmesse zum Gespäch.

Lieber Pascal, erzähl uns kurz was zu dir.
Ich bin Pascal Steiner und wohne zurzeit in Münchenstein, Baselland. Ich bin in Basel geboren und habe schon immer hier in der Umgebung gewohnt, auch mal in Allschwil. Ein Jahr lang wohnte ich mit meiner Freundin in einem Wohnwagen, zum Teil in der Schweiz auf gewissen Campingplätzen sowie im Schwarzwald.

Du bist Besitzer der Wiener Prater Geisterbahn. Wie kam es dazu?
Eher Eigentümer oder Inhaber, der Besitzer ist der, der sie gearde hat, also derjenige der dann an der Kasse sitzt. Frau Romagnoli holte die Bahn 1952 aus Steiermark in Österreich nach Basel. Von 1952 bis 1992 war die Bahn an jeder Herbstmesse. Wir haben sie 92 gekauft, mein Bruder Philippe und ich. Er wollte dies unbedingt und ich habe mitgeholfen. Wir haben sie gemeinsam restauriert. Da wir keine Halle hatten, um die Bahn zu restaurieren, mussten wir dies draussen machen, was aber eher schlecht bis garnicht ging. Mein Bruder gab daraufhin auf und überschrieb mir die Bahn. Er verstarb 2007.

Ich konnte dann im 2010 beim Calypso Inhaber und Freund Paul Läuppi in Aarau in die Halle. Dort haben wir die Geisterbahn mit seinem Team und mit weiteren Leuten restauriert. Paul Läuppi hat mir auch geholfen Plätze zu finden, um die Bahn wieder in Betrieb nehmen zu können. Zunächst waren wir 2012 in Baden, draussen. Ab 2013 konnten wir wieder hier in die 80s Messehalle in Basel – 80s Halle heisst sie, da hier seit den 80ern Attraktionen drinnen sind, einige Ältere sowie Neuere. Mir gefällt’s hier in der Halle und die Bahn ist vor Wettereinflüssen geschützt.

Wie gross ist das Team zurzeit?
Beim Auf- und Abbau sind es ungefähr 8 Leute. Im Betrieb vor Ort zwischen 3–4, die die Kasse machen und die Wägeli anstossen. Es sind auch auch Freunde darunter, die ich schon lange kenne und die auch bei anderen Bahnen mithelfen.

Und du selber bist auch vor Ort?
Seit diesem Jahr konnte ich alles soweit planen und organisieren, dass ich nicht immer vor Ort sein muss. Es ist fast wie früher und macht mir wieder viel mehr Freude. Der Betrieb läuft mittlerweile, ohne dass ich ständig anwesend sein muss. Jedoch bin ich nach wie vor gerne abends vor Ort.

Wie kommt man zu so einem Beruf?
Ich war schon als Kind von der Schaustellerei begeistert. Das habe ich von meinem Bruder. Er half damals schon als 17-jähriger Junge in den 70ern bei einer Geisterbahn mit. Als Inhaberin Frau Romagnoli im 1983 verstarb, übernahm zunächst ihr Lebenspartner die Bahn. Er wollte die Bahn später jedoch altersbedingt verkaufen, woraufhin wir sie dann 1992 übernahmen.


Was hast du davor gemacht?
Ich habe eine Banklehre abgeschlossen und mich dann im Betrieb zum Programmierer umgeschult. So Organisatorisches passt dann schon auch ganz gut.

Wiener Prater Geisterbahn – weshalb der Name?
Die Bahn heisst seit immer schon so. Es ist möglich, dass sie in Wien stand, aber man weiss es nicht sicher.

Deine Lieblingserinnerung in all der Zeit als Geisterbahnbetreiber?
Die Herbstmesse war immer mein Höhepunkt im Jahr. Als ich dann aber mit der Bahn eher Stress hatte, war die Freude auch nicht mehr so gross. Ich war beinahe immer da. Mittlerweile ist es entspannter, fast so wie früher, da ich nicht stets vor Ort sein muss. Ich mag die Atmosphäre auf dem Chilbiplatz.
Wie definierst du Geister?
Für mich sind sie in der Wirklichkeit vorhanden. Sie sind immer hier.

Was löst bei den Besuchern Angst aus?
Ich denke vor allem die Dunkelheit. Viele neuere Bahnen sind zu hell. Die Wiener Prater Geisterbahn ist sehr dunkel, man weiss nicht vorher, was kommt. Manche Kinder setzen sich in den Wagen, bekommen Angst und steigen sofort wieder aus. Sie bekommen dann ihre Chips zurück. Man sollte niemanden auf die Bahn zwingen, der Angst hat. Die meisten Besucher kommen aber freudig wieder aus der Bahn.

Und wovor hast du Angst?
Dunkelheit. Mittlerweile nicht mehr so sehr, ich konnte viele Ängste in meinem Leben abbauen. Ich hatte als Kind auch Angst vor der Bahn, da sie so dunkel ist.

Welche Gestalten im Inneren der Bahn sind deine Lieblingsfiguren?
Ich mag diejenige Figur die auf der Schiene liegt. Sie erweckt den Eindruck, als würde man sie überfahren. Es ist ein von Hand geschnitzter uralter Frauenkopf. Es hat noch weitere sehr alte Figuren. Eine weitere ist gerade bei der ersten Kurve, es ist ein alter geschnitzter Kopf. Er trägt heute eine Maske und stellt einen Geist dar. Darunter ist aber ein Ureinwohner, da die Bahn früher als Djungelbahn lief. Es hat auch auf der Fassade noch Gestalten aus dem Djungel, wie beispielsweise die Schlange.

Was ist das besondere an der Geschichte der Bahn?
Wir wollten die Fassade originalgetreu beibehalten und haben sie lediglich restauriert. Die Figuren darauf, sind immernoch dieselben, eben auch Djungelfiguren von ganz früher. Wir haben auch Figuren von der Fassade neu in die Bahn mit eingebaut. Außerdem läuft die Bahn auf 100m Schienen, die mit einem uralten Stromwägeli betrieben werden. Das Stromwägeli haben mein Bruder und ich ebenfalls original beibehalten und restauriert.


Es hat scheinbar einen echten Totenkopf in der Bahn?
Ja, dieser liegt in einem Sarg. Es ist ein Frauenkopft, aber mehr weiss man über den Schädel nicht. Die Mama eines Mitarbeiters arbeitete früher einmal in einer Arztpraxis, wo ein Skelett stand. Sie durfte den Kopf mitnehmen und jetzt ist er Teil der Wiener Prater Geisterbahn.

Es gäbe also noch Figuren von der Fassade, die mit der Zeit auch in der Bahn auftauchen könnten?
Ja, zum Beispiel haben wir gerade die Fassadenfigur unten beim Ausgang, im zweiten Stock auf dem Balkon als tatsächliche Figur in der Bahn mitaufgenommen. Ein Basler Künstler hat diese angefertigt. Zurzeit sind ungefähr 13 Figuren drinnen.

Und der Spiegel?
Darin sieht man die wahren Geister.
Wo in Basel bist du am liebsten, wenn du nicht gerade an der Herbstmesse bist?
Ich bin mittlerweile lieber auf dem Land als in der Stadt. Aber früher waren wir oft hier im Restaurant Zum Wurzengraber, das hat jedoch zu gemacht. Mittlerweile sind die Besitzer beim Restaurant Bläsitörli an der Klybeckstrasse, da sind wir dann hin und wieder gerne. Es ist gleich gegenüber von der Kaserne Basel, neben dem Basilisk Hotel. Es sind immernoch die gleichen Leute da wie früher, auch die Kellner sind die gleichen. Man kennt einander.
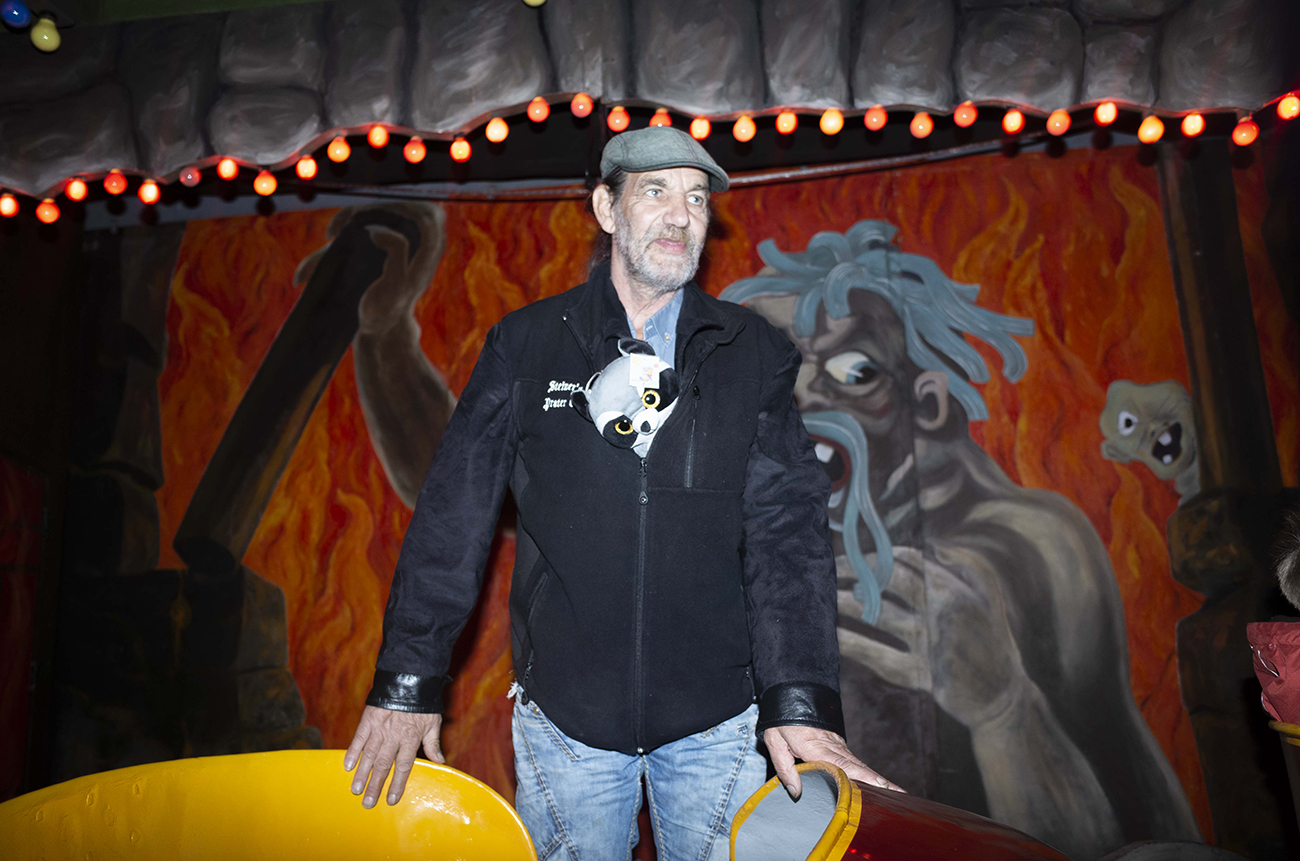
Lieblingsbahnen sonst an der Herbstmesse und weshalb?
Calypso und der Skilift, sie sind beide aus den 60er Jahren, noch aus meiner Kindheit. Swing Up aus den 70ern ist ebenfalls eine ganz tolle Bahn. Diese Bahnen waren schon immer an der Herbstmesse. Ich denke die älteste Bahn ist jedoch das Rössli Karussel auf der Rosentalanlage, diese muss so um die 100 Jahre alt sein.
Wie wär’s mal mit…
...echten Geistern?

Vielen Dank an Pascal Steiner für die spannende Geschichte zur Wiener Prater Geisterbahn und einem tollen Einblick in sein Leben voller Veränderungen.
_
von Ana Brankovic
am 05.11.2018
Fotos
© Patricia Grabowicz für Wie wär's mal mit
© Wiener Prater Geisterbahn Archiv
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit oder Wiener Prater Geisterbahn einholen.
Mavi Phoenix: Im Gespräch mit der Sängerin
Die 23 Jährige Marlene Nader aka Mavi Phoenix kommt aus Linz, Österreich und macht mit einer Do-it-yourself Haltung wunderbare Musik. Selber produziert mit einem kleinem Team, unverfälscht und ehrlich. Dieses Jahr tourt sie auch in der Schweiz, unter anderem macht sie Halt in Zürich, St. Gallen und in der Kaserne Basel. Weshalb ihre Musik als Tier eine Giraffe wäre, erfahrt ihr im Folgenden.
![]()
Liebe Mavi, du kommst aus Linz, Österreich und bist mit deinen 23 Jahren bereits fleissig mit dabei im Musikbusiness. Weshalb der Künstlername Mavi Phoenix?
Es gab mal einen Schauspieler River Phoenix, der Bruder von Joaquin Phoenix. Ich hab damals was gelesen über die Familie. Die Eltern haben den Familiennamen umbenannt in Phoenix, da sie einen Neustart im Leben machten. Ich war da an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich einen neuen Namen brauchte, da passte ein Neustart gut. Aber Phoenix auch, weil es sehr majestätisch und gross klingt, so heroisch.
Was hat dich an der Familiengeschichte von River Phoenix inspiriert?
Es gibt ein berühmtes Interview mit River Phoenix auf Youtube, das kann ich echt empfehlen. Da merkt man, dass der Typ echt special ist, sehr nachdenklich und schlau. Er starb sehr früh an Drogen. Das war irgendwie echt heftig.
![]()
Worum geht’s in deiner Musik?
Lyrisch ist es immer sehr unterschiedlich, über was ich so rede. Ein Thema, das man auf jeden Fall festhalten kann und das sich sehr oft durchzieht ist, dass ich einzelkämpferisch versuche nach oben zu gelangen. Jetzt will ich’s schaffen, will ganz nach oben. Das ist in meinem Leben gerade momentan sehr präsent.
Und wie läuft das zurzeit so?
Gut (lacht).
![]()
Wie bereitest du dich auf Auftritte vor?
Eigentlich habe ich kein Ritual oderso. Ich versuche vor Auftritten möglichst viel Ruhe zu bekommen, zum Beispiel im Hotel. Also eher chillen. Gar nicht turn up.
Bist du vor Auftritten nervös?
Mittlerweile nicht mehr so. Höchstens so 5 Minuten davor (lacht).
![]()
Was ist das absurdeste Ereignis in deiner Karriere?
Es gibt schon komische Dinge, die passieren. Einmal hat ein schon älterer Typ ein Mavi Phoenix Shirt angehabt und das dann vor mir ausgezogen, damit ich es unterschreibe. Er hat’s mir so hingehalten und da stand der 40 Jährige so mit nacktem Oberkörper da. Ich will ihm ja nichts unterstellen, aber das war irgendwie strange. Es passieren viele komische Dinge, Leute werden irgendwie immer komischer (lacht).
Deine Assoziationen zur Schweiz?
Schokolade! Sobald aus man aus dem Swiss Flugzeug steigt, ist da überall Schokolade. Ich liebe Toblerone, das meine Lieblingsschokolade. Die Landschaft hier ist ähnlich wie in Österreich. Leider kenne ich nicht so viele Schweizer Acts.
![]()
Ein paar Worte zu Basel?
Ich war noch nie in Basel, eher Zürich. Aber ich hatte nie Zeit die Stadt wirklich zu erkunden. In Basel habe ich im Dezember einen Auftritt in der Kaserne mit dem Local Act Zøla als Support.
Was wäre deine Musik für ein Ort?
Manchmal Kalifornien am Strand, manchmal Shanghai oder Tokyo bei Nacht. Die meiste Zeit aber meine Heimatstadt Linz in Österreich.
Und deine Musik als Tier?
Ich sah letztens seit langem mal wieder eine Giraffe. Da ich auch einen eher längeren Hals habe, passt dieses Tier irgendwie ganz gut. Die Giraffe ist majestätisch, schwebt über allem, das gefällt mir.
![]()
Wie würde deine Musik schmecken, wenn man sie essen könnte?
Auf jeden Fall süss. Schokopudding oder Schokokuchen. Auch wenn’s teilweise bittersweet ist, ist’s trotzdem sweet.
Was wäre deine Musik für ein Filmgenre und wer würde die Hauptrolle spielen?
Als Genre wäre es definitiv ein Drama. Drama mit schwarzer Komödie, aber auf jeden Fall dramatisch. Die Hauptrolle hätten Timothée Chalamet aka Elio im Film Call Me By Your Name oder Harry Styles, er gefällt mir sehr gut in Dunkirk. Die beiden passen irgendwie zu der Musik.
![]()
Beschreibe dich in 3 Worten.
Echt, edgy, sensibel.
Was ist auf deiner persönlichen Playlist ganz weit oben?
«Gummo» oder «Gotti Gotti» vom New Yorker 6IX9INE.
Welcher Song bringt dich zum weinen?
U2 – «With or without you». Schön, oder?
Welchen Song würdest du covern?
«Can’t get you out of my head» von Kylie Minogue.
Zu deiner Do-it-yourself Attitude – weshalb genau so und nicht anders?
Weil ich es nicht anders kann. Die Leute denken immer, hinter mir stehe ein riesiges Team oderso. Witzigerweise habe ich klein angefangen und mir auch ein kleines Team aus Linz, Österreich aufgebaut. Wir wurden durch die Musik Freunde. Da lässt man auch niemanden sonst ran oder reinreden, damit es nicht verfälscht wird. Deswegen ist alles so echt und authentisch, weil es direkt von uns kommt. Ich habe beim produzieren all hands on deck, und deshalb klingt alles so wie es klingt, und das ist sehr wichtig.
![]()
Wie gross ist das Team hinter Mavi Phoenix?
Ich arbeite vor allem mit Produzent Alex The Flipper, manchmal auch mit anderen Produzenten. Wir holen uns teilweise auch Musiker hinzu, zum was Einspielen oder live als Band. Das Management besteht auch nur aus ungefähr 2 Leuten.
Welche Fashionshow würdest du musikalisch begleiten?
Es gibt da einige Labels, die ich geil finde. Zum Beispiel Versace, Gucci, Prada oder Balenciaga. Die richtig teuren. Sie sind luxuriös und man merkt, dass da Geld dahinter steckt undso. Da kriegst du eben auch Geld, wenn du was für die machst (lacht).
Beschreibe deine Musik als ein Objekt?
Die Sonne. Weil sie wärmt und scheint.
Ergänze den Satz Wie wär’s mal mit…
...Gemütlichkeit?
![]()
Vielen Dank an Mavi Phoenix für das entspannte Interview und die wunderbare Musik, die man lieben oder hassen kann, hauptsache sie existiert.
_
von Ana Brankovic
am 29.10.2018
Fotos
© Mavi Phoenix Pressebilder und Instagram
Die 23 Jährige Marlene Nader aka Mavi Phoenix kommt aus Linz, Österreich und macht mit einer Do-it-yourself Haltung wunderbare Musik. Selber produziert mit einem kleinem Team, unverfälscht und ehrlich. Dieses Jahr tourt sie auch in der Schweiz, unter anderem macht sie Halt in Zürich, St. Gallen und in der Kaserne Basel. Weshalb ihre Musik als Tier eine Giraffe wäre, erfahrt ihr im Folgenden.

Liebe Mavi, du kommst aus Linz, Österreich und bist mit deinen 23 Jahren bereits fleissig mit dabei im Musikbusiness. Weshalb der Künstlername Mavi Phoenix?
Es gab mal einen Schauspieler River Phoenix, der Bruder von Joaquin Phoenix. Ich hab damals was gelesen über die Familie. Die Eltern haben den Familiennamen umbenannt in Phoenix, da sie einen Neustart im Leben machten. Ich war da an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich einen neuen Namen brauchte, da passte ein Neustart gut. Aber Phoenix auch, weil es sehr majestätisch und gross klingt, so heroisch.
Was hat dich an der Familiengeschichte von River Phoenix inspiriert?
Es gibt ein berühmtes Interview mit River Phoenix auf Youtube, das kann ich echt empfehlen. Da merkt man, dass der Typ echt special ist, sehr nachdenklich und schlau. Er starb sehr früh an Drogen. Das war irgendwie echt heftig.

Worum geht’s in deiner Musik?
Lyrisch ist es immer sehr unterschiedlich, über was ich so rede. Ein Thema, das man auf jeden Fall festhalten kann und das sich sehr oft durchzieht ist, dass ich einzelkämpferisch versuche nach oben zu gelangen. Jetzt will ich’s schaffen, will ganz nach oben. Das ist in meinem Leben gerade momentan sehr präsent.
Und wie läuft das zurzeit so?
Gut (lacht).

Wie bereitest du dich auf Auftritte vor?
Eigentlich habe ich kein Ritual oderso. Ich versuche vor Auftritten möglichst viel Ruhe zu bekommen, zum Beispiel im Hotel. Also eher chillen. Gar nicht turn up.
Bist du vor Auftritten nervös?
Mittlerweile nicht mehr so. Höchstens so 5 Minuten davor (lacht).

Was ist das absurdeste Ereignis in deiner Karriere?
Es gibt schon komische Dinge, die passieren. Einmal hat ein schon älterer Typ ein Mavi Phoenix Shirt angehabt und das dann vor mir ausgezogen, damit ich es unterschreibe. Er hat’s mir so hingehalten und da stand der 40 Jährige so mit nacktem Oberkörper da. Ich will ihm ja nichts unterstellen, aber das war irgendwie strange. Es passieren viele komische Dinge, Leute werden irgendwie immer komischer (lacht).
Deine Assoziationen zur Schweiz?
Schokolade! Sobald aus man aus dem Swiss Flugzeug steigt, ist da überall Schokolade. Ich liebe Toblerone, das meine Lieblingsschokolade. Die Landschaft hier ist ähnlich wie in Österreich. Leider kenne ich nicht so viele Schweizer Acts.

Ein paar Worte zu Basel?
Ich war noch nie in Basel, eher Zürich. Aber ich hatte nie Zeit die Stadt wirklich zu erkunden. In Basel habe ich im Dezember einen Auftritt in der Kaserne mit dem Local Act Zøla als Support.
Was wäre deine Musik für ein Ort?
Manchmal Kalifornien am Strand, manchmal Shanghai oder Tokyo bei Nacht. Die meiste Zeit aber meine Heimatstadt Linz in Österreich.
Und deine Musik als Tier?
Ich sah letztens seit langem mal wieder eine Giraffe. Da ich auch einen eher längeren Hals habe, passt dieses Tier irgendwie ganz gut. Die Giraffe ist majestätisch, schwebt über allem, das gefällt mir.

Wie würde deine Musik schmecken, wenn man sie essen könnte?
Auf jeden Fall süss. Schokopudding oder Schokokuchen. Auch wenn’s teilweise bittersweet ist, ist’s trotzdem sweet.
Was wäre deine Musik für ein Filmgenre und wer würde die Hauptrolle spielen?
Als Genre wäre es definitiv ein Drama. Drama mit schwarzer Komödie, aber auf jeden Fall dramatisch. Die Hauptrolle hätten Timothée Chalamet aka Elio im Film Call Me By Your Name oder Harry Styles, er gefällt mir sehr gut in Dunkirk. Die beiden passen irgendwie zu der Musik.

Beschreibe dich in 3 Worten.
Echt, edgy, sensibel.
Was ist auf deiner persönlichen Playlist ganz weit oben?
«Gummo» oder «Gotti Gotti» vom New Yorker 6IX9INE.
Welcher Song bringt dich zum weinen?
U2 – «With or without you». Schön, oder?
Welchen Song würdest du covern?
«Can’t get you out of my head» von Kylie Minogue.
Zu deiner Do-it-yourself Attitude – weshalb genau so und nicht anders?
Weil ich es nicht anders kann. Die Leute denken immer, hinter mir stehe ein riesiges Team oderso. Witzigerweise habe ich klein angefangen und mir auch ein kleines Team aus Linz, Österreich aufgebaut. Wir wurden durch die Musik Freunde. Da lässt man auch niemanden sonst ran oder reinreden, damit es nicht verfälscht wird. Deswegen ist alles so echt und authentisch, weil es direkt von uns kommt. Ich habe beim produzieren all hands on deck, und deshalb klingt alles so wie es klingt, und das ist sehr wichtig.

Wie gross ist das Team hinter Mavi Phoenix?
Ich arbeite vor allem mit Produzent Alex The Flipper, manchmal auch mit anderen Produzenten. Wir holen uns teilweise auch Musiker hinzu, zum was Einspielen oder live als Band. Das Management besteht auch nur aus ungefähr 2 Leuten.
Welche Fashionshow würdest du musikalisch begleiten?
Es gibt da einige Labels, die ich geil finde. Zum Beispiel Versace, Gucci, Prada oder Balenciaga. Die richtig teuren. Sie sind luxuriös und man merkt, dass da Geld dahinter steckt undso. Da kriegst du eben auch Geld, wenn du was für die machst (lacht).
Beschreibe deine Musik als ein Objekt?
Die Sonne. Weil sie wärmt und scheint.
Ergänze den Satz Wie wär’s mal mit…
...Gemütlichkeit?

Vielen Dank an Mavi Phoenix für das entspannte Interview und die wunderbare Musik, die man lieben oder hassen kann, hauptsache sie existiert.
_
von Ana Brankovic
am 29.10.2018
Fotos
© Mavi Phoenix Pressebilder und Instagram
Skateboardverein Rock und Roll: Im Gespräch mit Claudia und Salome
Was dem einen die Füsse und dem anderen das Fahrrad ist manchen ein Brett mit vier Rädern. Basel bietet zahlreiche Orte, wo es sich wunderbar skaten lässt – sei es in Hallen, beim Hafen oder auf der Strasse. Wir trafen Claudia und Salome, zwei Skaterinnen, die sich mit ihrem Skateboardverein Rock und Roll in Basel und schweizweit dafür einsetzen, Mädchen und Frauen zum Skateboarden zu ermutigen und sie darin zu fördern.
![]()
Liebe Claudia, liebe Salome, wer seid ihr und was macht ihr, wenn ihr nicht auf dem Brett steht?
Claudia: Ich bin Claudia, wohne in Basel und skate seit 2010. Wenn ich nicht selber auf dem Brett stehe, stehen die Kids, welche ich in der Trendsporthalle unterrichte, auf dem Skateboard. Nebst Skateboardlektionen unterrichte ich auch Sport. Dies kombiniere ich mit der Arbeit auf dem Sportamt Basel-Stadt, wo ich die Anlässe des freiwilligen Schulsports koordiniere.
Salome: Ich heisse Salome, bin 24 Jahre jung, lebe in Basel und bin schon als Mädchen immer wieder auf dem Skateboard gestanden. Ansonsten verbringe ich viel Zeit im Spital, bei meiner Arbeit als Pflegefachfrau.
![]()
Wie hat das mit Rock und Roll begonnen?
Claudia: Salome und ich haben uns in der alten Skatehalle «Pumpwerk» kennengelernt. Wir skaten oft zusammen und waren lange Zeit die einzigen aktiven Frauen in der Basler Skateszene. Wir wussten aber, dass es vereinzelte Skaterinnen in der Schweiz gibt. So hatten wir das Ziel, ein Wochenende zu veranstalten, um die Frauen zu vereinen und einander kennenzulernen. Seit 2012 veranstalten wir gemeinsam mit der Unterstützung der Trendsportleiterin Karin Bleile vom Verein Trendsport. Mittlerweile zieht das All Girls Summer Weekend viele Einsteigerinnen an. Die Stimmung ist besonders, da wir nur unter Frauen skaten, was sonst kaum vorkommt. Kein Druck, keine Hemmungen, einfach drauflos skaten mit anderen Mädels neue Tricks lernen. Es ist schön zu sehen, dass bis jetzt die Teilnehmerzahl stetig gestiegen ist. Die zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ist auch die Motivation noch mehr solche Anlässe zu organisieren. Deshalb gründeten wir vor einem Jahr mit zwei weiteren Skaterinnen, Marianna und Coco, unseren Verein Rock und Roll.
![]()
Salome: Als ich in jungen Jahren mit meinem grossen Bruder Skaten war, sah ich so gut wie nie andere Mädchen oder Frauen skaten. Mit Claudia habe ich einen richtig guten Skatebuddy gefunden. Wir pushen uns gegenseitig. Da es momentan viele Frauen gibt, die anfangen zu skaten, ist Claudia mit der Idee gekommen einen Verein zu Gründen.
![]()
Skateboarden wurde bei den Olympischen Spielen aufgenommen und in Basel finden immer wieder Filmscreenings von Skate– und Surffilmen statt. Gibt es mittlerweile einen Boom um Brettsporte? Wie seht ihr das?
Claudia: Durch die steigende Zahl an Teilnehmerinnen haben wir auch bemerkt, dass der Skateboardboom in der Schweiz angekommen ist. Mit unserem Ziel, Mädchen und Frauen zum Skateboarden zu motivieren, packen wir die Gelegenheit am Schopf und versuchen von dem Boom zu profitieren.
Salome: Es ist schön zu sehen, dass der Brettsport boomt. Jeder geht das Ganze unterschiedlich an. Für mich ist Skaten ein Lifestyle. Ich finde es wichtig, die Frauenszene zu pushen.
![]()
Seit das Pumpwerk geschlossen wurde, gibt es die Trendsporthalle als einzige Indooranlage in Basel. Reicht dies aus oder braucht es es mehr Orte zum Skaten?
Claudia: Ich glaube, wir dürfen uns in Basel nicht beklagen. Wir können froh sein, überhaupt eine Skatehalle zu haben. Ebenso sind in den letzten Jahren neue kleinere Skateparks und Spots entstanden, die das Skaten in der Stadt sehr abwechslungsreich machen. Was Basel jedoch nicht hat, ist ein grosser Skatepark, welcher einen Bowl- und einen Street-Teil beinhaltet. Ja, einen grossen Outdoorskatepark, das bräuchte die Stadt noch.
Salome: Die ganze Stadt ist ein Skatepark. Ich finde Basel gibt einige ganz tolle Plätze her zum Skaten.
![]()
Was sind eure Pläne und Wünsche für die Zukunft von Rock und Roll?
Claudia: Noch mehr Frauen zum Skaten zu bringen! Es macht riesig Freude, den Fortschritt der Frauen mitzuverfolgen und sie zu pushen. Wir möchten aber nicht nur für die Frauen, sondern für die ganze Skate Community in Basel etwas bieten und weitere Projekte, wie zum Beispiel das Winterprojekt in der Halle auf die Beine stellen.
Salome: Die Frauenszene zusammen bringen, noch mehr Leute motivieren und noch mehr Events und Trips planen – hoffentlich folgen noch viele weitere Projekte!
![]()
Wo geht ihr sonst so skaten, wenn ihr nicht in der Halle seid?
Claudia: Ich bevorzuge Rampen und Bowls, deswegen bin ich meistens im DIY Skatepark Portland anzutreffen. Mein absoluter Lieblingsspot. Im Sommer treffen wir Frauen uns meistens am Dienstagabend auf der Summerkunschti.
Salome: Da ich lieber streetskate, gehe ich gerne in die Trendsporthalle. Hin und wieder taste ich mich auch an Portland ran, was ich als persönliche Herausforderung sehe.
![]()
Wenn ihr ein Skateboard Trick wärt, welcher wäre das?
Claudia: No Comply 180 – das war mein erster Trick, den ich gelernt habe und an dem habe ich immer noch sehr viel Spass. Du nimmst den Vorderfuss vom Brett und löst mit dem Hinterfuss eine 180 Grad Drehung des Brettes und auch des Körpers aus.
Salome: Definitiv Heelflip – mit dem habe ich schon Höhen und Tiefen erlebt.
Wie wär’s mal mit...
...einem Einblick in die Skateszene?
![]()
Wir bedanken uns herzlich bei Claudia uns Salome für den spannenden Einblick in ihren Skateralltag.
_
von Una Lupo
am 22.10.2018
Fotos
© Una Lupo für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Was dem einen die Füsse und dem anderen das Fahrrad ist manchen ein Brett mit vier Rädern. Basel bietet zahlreiche Orte, wo es sich wunderbar skaten lässt – sei es in Hallen, beim Hafen oder auf der Strasse. Wir trafen Claudia und Salome, zwei Skaterinnen, die sich mit ihrem Skateboardverein Rock und Roll in Basel und schweizweit dafür einsetzen, Mädchen und Frauen zum Skateboarden zu ermutigen und sie darin zu fördern.

Liebe Claudia, liebe Salome, wer seid ihr und was macht ihr, wenn ihr nicht auf dem Brett steht?
Claudia: Ich bin Claudia, wohne in Basel und skate seit 2010. Wenn ich nicht selber auf dem Brett stehe, stehen die Kids, welche ich in der Trendsporthalle unterrichte, auf dem Skateboard. Nebst Skateboardlektionen unterrichte ich auch Sport. Dies kombiniere ich mit der Arbeit auf dem Sportamt Basel-Stadt, wo ich die Anlässe des freiwilligen Schulsports koordiniere.
Salome: Ich heisse Salome, bin 24 Jahre jung, lebe in Basel und bin schon als Mädchen immer wieder auf dem Skateboard gestanden. Ansonsten verbringe ich viel Zeit im Spital, bei meiner Arbeit als Pflegefachfrau.

Wie hat das mit Rock und Roll begonnen?
Claudia: Salome und ich haben uns in der alten Skatehalle «Pumpwerk» kennengelernt. Wir skaten oft zusammen und waren lange Zeit die einzigen aktiven Frauen in der Basler Skateszene. Wir wussten aber, dass es vereinzelte Skaterinnen in der Schweiz gibt. So hatten wir das Ziel, ein Wochenende zu veranstalten, um die Frauen zu vereinen und einander kennenzulernen. Seit 2012 veranstalten wir gemeinsam mit der Unterstützung der Trendsportleiterin Karin Bleile vom Verein Trendsport. Mittlerweile zieht das All Girls Summer Weekend viele Einsteigerinnen an. Die Stimmung ist besonders, da wir nur unter Frauen skaten, was sonst kaum vorkommt. Kein Druck, keine Hemmungen, einfach drauflos skaten mit anderen Mädels neue Tricks lernen. Es ist schön zu sehen, dass bis jetzt die Teilnehmerzahl stetig gestiegen ist. Die zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ist auch die Motivation noch mehr solche Anlässe zu organisieren. Deshalb gründeten wir vor einem Jahr mit zwei weiteren Skaterinnen, Marianna und Coco, unseren Verein Rock und Roll.

Salome: Als ich in jungen Jahren mit meinem grossen Bruder Skaten war, sah ich so gut wie nie andere Mädchen oder Frauen skaten. Mit Claudia habe ich einen richtig guten Skatebuddy gefunden. Wir pushen uns gegenseitig. Da es momentan viele Frauen gibt, die anfangen zu skaten, ist Claudia mit der Idee gekommen einen Verein zu Gründen.

Skateboarden wurde bei den Olympischen Spielen aufgenommen und in Basel finden immer wieder Filmscreenings von Skate– und Surffilmen statt. Gibt es mittlerweile einen Boom um Brettsporte? Wie seht ihr das?
Claudia: Durch die steigende Zahl an Teilnehmerinnen haben wir auch bemerkt, dass der Skateboardboom in der Schweiz angekommen ist. Mit unserem Ziel, Mädchen und Frauen zum Skateboarden zu motivieren, packen wir die Gelegenheit am Schopf und versuchen von dem Boom zu profitieren.
Salome: Es ist schön zu sehen, dass der Brettsport boomt. Jeder geht das Ganze unterschiedlich an. Für mich ist Skaten ein Lifestyle. Ich finde es wichtig, die Frauenszene zu pushen.

Seit das Pumpwerk geschlossen wurde, gibt es die Trendsporthalle als einzige Indooranlage in Basel. Reicht dies aus oder braucht es es mehr Orte zum Skaten?
Claudia: Ich glaube, wir dürfen uns in Basel nicht beklagen. Wir können froh sein, überhaupt eine Skatehalle zu haben. Ebenso sind in den letzten Jahren neue kleinere Skateparks und Spots entstanden, die das Skaten in der Stadt sehr abwechslungsreich machen. Was Basel jedoch nicht hat, ist ein grosser Skatepark, welcher einen Bowl- und einen Street-Teil beinhaltet. Ja, einen grossen Outdoorskatepark, das bräuchte die Stadt noch.
Salome: Die ganze Stadt ist ein Skatepark. Ich finde Basel gibt einige ganz tolle Plätze her zum Skaten.

Was sind eure Pläne und Wünsche für die Zukunft von Rock und Roll?
Claudia: Noch mehr Frauen zum Skaten zu bringen! Es macht riesig Freude, den Fortschritt der Frauen mitzuverfolgen und sie zu pushen. Wir möchten aber nicht nur für die Frauen, sondern für die ganze Skate Community in Basel etwas bieten und weitere Projekte, wie zum Beispiel das Winterprojekt in der Halle auf die Beine stellen.
Salome: Die Frauenszene zusammen bringen, noch mehr Leute motivieren und noch mehr Events und Trips planen – hoffentlich folgen noch viele weitere Projekte!

Wo geht ihr sonst so skaten, wenn ihr nicht in der Halle seid?
Claudia: Ich bevorzuge Rampen und Bowls, deswegen bin ich meistens im DIY Skatepark Portland anzutreffen. Mein absoluter Lieblingsspot. Im Sommer treffen wir Frauen uns meistens am Dienstagabend auf der Summerkunschti.
Salome: Da ich lieber streetskate, gehe ich gerne in die Trendsporthalle. Hin und wieder taste ich mich auch an Portland ran, was ich als persönliche Herausforderung sehe.

Wenn ihr ein Skateboard Trick wärt, welcher wäre das?
Claudia: No Comply 180 – das war mein erster Trick, den ich gelernt habe und an dem habe ich immer noch sehr viel Spass. Du nimmst den Vorderfuss vom Brett und löst mit dem Hinterfuss eine 180 Grad Drehung des Brettes und auch des Körpers aus.
Salome: Definitiv Heelflip – mit dem habe ich schon Höhen und Tiefen erlebt.
Wie wär’s mal mit...
...einem Einblick in die Skateszene?

Wir bedanken uns herzlich bei Claudia uns Salome für den spannenden Einblick in ihren Skateralltag.
_
von Una Lupo
am 22.10.2018
Fotos
© Una Lupo für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Azibo: Im Gespräch mit Marc Auer
Von Südafrika in die Schweiz. Vom Koch über Barmann zum Restaurateur. Von afrikanischen Hütten über Recycling, persönlicher Einrichtung und Design. Mit Menschen die Tea Rooms einrichten, Marokko bereisen, in Altersheimen leben oder mit Leuten die Kaugummis anmalen. Über Konsum, Kreativität, Ausbildung und Gentrifizierung. Mit Marc Auer spricht man über alles und die ganze Welt. Denn Azibo ist die ganze Welt.
![]()
Lieber Marc, wer bist du?
Ich bin in Südafrika aufgewachsen. Im Jahr 1985 bin ich in die Schweiz gekommen und habe eine Kochlehre gemacht. Als die Probleme mit der Regierung in Südafrika begannen, hat mein Vater entschieden zurück in die Schweiz zu kommen, damit ich eine gute Ausbildung machen konnte. Während meiner Lehre hatte ich kurz Deutschunterricht, aber richtig Deutsch reden und schreiben habe ich nie gelernt. Bei der Arbeit waren viele Italiener da, Saisonarbeiter, da gab es nicht viel Gelegenheit zum Üben. Danach habe ich eine Barfachschule gemacht in Luzern und anschliessend habe ich im Hotel National an der Bar gearbeitet – vollgeschniegelt. Da habe ich viel Menschenkenntnisse erlangt, an der Bar, wo die Leute trinken und die Wahrheit erzählen. Anschliessend habe ich die Hotelfachschule gemacht und bin nach dem Abschluss in die Ostschweiz gegangen, um in einer Molkerei zu arbeiten. Die hatten eine Cateringabteilung. Das war ein sehr anstrengender Job, man schleppt das ganze Restaurant ständig mit. Dort hat man auch viel Abfall gehabt. Während dieser ganzen Zeit habe ich in meiner Freizeit Sachen restauriert, für mich und für Kollegen. Zu dieser Zeit hatte ich ein Lager voller Sofas. Einige Bars und Restaurants haben dann auch Möbel von mir erhalten.
Während meiner Kochlehre wurde mir bewusst, dass nichts weggeworfen werden darf, rein aus wirtschaftlichen Gründen. Ich koche immer noch sehr viel selber und auch frisches. Ich verschwende nie Esswaren.
Eigentlich wollte ich diesen Laden gar nicht (zeigt auf die Räumlichkeiten um sich herum). Ich bin nur vorbeigefahren und habe gesehen „Werkstatt zu vermieten“. Also habe ich schnell angerufen und gefragt, ob ich das kurz anschauen kommen kann. Als ich dann aber hier hineingekommen bin, dachte ich mir: „Oh wow!” So einen Ort zu finden ist sehr selten. Die Leute erwarten nicht so einen Laden.
![]()
![]()
Wofür steht Azibo?
Azibo ist ein afrikanischer Jungenname und bedeutet „die ganze Welt“. Ich habe den Namen gewählt, da ich denke, wir können die Globalisierung nicht stoppen, aber wir können bewusster konsumieren und regulieren. Denn was ist der Sinn darin Material nach China zu senden, dort Sachen zu produzieren und dann das Ganze wieder hierhin zurück zu transportieren? Dann auch noch mit Schiffen, die dreckiges Öl benutzen. Das schlechte Gewissen über diesen ganzen Prozess wird auf den Konsumenten gewälzt und nicht auf die Produzenten. Konsumenten müssen schauen, dass sie alles entsorgen, dabei sollten Firmen sich sagen „Ja, vielleicht kostet es mehr an einem Ort zu produzieren, aber dafür können wir den Dreck reduzieren.“ Deswegen denke ich mir, weswegen sollte ich Dinge wegschmeissen, wenn ich sie neu polstern kann. Dann muss man es nicht neu produzieren.
Die Qualität der Ware war früher höher. Stühle die 80 Jahre alt sind, halten super, wobei andere Stühle, die aus Billigholz oder Einzelteilen zusammengesetzt wurden, einfach zusammenknicken. Oder wenn ich sehe, dass man einen Stuhl für 19.- kaufen kann, aber für den Betrag kann ich nicht mal das Holz hier im OBI kaufen. Dann frage ich mich, ob das Sinn macht.
![]()
Wie kamst du von der Kochlehre zu Azibo?
Das ist ein lange Geschichte (lacht). Ich habe immer Sachen für zu Hause gesucht, die niemand anders hat. Früher hat man in den Brockis super Ware gefunden zu relativ günstigen Preisen. Dann habe ich angefangen Sofas, Sessel und anderes für mich zu kaufen und diese neu zu polstern. Wenn Leute zu Besuch kamen fanden Sie: „Wow, das ist denn schön!“ Neu kosten solche Stücke 400-500 Stutz, aber die alten sind immer noch top und man muss nicht viel dran machen.
Genau während dieser Zeit habe ich einem Kollegen geholfen das Maison Blunt in Zürich aufzubauen. Wir sind dafür nach Marokko gereist um Sachen für das Restaurant zu suchen. Dabei sind wir auf diese handgemachten Plättchen gestossen, diese Zementfliesen mit den Mustern drauf. Vor zwanzig Jahren, als ich von der weit entwickelten Schweiz, nach Marokko gegangen bin, habe ich gedacht ich lese die Bibel! Da siehst du Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst. Eben wie diese Plättchen die von Hand gemacht und gehämmert werden. Das ist der Wahnsinn!
Das Restaurant wurde dann so aufgebaut und dann habe ich gedacht: Es kann nicht sein, dass wir Sachen kaufen, einfach nur zum wegschmeissen. Meine Grossmutter, während der Zeit als sie im Altersheim wohnte, hat mich immer angerufen, wenn einer in die Alterssiedlung gehen musste. Sie sagte mir: „Schau, da geht einer, du kannst einige Sachen abholen.“ Das habe ich dann gemacht. Das waren Dinge die über Generationen von den Leuten perfekt gepflegt wurden, da lag wegschmeissen einfach nicht drin. Diese Leute hätten niemals daran gedacht etwas „einfach so zu kaufen“. Auch bei der Grossmutter meiner Frau, wenn du ihr sagst: „Hey Grosi kauf dir doch ein neues Sofa“, dann sagt sie „Nein! Wofür? Ich hab doch schon eines.“ Das ist eine ganz andere Einstellung. Ich merke, dass es beim Konsum von heute nicht darum geht etwas Gutes zu kaufen, aber etwas mit einem Namen. Wenn du in der Schweiz ein neues Produkt erfinden möchtest, ist es sehr schwierig durchzukommen. Man muss bereits einen gewissen Standard anbieten um sich durchzusetzen, sodass es fast nicht möglich ist für Neuankömmlinge durchzudringen. Dazu kommt noch die ziemliche Konkurrenz mit Design Onlineshops wie Monoqi.
IKEA find ich aber eigentlich am schlimmsten. Denn es ist so konzipiert, dass man durchlaufen kann und man braucht all die Sachen eigentlich nicht. Es hat so viel sinnlosen Shit herum, bei denen die Leute sich denken: „Ah wow, das kostet nur zwei Stutz!“ Da habe ich realisiert: Es geht darum, was du brauchst, und nicht darum, was du willst. Viele Leute haben durch den ganzen Konsum das Gefühl dafür verloren was sie brauchen und was sie eigentlich nur wollen. In der Schweiz haben wir immerhin eine geregelte Entsorgung, in anderen Ländern landet das Zeug auf der Strassenseite. Dabei sind z.B. PET-Faschen ein sehr interessantes Produkt zum recyceln. Speziell bei Sofas denken die Leute: „Oh nein, das ist Grosmuttis Sofa“, aber dass es ein schönes Stück werden kann, das sehen sehr wenige. Wenn man etwas spielt mit Stoffen, kann es aber interessant werden. Es wird dann wie ein Stück Kunst. Es wird dieses so niemals wieder geben mit diesem Stoff (zeigt auf ein Sofa im Showroom). Es ist ein Unikat.
![]()
![]()
Wie kam es, dass du Restaurateur wurdest?
Ich habe mir alles selbst beigebracht. Durch das Internet hat man die Möglichkeit in andere Bereiche reinzuschauen. Mit Bildern, Videos, auf Pinterest, an Veranstaltungen und Messen, Zeitschriften und Bücher. Sowie dieses Buch hier über afrikanische Häuser (holt ein buntes Buch vom Stapel). In Afrika machen sie sehr viel aus nichts und das hat mich sehr inspiriert. Viele würden das vielleicht nicht stylisch finden, aber für mich ist das stylisch. Die Leute dort haben nichts und sie müssen die Sachen irgendwo finden um Ihren Wohnraum so zu gestalten. Es kann alles schön sein, es muss nicht immer Louis Vuitton sein. In Japan gibt es einen Ausdruck Wabi-Sabi, das bedeutet „Schönheit in Imperfektion“. Wenn ein Krug einen Hick oder Splitter hat, kann der auch schön sein. Ein Schreiner hier würde sagen, dass die Kanten genau so und auf keine andere Weise gemacht werden müssen. Aber ich denke, das ist ein Stück Holz, das ist so oder so schön. Wer sagt denn, dass etwas nicht schön ist? Man muss die Schönheit im Objekt selbst sehen. In der Hotelfachschule haben wir gelernt eine Karte zu gestalten. Mich hat da gestört, dass Sachen immer perfekt und genau so und nicht anders gemacht werden mussten. Ich fragte mich immer wieso. Mir war das alles immer zu genormt.
![]()
Auf deiner Webseite sagst du: Azibo macht aus allem Schönes. Was war das Schönste, das du je gemacht hast?
Puh! Das könnte ich gar nicht beantworten! Wie gesagt, es ist alles schön und jedes Stück ist eines für sich. Das Schwierigste dabei ist ein Stück so zu gestalten, dass es jemandem gefällt und dieser es auch kauft. Eigentlich ist das Stück wertlos bis es jemand kauft. Aber etwas nicht Verkauftes ist nicht nicht schön, es gibt nämlich immer jemandem, dem es gefallen wird. Du musst immer warten bis der Kunde reinkommt, der die Sachen schön findet. Leute die in den Laden kommen, finden oftmals alles schön. Ob sie es dann kaufen und es in Ihre Wohnung stellen, ist eine andere Frage. Wenn man nur kauft, was man braucht und etwas Grün dazu stellt, kann man sehr stylisch wohnen ohne sich an Marken zu klammern. Es geht um die persönliche Wohnatmosphäre. So wie bei den afrikanischen Hütten: keiner wird den gleichen Wohnraum haben, es ist sehr, sehr individuell. So etwas kann man nicht nachahmen.
Wenn eine Berühmtheit in den Laden kommen würde, wem würdest du am liebsten deine Stücke anbieten?
Im Gastgewerbe habe ich bereits einige bekannte oder wichtige Leute bedient. Eigentlich ist jede Person wichtig. Aber wenn eine bekannte Person hereinkommen würde, dann hätte ich gerne Anna Rossinelli. Sie war nämlich schon mal hier! Ich habe sie nicht erkannt, aber ich behandle jeden in meinem Laden gleich, also war sie nicht weniger wichtig, weil ich sie nicht erkannt habe. Diese Frau ist so aufgestellt hier hereingekommen und ich dachte: “Wow, was für eine tolle Frau!” So lustig und aufgestellt. Dann habe ich sie gefragt, was sie macht und sie antwortete, dass sie singe. Sie erwähnte ihren Namen und ich (verdreht verlegen die Augen) dachte mir, oh nein! Da kenne ich all ihre Lieder und jetzt da sie vor mir steht, erkenne ich sie nicht einmal (lacht).
Aber mir sind alle Leute wichtig, die hier reinkommen. Berühmte Leute hatten einfach die Möglichkeit dort hinzugelangen, wo sie jetzt sind. Das Schöne ist, dass ich hier im Laden alle möglichen Schichten und Altersgruppen sehe und alle Azibo schätzen. An Messen hat mich das gestört, dass die Leute an den Ständen immer gefragt haben, was ich für einen Laden betreibe. Ich gehe oft an Messen um Produkte aus aller Welt zu finden – im Sinne von Azibo: aus der ganzen Welt. Die Verkäufer möchten oftmals, dass ihre Produkte auf eine ganz bestimmte Art und Weise in Szene gesetzt werden und dann sagen sie: „Oh nein, das ist nicht die Art von Laden, in dem wir unsere Produkte verkaufen wollen.“ Das finde ich manchmal schade. Da sind wir wieder beim Perfektionismus. Ich finde, eine Designlampe mit einem alten Stuhl zusammen in einem modernen Gebäude mit Betonboden wirkt ganz anders, als man es im Katalog sehen würde.
![]()
Was findet man in deinem Laden nicht?
Plastiksachen. Plastik ist das Material, das am meisten der Erde schadet. Es wird en masse produziert und es ist nicht biologisch abbaubar. Es gibt so viele andere Materialien, die man anstelle von Plastik benutzen könnte. Das kann zum Beispiel ein langlebiger Metalleimer sein, den man auch als Topf wiederverwenden könnte für Pflanzen. Die Wiederverwendbarkeit von Plastik ist sehr gering. Plastik kann aber auch ein schönes Material sein. Putzmittelgefässe könnte man auch als Töpfe wiederverwenden, aber Plastik ist eben nicht ein Material das mir entspricht. PET allerdings finde ich ein sehr interessantes Material um zu recyceln. Ich habe Stoff hier zum beziehen, das aus 70% PET gemacht wurde. Ich mache viel damit. Es gibt auch Fleecepullis die aus PET gemacht sind. Die Flaschen sind leicht, weswegen das Zurückbringen kein grosser Aufwand ist. Was allerdings schade ist, ist dass es wieder irgendwo hingeschifft werden muss fürs Recycling. Hier in der Schweiz werden glaube ich bis zu 90% PET gesammelt und das ohne, dass die Schweizer dafür Pfand erhalten. In Deutschland dafür werden dann für Pfand auch PET Flaschen aus dem Mülleimer herausgefischt von Leuten, die das Geld brauchen. Ob das sozialrechtlich nun vertretbar ist, ist eine andere Frage. Man kommt wieder in einen Kreislauf hinein was korrekt ist – oder eben nicht.
Wie kann Azibo zur Besserung der Umstände beitragen?
Ich verkaufe meine Stücke aktiv mit meiner Philosophie. Ich erkläre den Leuten, warum ich Möbel restauriere, warum ich den Sinn dahinter nicht sehe Möbel hin und her zu schiffen, wenn wir doch schöne Stücke hier haben. Ob es jemandem gefällt, ist dann eben die Frage. Der Laden kann aber nur so laufen, weil die Miete tief ist. Wenn ich in einen anderen Teil der Stadt ziehen würde, müsste ich wohl viel mehr Aufwand betreiben um es aufrecht zu erhalten. Dann wäre es auch nicht mehr das Gleiche mit den Räumlichkeiten. Immerhin habe ich den Raum über die letzten acht Jahre so umgenutzt, wie er jetzt ist. Das andere Problem ist der Preis eines Möbels. Auch wenn die Stücke restauriert sind, heisst das nicht, dass sie Occasion sind und zwanzig Franken kosten. Sehr viele Sachen muss ich manchmal günstiger verkaufen, unter dem Betrag den ich an Zeit und Aufwand hineingesteckt habe. Das macht es natürlich schwieriger, da ich dann keine fixen Angebote habe. Aber mein grösstes Problem ist, dass ich nicht wirklich wachsen kann. Ich kann es mir nicht leisten jemanden einzustellen und mehr Zeit in das Auffinden von neuen Produkten – oder der Entwicklung eines Onlineshops – zu investieren. Ich renne meinen Aufträgen hinterher und mache das, was die Kunden gerne hätten, statt das umzusetzen was ich für gut halten würde. Hätte ich ein fixes Angebot, könnten die Kunden jederzeit in den Laden kommen und ein bestimmtes Produkt ansehen. Aber da ich die Produkte ja nicht vorhanden habe, ist es für viele Leute schwierig sich das Endresultat vorzustellen, was das Verkaufen schwieriger macht.
![]()
![]()
Was machst du sonst so in deiner Freizeit?
Wenn ich nicht im Laden selbst bin, suche ich entweder Möbel oder hole Möbel irgendwo ab. Ansonsten bin ich zu Hause, in Zürich, gerne am See und ich gehe auch gerne wandern. Gerade war ich auch in Paris. Ich bereise gerne Städte und laufe dann viel herum. Dabei fotografiere ich gerne Street Art. Leute, die sich die Mühe machen Sticker herzustellen um kleine Botschaften zu verstreuen. Oder Leute, die nicht das Geld haben um an Institute zu gehen und dann auf der Strasse ihre Kreativität ausleben. So wie der Künstler, der Kaugummis bemalt auf der Millennium Bridge in London. Das inspiriert mich.
Wenn du drei Haselnüsse finden würdest und für jedes Nüsschen einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Erstens ein Café hier im Laden. Zweitens ein integrierter Blumenladen. Und drittens ein kleiner Comestibles Laden mit Delikatessen von lokalen Produzenten. Es wäre das kleinste Shoppingcenter in Basel. Die Möbel würde ich dann einfach nach unten stellen und für das Café benutzen.
Immer wenn Leute hier in den Laden kommen, wollen sie ein Projekt mit mir machen. Letzthin ist eine junge Frau gekommen und sagte sie würde gerne etwas mit Pflanzen machen. Ich antwortete: „Ich auch!“ Solche Projekte wären super, aber die Kreativität hier ist sehr gering, denn die Mieten sind zu hoch. Die Leute wollen das Risiko für ihren eigenen Laden nicht eingehen, denn sie haben Angst alles zu verlieren. Sehr viele Leute haben etwas gelernt, jedoch können sie ihre Kreativität nicht mit ihren eigenen Projekten ausleben. Neubauten werden so berechnet und gebaut, dass grosse Läden wie Coop oder Migros sich einmieten, statt, dass kleine Flächen gebaut werden, wo zum Beispiel ein Schmuckdesigner einen kleinen Platz finden könnte. So aber, ist die Vielfalt sehr gering.
Ein Beispiel mit Luxemburgerli: Lindt und Sprüngli bildet pro Jahr viele Lehrlinge aus. Diese Lehrlinge können das Luxemburgerlimachen, aber in Zukunft nur bei Lindt und Sprüngli ausüben, da es keinen anderen Confiseur gibt, der diese herstellt. Und eine eigene Confiserie aufzumachen, wäre zu riskant. Wenn du aber nach Frankreich gehst, siehst du diese Macarons überall! Das Gundeli Quartier ist so voller verschiedener Menschen, jeder von Ihnen könnte seinen eigenen Laden machen, wenn die Mieten nicht so hoch wären. Man sieht es bei den Zwischennutzungen, wie Kreativität sich entfaltet, wenn die Flächen nicht so teuer sind.
Wie wär’s mal mit…
…einem spontanen Projekt und mit mir aus einem Objekt ein Möbel herzustellen.
![]()
Marc Auers Laden heisst Azibo, aber seine Firma ist Good Ideas Enterprises GmbH. Er ist offen für Projektvorschläge, kreative Ideen und Kollaborationen. Und für interessante Gespräche, danke für die spannende Zeit im versteckten Möbel- und Accessoireladen in den Tiefen des Gundelis, der zu Inspiration und Erkundung grösserer Themen einlädt. Wir hoffen, dass Marc sein kleinstes Shoppingcenter von Basel bald umsetzen kann! Wir werden da sein, wenns soweit ist!
_
von Esther Steiner
am 30.10.2017
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Oliver Hochstrasser einholen.
Von Südafrika in die Schweiz. Vom Koch über Barmann zum Restaurateur. Von afrikanischen Hütten über Recycling, persönlicher Einrichtung und Design. Mit Menschen die Tea Rooms einrichten, Marokko bereisen, in Altersheimen leben oder mit Leuten die Kaugummis anmalen. Über Konsum, Kreativität, Ausbildung und Gentrifizierung. Mit Marc Auer spricht man über alles und die ganze Welt. Denn Azibo ist die ganze Welt.

Lieber Marc, wer bist du?
Ich bin in Südafrika aufgewachsen. Im Jahr 1985 bin ich in die Schweiz gekommen und habe eine Kochlehre gemacht. Als die Probleme mit der Regierung in Südafrika begannen, hat mein Vater entschieden zurück in die Schweiz zu kommen, damit ich eine gute Ausbildung machen konnte. Während meiner Lehre hatte ich kurz Deutschunterricht, aber richtig Deutsch reden und schreiben habe ich nie gelernt. Bei der Arbeit waren viele Italiener da, Saisonarbeiter, da gab es nicht viel Gelegenheit zum Üben. Danach habe ich eine Barfachschule gemacht in Luzern und anschliessend habe ich im Hotel National an der Bar gearbeitet – vollgeschniegelt. Da habe ich viel Menschenkenntnisse erlangt, an der Bar, wo die Leute trinken und die Wahrheit erzählen. Anschliessend habe ich die Hotelfachschule gemacht und bin nach dem Abschluss in die Ostschweiz gegangen, um in einer Molkerei zu arbeiten. Die hatten eine Cateringabteilung. Das war ein sehr anstrengender Job, man schleppt das ganze Restaurant ständig mit. Dort hat man auch viel Abfall gehabt. Während dieser ganzen Zeit habe ich in meiner Freizeit Sachen restauriert, für mich und für Kollegen. Zu dieser Zeit hatte ich ein Lager voller Sofas. Einige Bars und Restaurants haben dann auch Möbel von mir erhalten.
Während meiner Kochlehre wurde mir bewusst, dass nichts weggeworfen werden darf, rein aus wirtschaftlichen Gründen. Ich koche immer noch sehr viel selber und auch frisches. Ich verschwende nie Esswaren.
Eigentlich wollte ich diesen Laden gar nicht (zeigt auf die Räumlichkeiten um sich herum). Ich bin nur vorbeigefahren und habe gesehen „Werkstatt zu vermieten“. Also habe ich schnell angerufen und gefragt, ob ich das kurz anschauen kommen kann. Als ich dann aber hier hineingekommen bin, dachte ich mir: „Oh wow!” So einen Ort zu finden ist sehr selten. Die Leute erwarten nicht so einen Laden.


Wofür steht Azibo?
Azibo ist ein afrikanischer Jungenname und bedeutet „die ganze Welt“. Ich habe den Namen gewählt, da ich denke, wir können die Globalisierung nicht stoppen, aber wir können bewusster konsumieren und regulieren. Denn was ist der Sinn darin Material nach China zu senden, dort Sachen zu produzieren und dann das Ganze wieder hierhin zurück zu transportieren? Dann auch noch mit Schiffen, die dreckiges Öl benutzen. Das schlechte Gewissen über diesen ganzen Prozess wird auf den Konsumenten gewälzt und nicht auf die Produzenten. Konsumenten müssen schauen, dass sie alles entsorgen, dabei sollten Firmen sich sagen „Ja, vielleicht kostet es mehr an einem Ort zu produzieren, aber dafür können wir den Dreck reduzieren.“ Deswegen denke ich mir, weswegen sollte ich Dinge wegschmeissen, wenn ich sie neu polstern kann. Dann muss man es nicht neu produzieren.
Die Qualität der Ware war früher höher. Stühle die 80 Jahre alt sind, halten super, wobei andere Stühle, die aus Billigholz oder Einzelteilen zusammengesetzt wurden, einfach zusammenknicken. Oder wenn ich sehe, dass man einen Stuhl für 19.- kaufen kann, aber für den Betrag kann ich nicht mal das Holz hier im OBI kaufen. Dann frage ich mich, ob das Sinn macht.

Wie kamst du von der Kochlehre zu Azibo?
Das ist ein lange Geschichte (lacht). Ich habe immer Sachen für zu Hause gesucht, die niemand anders hat. Früher hat man in den Brockis super Ware gefunden zu relativ günstigen Preisen. Dann habe ich angefangen Sofas, Sessel und anderes für mich zu kaufen und diese neu zu polstern. Wenn Leute zu Besuch kamen fanden Sie: „Wow, das ist denn schön!“ Neu kosten solche Stücke 400-500 Stutz, aber die alten sind immer noch top und man muss nicht viel dran machen.
Genau während dieser Zeit habe ich einem Kollegen geholfen das Maison Blunt in Zürich aufzubauen. Wir sind dafür nach Marokko gereist um Sachen für das Restaurant zu suchen. Dabei sind wir auf diese handgemachten Plättchen gestossen, diese Zementfliesen mit den Mustern drauf. Vor zwanzig Jahren, als ich von der weit entwickelten Schweiz, nach Marokko gegangen bin, habe ich gedacht ich lese die Bibel! Da siehst du Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst. Eben wie diese Plättchen die von Hand gemacht und gehämmert werden. Das ist der Wahnsinn!
Das Restaurant wurde dann so aufgebaut und dann habe ich gedacht: Es kann nicht sein, dass wir Sachen kaufen, einfach nur zum wegschmeissen. Meine Grossmutter, während der Zeit als sie im Altersheim wohnte, hat mich immer angerufen, wenn einer in die Alterssiedlung gehen musste. Sie sagte mir: „Schau, da geht einer, du kannst einige Sachen abholen.“ Das habe ich dann gemacht. Das waren Dinge die über Generationen von den Leuten perfekt gepflegt wurden, da lag wegschmeissen einfach nicht drin. Diese Leute hätten niemals daran gedacht etwas „einfach so zu kaufen“. Auch bei der Grossmutter meiner Frau, wenn du ihr sagst: „Hey Grosi kauf dir doch ein neues Sofa“, dann sagt sie „Nein! Wofür? Ich hab doch schon eines.“ Das ist eine ganz andere Einstellung. Ich merke, dass es beim Konsum von heute nicht darum geht etwas Gutes zu kaufen, aber etwas mit einem Namen. Wenn du in der Schweiz ein neues Produkt erfinden möchtest, ist es sehr schwierig durchzukommen. Man muss bereits einen gewissen Standard anbieten um sich durchzusetzen, sodass es fast nicht möglich ist für Neuankömmlinge durchzudringen. Dazu kommt noch die ziemliche Konkurrenz mit Design Onlineshops wie Monoqi.
IKEA find ich aber eigentlich am schlimmsten. Denn es ist so konzipiert, dass man durchlaufen kann und man braucht all die Sachen eigentlich nicht. Es hat so viel sinnlosen Shit herum, bei denen die Leute sich denken: „Ah wow, das kostet nur zwei Stutz!“ Da habe ich realisiert: Es geht darum, was du brauchst, und nicht darum, was du willst. Viele Leute haben durch den ganzen Konsum das Gefühl dafür verloren was sie brauchen und was sie eigentlich nur wollen. In der Schweiz haben wir immerhin eine geregelte Entsorgung, in anderen Ländern landet das Zeug auf der Strassenseite. Dabei sind z.B. PET-Faschen ein sehr interessantes Produkt zum recyceln. Speziell bei Sofas denken die Leute: „Oh nein, das ist Grosmuttis Sofa“, aber dass es ein schönes Stück werden kann, das sehen sehr wenige. Wenn man etwas spielt mit Stoffen, kann es aber interessant werden. Es wird dann wie ein Stück Kunst. Es wird dieses so niemals wieder geben mit diesem Stoff (zeigt auf ein Sofa im Showroom). Es ist ein Unikat.


Wie kam es, dass du Restaurateur wurdest?
Ich habe mir alles selbst beigebracht. Durch das Internet hat man die Möglichkeit in andere Bereiche reinzuschauen. Mit Bildern, Videos, auf Pinterest, an Veranstaltungen und Messen, Zeitschriften und Bücher. Sowie dieses Buch hier über afrikanische Häuser (holt ein buntes Buch vom Stapel). In Afrika machen sie sehr viel aus nichts und das hat mich sehr inspiriert. Viele würden das vielleicht nicht stylisch finden, aber für mich ist das stylisch. Die Leute dort haben nichts und sie müssen die Sachen irgendwo finden um Ihren Wohnraum so zu gestalten. Es kann alles schön sein, es muss nicht immer Louis Vuitton sein. In Japan gibt es einen Ausdruck Wabi-Sabi, das bedeutet „Schönheit in Imperfektion“. Wenn ein Krug einen Hick oder Splitter hat, kann der auch schön sein. Ein Schreiner hier würde sagen, dass die Kanten genau so und auf keine andere Weise gemacht werden müssen. Aber ich denke, das ist ein Stück Holz, das ist so oder so schön. Wer sagt denn, dass etwas nicht schön ist? Man muss die Schönheit im Objekt selbst sehen. In der Hotelfachschule haben wir gelernt eine Karte zu gestalten. Mich hat da gestört, dass Sachen immer perfekt und genau so und nicht anders gemacht werden mussten. Ich fragte mich immer wieso. Mir war das alles immer zu genormt.

Auf deiner Webseite sagst du: Azibo macht aus allem Schönes. Was war das Schönste, das du je gemacht hast?
Puh! Das könnte ich gar nicht beantworten! Wie gesagt, es ist alles schön und jedes Stück ist eines für sich. Das Schwierigste dabei ist ein Stück so zu gestalten, dass es jemandem gefällt und dieser es auch kauft. Eigentlich ist das Stück wertlos bis es jemand kauft. Aber etwas nicht Verkauftes ist nicht nicht schön, es gibt nämlich immer jemandem, dem es gefallen wird. Du musst immer warten bis der Kunde reinkommt, der die Sachen schön findet. Leute die in den Laden kommen, finden oftmals alles schön. Ob sie es dann kaufen und es in Ihre Wohnung stellen, ist eine andere Frage. Wenn man nur kauft, was man braucht und etwas Grün dazu stellt, kann man sehr stylisch wohnen ohne sich an Marken zu klammern. Es geht um die persönliche Wohnatmosphäre. So wie bei den afrikanischen Hütten: keiner wird den gleichen Wohnraum haben, es ist sehr, sehr individuell. So etwas kann man nicht nachahmen.
Wenn eine Berühmtheit in den Laden kommen würde, wem würdest du am liebsten deine Stücke anbieten?
Im Gastgewerbe habe ich bereits einige bekannte oder wichtige Leute bedient. Eigentlich ist jede Person wichtig. Aber wenn eine bekannte Person hereinkommen würde, dann hätte ich gerne Anna Rossinelli. Sie war nämlich schon mal hier! Ich habe sie nicht erkannt, aber ich behandle jeden in meinem Laden gleich, also war sie nicht weniger wichtig, weil ich sie nicht erkannt habe. Diese Frau ist so aufgestellt hier hereingekommen und ich dachte: “Wow, was für eine tolle Frau!” So lustig und aufgestellt. Dann habe ich sie gefragt, was sie macht und sie antwortete, dass sie singe. Sie erwähnte ihren Namen und ich (verdreht verlegen die Augen) dachte mir, oh nein! Da kenne ich all ihre Lieder und jetzt da sie vor mir steht, erkenne ich sie nicht einmal (lacht).
Aber mir sind alle Leute wichtig, die hier reinkommen. Berühmte Leute hatten einfach die Möglichkeit dort hinzugelangen, wo sie jetzt sind. Das Schöne ist, dass ich hier im Laden alle möglichen Schichten und Altersgruppen sehe und alle Azibo schätzen. An Messen hat mich das gestört, dass die Leute an den Ständen immer gefragt haben, was ich für einen Laden betreibe. Ich gehe oft an Messen um Produkte aus aller Welt zu finden – im Sinne von Azibo: aus der ganzen Welt. Die Verkäufer möchten oftmals, dass ihre Produkte auf eine ganz bestimmte Art und Weise in Szene gesetzt werden und dann sagen sie: „Oh nein, das ist nicht die Art von Laden, in dem wir unsere Produkte verkaufen wollen.“ Das finde ich manchmal schade. Da sind wir wieder beim Perfektionismus. Ich finde, eine Designlampe mit einem alten Stuhl zusammen in einem modernen Gebäude mit Betonboden wirkt ganz anders, als man es im Katalog sehen würde.

Was findet man in deinem Laden nicht?
Plastiksachen. Plastik ist das Material, das am meisten der Erde schadet. Es wird en masse produziert und es ist nicht biologisch abbaubar. Es gibt so viele andere Materialien, die man anstelle von Plastik benutzen könnte. Das kann zum Beispiel ein langlebiger Metalleimer sein, den man auch als Topf wiederverwenden könnte für Pflanzen. Die Wiederverwendbarkeit von Plastik ist sehr gering. Plastik kann aber auch ein schönes Material sein. Putzmittelgefässe könnte man auch als Töpfe wiederverwenden, aber Plastik ist eben nicht ein Material das mir entspricht. PET allerdings finde ich ein sehr interessantes Material um zu recyceln. Ich habe Stoff hier zum beziehen, das aus 70% PET gemacht wurde. Ich mache viel damit. Es gibt auch Fleecepullis die aus PET gemacht sind. Die Flaschen sind leicht, weswegen das Zurückbringen kein grosser Aufwand ist. Was allerdings schade ist, ist dass es wieder irgendwo hingeschifft werden muss fürs Recycling. Hier in der Schweiz werden glaube ich bis zu 90% PET gesammelt und das ohne, dass die Schweizer dafür Pfand erhalten. In Deutschland dafür werden dann für Pfand auch PET Flaschen aus dem Mülleimer herausgefischt von Leuten, die das Geld brauchen. Ob das sozialrechtlich nun vertretbar ist, ist eine andere Frage. Man kommt wieder in einen Kreislauf hinein was korrekt ist – oder eben nicht.
Wie kann Azibo zur Besserung der Umstände beitragen?
Ich verkaufe meine Stücke aktiv mit meiner Philosophie. Ich erkläre den Leuten, warum ich Möbel restauriere, warum ich den Sinn dahinter nicht sehe Möbel hin und her zu schiffen, wenn wir doch schöne Stücke hier haben. Ob es jemandem gefällt, ist dann eben die Frage. Der Laden kann aber nur so laufen, weil die Miete tief ist. Wenn ich in einen anderen Teil der Stadt ziehen würde, müsste ich wohl viel mehr Aufwand betreiben um es aufrecht zu erhalten. Dann wäre es auch nicht mehr das Gleiche mit den Räumlichkeiten. Immerhin habe ich den Raum über die letzten acht Jahre so umgenutzt, wie er jetzt ist. Das andere Problem ist der Preis eines Möbels. Auch wenn die Stücke restauriert sind, heisst das nicht, dass sie Occasion sind und zwanzig Franken kosten. Sehr viele Sachen muss ich manchmal günstiger verkaufen, unter dem Betrag den ich an Zeit und Aufwand hineingesteckt habe. Das macht es natürlich schwieriger, da ich dann keine fixen Angebote habe. Aber mein grösstes Problem ist, dass ich nicht wirklich wachsen kann. Ich kann es mir nicht leisten jemanden einzustellen und mehr Zeit in das Auffinden von neuen Produkten – oder der Entwicklung eines Onlineshops – zu investieren. Ich renne meinen Aufträgen hinterher und mache das, was die Kunden gerne hätten, statt das umzusetzen was ich für gut halten würde. Hätte ich ein fixes Angebot, könnten die Kunden jederzeit in den Laden kommen und ein bestimmtes Produkt ansehen. Aber da ich die Produkte ja nicht vorhanden habe, ist es für viele Leute schwierig sich das Endresultat vorzustellen, was das Verkaufen schwieriger macht.


Was machst du sonst so in deiner Freizeit?
Wenn ich nicht im Laden selbst bin, suche ich entweder Möbel oder hole Möbel irgendwo ab. Ansonsten bin ich zu Hause, in Zürich, gerne am See und ich gehe auch gerne wandern. Gerade war ich auch in Paris. Ich bereise gerne Städte und laufe dann viel herum. Dabei fotografiere ich gerne Street Art. Leute, die sich die Mühe machen Sticker herzustellen um kleine Botschaften zu verstreuen. Oder Leute, die nicht das Geld haben um an Institute zu gehen und dann auf der Strasse ihre Kreativität ausleben. So wie der Künstler, der Kaugummis bemalt auf der Millennium Bridge in London. Das inspiriert mich.
Wenn du drei Haselnüsse finden würdest und für jedes Nüsschen einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Erstens ein Café hier im Laden. Zweitens ein integrierter Blumenladen. Und drittens ein kleiner Comestibles Laden mit Delikatessen von lokalen Produzenten. Es wäre das kleinste Shoppingcenter in Basel. Die Möbel würde ich dann einfach nach unten stellen und für das Café benutzen.
Immer wenn Leute hier in den Laden kommen, wollen sie ein Projekt mit mir machen. Letzthin ist eine junge Frau gekommen und sagte sie würde gerne etwas mit Pflanzen machen. Ich antwortete: „Ich auch!“ Solche Projekte wären super, aber die Kreativität hier ist sehr gering, denn die Mieten sind zu hoch. Die Leute wollen das Risiko für ihren eigenen Laden nicht eingehen, denn sie haben Angst alles zu verlieren. Sehr viele Leute haben etwas gelernt, jedoch können sie ihre Kreativität nicht mit ihren eigenen Projekten ausleben. Neubauten werden so berechnet und gebaut, dass grosse Läden wie Coop oder Migros sich einmieten, statt, dass kleine Flächen gebaut werden, wo zum Beispiel ein Schmuckdesigner einen kleinen Platz finden könnte. So aber, ist die Vielfalt sehr gering.
Ein Beispiel mit Luxemburgerli: Lindt und Sprüngli bildet pro Jahr viele Lehrlinge aus. Diese Lehrlinge können das Luxemburgerlimachen, aber in Zukunft nur bei Lindt und Sprüngli ausüben, da es keinen anderen Confiseur gibt, der diese herstellt. Und eine eigene Confiserie aufzumachen, wäre zu riskant. Wenn du aber nach Frankreich gehst, siehst du diese Macarons überall! Das Gundeli Quartier ist so voller verschiedener Menschen, jeder von Ihnen könnte seinen eigenen Laden machen, wenn die Mieten nicht so hoch wären. Man sieht es bei den Zwischennutzungen, wie Kreativität sich entfaltet, wenn die Flächen nicht so teuer sind.
Wie wär’s mal mit…
…einem spontanen Projekt und mit mir aus einem Objekt ein Möbel herzustellen.

Marc Auers Laden heisst Azibo, aber seine Firma ist Good Ideas Enterprises GmbH. Er ist offen für Projektvorschläge, kreative Ideen und Kollaborationen. Und für interessante Gespräche, danke für die spannende Zeit im versteckten Möbel- und Accessoireladen in den Tiefen des Gundelis, der zu Inspiration und Erkundung grösserer Themen einlädt. Wir hoffen, dass Marc sein kleinstes Shoppingcenter von Basel bald umsetzen kann! Wir werden da sein, wenns soweit ist!
_
von Esther Steiner
am 30.10.2017
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Oliver Hochstrasser einholen.
Yves Loekito: Im Gespräch mit dem Basler DJ und Sänger
Was haben Claasilisque Sound, das Coruba Soundsystem und die Schwellheim Band gemeinsam? Sie machen alle gute Laune und versetzen uns mit ihrer Musik in einen exotisch tropischen Rausch wie bei Rum zu Reggae-Rhythmen. Und natürlich Yves Loekito! Er lud uns in seine neu bezogene Wohnung am Erasmusplatz zum Gespräch ein, um über die Liebe zur Musik, Freundschaften und Schicksalsschläge zu sprechen.
![]()
Lieber Yves, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Yves Loekito. Ich bin 32 Jahre alt und in Allschwil aufgewachsen. Ich arbeite in Basel hauptberuflich als Sozialarbeiter mit Jugendlichen. Ausserdem bin ich Sänger der Band Schwellheim, ein Mitglied vom Claasilisque Sound und dem Coruba Soundsystem. Ich mache schon seit mehr als 10 Jahren Musik – als Sänger mit der Band und auch als DJ.
Was verbirgt sich genau hinter dem Claasilisque Sound, dem Coruba Soundsystem und der Schwellheim Band?
Claasilique Sound ist ein DJ-Kollektiv, das nach jamaikanischem Vorbild - das heisst mit MC und DJ gleichzeitig – Reggae, Dancehall und zeitgenössische jamaikanische Musik auflegt und Partys oder andere Events veranstaltet, wie z.B. den «Sunday Jerk» bei dem wir sonntags ein BBQ machen und dazu Musik auflegen. Ausserdem nehmen wir auch mit unserem eigenen Truck an den zwei Musikparaden «Beat on the Street» und «Jungle Street Groove» teil, welche sich jedes Jahr abwechseln. Und sonst haben wir natürlich noch regelmässige Bookings in Basel, der restlichen Schweiz und im Ausland.
Das Coruba Soundsystem ist eine neue Partyreihe im Viertel Club, dem ehemaligen Hinterhof, die wir als Claasilique zusammen mit DJ Bazooka ins Leben gerufen haben. Beim Coruba Soundsystem legen wir den Fokus vor allem auf Afrobeat und Dancehall, was bisher super angelaufen ist.
Die Band Schwellheim Band ist eine elfköpfige Mundart Reggae Band, die es mittlerweile mehr als 10 Jahre gibt. Wir haben bereits drei Alben herausgebracht und touren grösstenteils in der Schweiz. In der Band bin ich einer von zwei Sängern.
![]()
Du bist also DJ, Sänger – und auch noch Bühnenbauer, kann das sein? Was macht dir am meisten Spass? Und worin liegen für dich die grössten Unterschiede zwischen der Arbeit am DJ-Pult und der Stimme?
(lacht) Ja, im Bauen bin ich nicht so gut. Den „Bühnenbauer” klammern wir lieber einmal aus. Für unsere Trucks haben wir zum Glück viele handwerklich talentierte Freunde die immer am Start sind und auf die jedes mal wieder Verlass ist.
Musik macht mir grundsätzlich sehr viel Spass. Alles was mit Musik zu tun hat. Wenn ich zwischen Singen oder Auflegen entscheiden müsste, wäre das für mich extrem schwer. Das Arbeiten am Pult oder mit der Stimme ist natürlich unterschiedlich und ganz anders. Beides gibt mir auf jeden Fall sehr viel zurück. Das Singen mit einer Band auf Konzerten ist – vom Gefühl und der Liveshow her – für alle Beteiligten noch einmal viel intensiver als das Auflegen. Worum es immer geht ist, den Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln, ihnen Freude zu bereiten und sie zum Tanzen zu bringen. Singen ist auch so intensiv, weil viel Persönliches reinspielt. Ich denke darum kommt beim Singen auch so viel zurück. Das Publikum spürt das und reagiert darauf.
Nun bist du ja meistens nicht alleine anzutreffen. Wann, wie und wo hast du denn deine musikalischen Mitstreiter kennengelernt?
Die Schwellheim Band wurde vor circa 14 Jahren von uns Jungs aus Allschwill gegründet. „Schwellheim” ist ein Übername für Allschwil. Begonnen haben wir in einem kleinen Keller. Kennen tun wir uns alle über die Schule und dann, über die Jahre, sind immer mehr und mehr Leute – auch nicht aus Allschwil – dazugekommen.
Claasilisque ist witziger Weise auch aus Allschwil bzw. von zwei Jungs aus Allschwil gegründet worden. Die Jungs kannte ich von früher und ich bin dann 2012 dazugestossen.
![]()
Wie entsteht daraus – über viele Jahre – eine so gute Zusammenarbeit? Hat es dafür viel Disziplin gebraucht?
Ja, es braucht sehr viel Disziplin. Bei allen Crews haben wir zudem untereinander ein sehr gutes Verhältnis. Diese Freundschaft ist die eigentliche Basis für die Projekte. Das ist sehr wichtig. Bei der Schwellheim Band sind wir elf Jungs. Da braucht es auf jeden Fall zudem Kompromissbereitschaft, aber auch Überzeugungskraft. Und manchmal stimmen wir auch ganz simpel und demokratisch ab. Dasselbe gilt für Claasilisque, da müssen wir uns allerdings nur zu dritt finden.
Wie denkst du selbst, ist es so mit dir zusammen zu arbeiten? Welche Punkte sind dir wichtig?
(grinst) Da musst du die Anderen fragen! Was mir wichtig ist oder was mir auch schon andere Leute gesagt haben ist, dass ich harmoniebedürftig bin. Ich achte sehr darauf, dass es allen gut geht, dass auch irgendwo ein guter Vibe herrscht. Sonst bin ich eher ein ruhiger Typ. Ich denke, dass die Anderen diese Ruhe noch an mir schätzen.
![]()
Wie hat das bei dir mit der Musik eigentlich angefangen?
Ich habe schon immer gerne unter der Dusche gesungen und auch als Kind schon immer Playback oder Karaoke. In der Schule habe ich auch gesungen. In der Diplommittelschule war ich in einem gemischten Chor. Da habe ich übrigens auch schon mit dem anderen Sänger von der Schwellheim Band angefangen zu singen. Unseren ersten Auftritt auf der Bühne hatten wir dann bei unserer Abschlussfeier. Und danach ging das eigentlich los mit der Schwellheim Band. In meiner Klasse war ich, glaube ich, der Erste mit einem CD-Player und CDs von meinem Vater.
Ein Stück weit habe ich das also auch von meinen Eltern. Meine Mutter spielt auch heute noch in einer Band Akkordeon und mein Dad hat immer schon viel Musik gesammelt. CDs und Platten. Dann ist da noch mein Bruder, der auch musikalisch unterwegs ist.
Gerade macht die Schwellheim Band ja eine Musikpause. Kannst du uns dazu was sagen? Wann kann man von der Band wieder etwas Neues erwarten?
Das ist leider eine tragische Geschichte. Im Mai ist unser zweiter Sänger Dani schwer an einem Infekt erkrankt, der sich im Gehirn ausgebreitet hatte. Daraufhin musste er ins Spital, um behandelt zu werden und braucht nun Zeit um sich wieder zu regenerieren. Das Ganze war ein einschneidendes Erlebnis für uns als Band und auch für mich persönlich. Es stand anfangs gar nicht gut um ihn. Ihm geht es zum Glück aber schon so langsam besser. Die restlichen Bandmitglieder und ich treffen uns nun zur Zeit einfach so zum Jammen, Komponieren und Proben. Livegigs spielen wir aber keine und können daher auch gerade deine Frage nach Neuem von der Band noch nicht beantworten. Wir werden erst einmal warten bis es Dani wieder gut geht und sehen dann wo wir stehen.
![]()
Wir von WWMM wünschen Dani auf jeden Fall weiterhin gute Besserung. Du bist nun seit diesem Jahr frisch gebackener Ehemann! Wie hat die Hochzeit dein Leben verändert? Welche Auswirkungen hat das Eheleben auf dich, deine Musik und dein Engagement für deine Projekte?
Jacqueline und ich haben uns eigentlich so kennengelernt, mit all der Musik und den Projekten, ganz in dem kreativen Schaffen, das wir eigentlich auch immer noch machen. So gesehen hatte die Hochzeit keine Auswirkung auf meine Projekte und auf mein Leben ganz grundsätzlich. Es war für mich auf jeden Fall aber ein grosser Schritt, der sich wiederum ganz natürlich angefühlt hat. Wir haben nun eine neue Wohnung. Das Ganze stimmt irgendwie. Aber mega gross geändert hat sich sonst nichts ausser, dass ich ein Ring an meinem Finger trage und einen neuen Nachnamen habe. Mein Geburtsname war für mich nicht so wichtig, was auch der Grund war, warum ich den Familiennamen von meiner Frau angenommen habe. Als Zeichen dafür, dass wir nun gemeinsam, als eine Familie, in dieselbe Richtung gehen. Ja, vielleicht ist alles ein bisschen ernster geworden!
Gibt es etwas, was du mit Schwellheim, alleine oder in einem anderen Kollektiv mit der Musik noch erreichen möchtest?
Grundsätzlich einmal soll es immer weiter gehen. Dass die Kollektive nicht auseinanderbrechen ist mir wichtig. Mit Schwellheim haben wir zudem das Ziel einmal an grossen Open-Airs in der Schweiz aufzutreten. Das steht zumindest auf meiner persönlichen Bucketlist. Und als DJ noch mehr zu touren, wär auch eine coole Sache.
![]()
Inspiriert dich die Arbeit als Sozialarbeiter auch zum Musik machen und umgekehrt?
Die Musik ist ein wunderbarer Ausgleich zur Arbeit. Gleichzeitig inspiriert mich aber auch die Arbeit, weil ich ja viel mit Menschen zu tun habe und dabei die Geschichten erlebe, die nur das Leben schreiben kann. Die unterschiedlichen Schicksale, aber auch das Leben allgemein, liefern mir die Inspiration für meine Songtexte. Die Balance zwischen Arbeiten und der Musik sind wie Ying und Yang in meinem Leben.
Was sagst du zur internationalen oder regionalen Musik- und Ausgeh-Szene?
Die regionale Musikszene finde ich extrem spannend. Wir haben viele junge Leute die mit einfachsten Mitteln Musik machen und kreativ sind. Da bin ich dann auch gerne unter den Zuschauern immer in der vordersten Reihe mit dabei. Dabei fällt mir auch oft auf, dass immer mehr Leute nicht bereit sind für Konzerttickets und Kulturangebote im Allgemeinen viel zu zahlen. Das ist sicher eine Diskrepanz, für die es eine Lösung braucht. Das kulturell wahnsinnig breite, zum Teil auch kostenlose, Angebote an Veranstaltungen in Basel ist sicher toll, man darf allerdings auch nicht vergessen, dass oft neben viel Herzblut auch sehr viel Zeit und auch Geld in den Events steckt, was refinanziert werden muss. Viele gute, aber auch sehr kleine Initiativen, die dennoch von jungen Leuten gut besucht sind, fahren daher oft finanziell am unteren Limit.
Singen auf Englisch oder Schweizerdeutsch? Und warum?
Schweizerdeutsch natürlich! Das ist meine Muttersprache, so fühle ich und so kann ich mich am Besten ausdrücken.
Wenn deine Musik ein Cocktail wäre, dann welcher?
Ich glaube, die wäre dann ein Mai Tai. Mit ganz viel Rum und einem kleinen
Schirmchen – stilecht serviert in einer Kokosnuss.
![]()
Wenn du eine Band mit international bekannten Musiker aus aller Welt gründen könntest, wie würde die Band heissen, welches Musikgenre würde sie bedienen und vor allem, welche Musiker würdest du wählen?
(lacht) Das ist echt eine schwere Frage! Es muss auf jeden Fall einen Schlagzeuger und einen Bassisten haben. Das wären dann Sly Dunbar und Robert Shakespeare vom Reggae-Duo «Sly & Robbie», die in den 70ern und 80ern massgeblich die Reggae-Rhythmen geprägt haben. Dann bräuchte es noch einen Gitarristen und ein bisschen Rock 'n' Roll, diese Position besetzt dann „the one and only“ Keith Richards. Mikey Board von den «Dubby Conquerors», ein wunderbarer Keyboarder, den ich kennengelernt habe und mit dem ich auch schon mehrmals performen durfte, würde dann das Quintett voll machen. Bandname: «The Legends Playing One Night with Yves».
Hast du zur Zeit einen Ohrwurm? Was machst du dagegen?
Im Moment «Monica Bellucci» von RIN. Haha, ja nichts mache ich dagegen. Ich höre mir den Song jeden Tag sehr oft an. Ich finde das super. Ich kann einen Song, den ich mag, ständig hören!
![]()
Wo kann man dich in Basel antreffen?
Die Feldbergstrasse rauf und runter und danach bei einem Cocktail im Smuk. Ansonsten für ein Konzert in der Kaschemme, an der Classique Night in der Heimat und mit unserer neuen Reihe natürlich im Viertel.
Wie wär’s mal mit…
…einer Brockitour im Kleinbasel, mit anschliessendem feinen Essen im Restaurant Boo an der Klybeckstrasse.
![]()
Wir danken Yves Loekito für das Interview und wünschen ihm auch weiterhin viel Freude, Erfolg und alles Gute für seine Projekte. Wir sind schon gespannt, was er als nächstes ausheckt. Für alle die nicht bis zum nächsten Live-Event warten wollen gibt es auf SoundCloud eine Kostprobe. Reinhören lohnt sich – ein bisschen Sommer im Herbst ist garantiert!
_
von Agnes Leclaire
am 23.10.2017
Fotos
Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär's mal mit einholen.
Was haben Claasilisque Sound, das Coruba Soundsystem und die Schwellheim Band gemeinsam? Sie machen alle gute Laune und versetzen uns mit ihrer Musik in einen exotisch tropischen Rausch wie bei Rum zu Reggae-Rhythmen. Und natürlich Yves Loekito! Er lud uns in seine neu bezogene Wohnung am Erasmusplatz zum Gespräch ein, um über die Liebe zur Musik, Freundschaften und Schicksalsschläge zu sprechen.

Lieber Yves, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Yves Loekito. Ich bin 32 Jahre alt und in Allschwil aufgewachsen. Ich arbeite in Basel hauptberuflich als Sozialarbeiter mit Jugendlichen. Ausserdem bin ich Sänger der Band Schwellheim, ein Mitglied vom Claasilisque Sound und dem Coruba Soundsystem. Ich mache schon seit mehr als 10 Jahren Musik – als Sänger mit der Band und auch als DJ.
Was verbirgt sich genau hinter dem Claasilisque Sound, dem Coruba Soundsystem und der Schwellheim Band?
Claasilique Sound ist ein DJ-Kollektiv, das nach jamaikanischem Vorbild - das heisst mit MC und DJ gleichzeitig – Reggae, Dancehall und zeitgenössische jamaikanische Musik auflegt und Partys oder andere Events veranstaltet, wie z.B. den «Sunday Jerk» bei dem wir sonntags ein BBQ machen und dazu Musik auflegen. Ausserdem nehmen wir auch mit unserem eigenen Truck an den zwei Musikparaden «Beat on the Street» und «Jungle Street Groove» teil, welche sich jedes Jahr abwechseln. Und sonst haben wir natürlich noch regelmässige Bookings in Basel, der restlichen Schweiz und im Ausland.
Das Coruba Soundsystem ist eine neue Partyreihe im Viertel Club, dem ehemaligen Hinterhof, die wir als Claasilique zusammen mit DJ Bazooka ins Leben gerufen haben. Beim Coruba Soundsystem legen wir den Fokus vor allem auf Afrobeat und Dancehall, was bisher super angelaufen ist.
Die Band Schwellheim Band ist eine elfköpfige Mundart Reggae Band, die es mittlerweile mehr als 10 Jahre gibt. Wir haben bereits drei Alben herausgebracht und touren grösstenteils in der Schweiz. In der Band bin ich einer von zwei Sängern.

Du bist also DJ, Sänger – und auch noch Bühnenbauer, kann das sein? Was macht dir am meisten Spass? Und worin liegen für dich die grössten Unterschiede zwischen der Arbeit am DJ-Pult und der Stimme?
(lacht) Ja, im Bauen bin ich nicht so gut. Den „Bühnenbauer” klammern wir lieber einmal aus. Für unsere Trucks haben wir zum Glück viele handwerklich talentierte Freunde die immer am Start sind und auf die jedes mal wieder Verlass ist.
Musik macht mir grundsätzlich sehr viel Spass. Alles was mit Musik zu tun hat. Wenn ich zwischen Singen oder Auflegen entscheiden müsste, wäre das für mich extrem schwer. Das Arbeiten am Pult oder mit der Stimme ist natürlich unterschiedlich und ganz anders. Beides gibt mir auf jeden Fall sehr viel zurück. Das Singen mit einer Band auf Konzerten ist – vom Gefühl und der Liveshow her – für alle Beteiligten noch einmal viel intensiver als das Auflegen. Worum es immer geht ist, den Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln, ihnen Freude zu bereiten und sie zum Tanzen zu bringen. Singen ist auch so intensiv, weil viel Persönliches reinspielt. Ich denke darum kommt beim Singen auch so viel zurück. Das Publikum spürt das und reagiert darauf.
Nun bist du ja meistens nicht alleine anzutreffen. Wann, wie und wo hast du denn deine musikalischen Mitstreiter kennengelernt?
Die Schwellheim Band wurde vor circa 14 Jahren von uns Jungs aus Allschwill gegründet. „Schwellheim” ist ein Übername für Allschwil. Begonnen haben wir in einem kleinen Keller. Kennen tun wir uns alle über die Schule und dann, über die Jahre, sind immer mehr und mehr Leute – auch nicht aus Allschwil – dazugekommen.
Claasilisque ist witziger Weise auch aus Allschwil bzw. von zwei Jungs aus Allschwil gegründet worden. Die Jungs kannte ich von früher und ich bin dann 2012 dazugestossen.

Wie entsteht daraus – über viele Jahre – eine so gute Zusammenarbeit? Hat es dafür viel Disziplin gebraucht?
Ja, es braucht sehr viel Disziplin. Bei allen Crews haben wir zudem untereinander ein sehr gutes Verhältnis. Diese Freundschaft ist die eigentliche Basis für die Projekte. Das ist sehr wichtig. Bei der Schwellheim Band sind wir elf Jungs. Da braucht es auf jeden Fall zudem Kompromissbereitschaft, aber auch Überzeugungskraft. Und manchmal stimmen wir auch ganz simpel und demokratisch ab. Dasselbe gilt für Claasilisque, da müssen wir uns allerdings nur zu dritt finden.
Wie denkst du selbst, ist es so mit dir zusammen zu arbeiten? Welche Punkte sind dir wichtig?
(grinst) Da musst du die Anderen fragen! Was mir wichtig ist oder was mir auch schon andere Leute gesagt haben ist, dass ich harmoniebedürftig bin. Ich achte sehr darauf, dass es allen gut geht, dass auch irgendwo ein guter Vibe herrscht. Sonst bin ich eher ein ruhiger Typ. Ich denke, dass die Anderen diese Ruhe noch an mir schätzen.

Wie hat das bei dir mit der Musik eigentlich angefangen?
Ich habe schon immer gerne unter der Dusche gesungen und auch als Kind schon immer Playback oder Karaoke. In der Schule habe ich auch gesungen. In der Diplommittelschule war ich in einem gemischten Chor. Da habe ich übrigens auch schon mit dem anderen Sänger von der Schwellheim Band angefangen zu singen. Unseren ersten Auftritt auf der Bühne hatten wir dann bei unserer Abschlussfeier. Und danach ging das eigentlich los mit der Schwellheim Band. In meiner Klasse war ich, glaube ich, der Erste mit einem CD-Player und CDs von meinem Vater.
Ein Stück weit habe ich das also auch von meinen Eltern. Meine Mutter spielt auch heute noch in einer Band Akkordeon und mein Dad hat immer schon viel Musik gesammelt. CDs und Platten. Dann ist da noch mein Bruder, der auch musikalisch unterwegs ist.
Gerade macht die Schwellheim Band ja eine Musikpause. Kannst du uns dazu was sagen? Wann kann man von der Band wieder etwas Neues erwarten?
Das ist leider eine tragische Geschichte. Im Mai ist unser zweiter Sänger Dani schwer an einem Infekt erkrankt, der sich im Gehirn ausgebreitet hatte. Daraufhin musste er ins Spital, um behandelt zu werden und braucht nun Zeit um sich wieder zu regenerieren. Das Ganze war ein einschneidendes Erlebnis für uns als Band und auch für mich persönlich. Es stand anfangs gar nicht gut um ihn. Ihm geht es zum Glück aber schon so langsam besser. Die restlichen Bandmitglieder und ich treffen uns nun zur Zeit einfach so zum Jammen, Komponieren und Proben. Livegigs spielen wir aber keine und können daher auch gerade deine Frage nach Neuem von der Band noch nicht beantworten. Wir werden erst einmal warten bis es Dani wieder gut geht und sehen dann wo wir stehen.

Wir von WWMM wünschen Dani auf jeden Fall weiterhin gute Besserung. Du bist nun seit diesem Jahr frisch gebackener Ehemann! Wie hat die Hochzeit dein Leben verändert? Welche Auswirkungen hat das Eheleben auf dich, deine Musik und dein Engagement für deine Projekte?
Jacqueline und ich haben uns eigentlich so kennengelernt, mit all der Musik und den Projekten, ganz in dem kreativen Schaffen, das wir eigentlich auch immer noch machen. So gesehen hatte die Hochzeit keine Auswirkung auf meine Projekte und auf mein Leben ganz grundsätzlich. Es war für mich auf jeden Fall aber ein grosser Schritt, der sich wiederum ganz natürlich angefühlt hat. Wir haben nun eine neue Wohnung. Das Ganze stimmt irgendwie. Aber mega gross geändert hat sich sonst nichts ausser, dass ich ein Ring an meinem Finger trage und einen neuen Nachnamen habe. Mein Geburtsname war für mich nicht so wichtig, was auch der Grund war, warum ich den Familiennamen von meiner Frau angenommen habe. Als Zeichen dafür, dass wir nun gemeinsam, als eine Familie, in dieselbe Richtung gehen. Ja, vielleicht ist alles ein bisschen ernster geworden!
Gibt es etwas, was du mit Schwellheim, alleine oder in einem anderen Kollektiv mit der Musik noch erreichen möchtest?
Grundsätzlich einmal soll es immer weiter gehen. Dass die Kollektive nicht auseinanderbrechen ist mir wichtig. Mit Schwellheim haben wir zudem das Ziel einmal an grossen Open-Airs in der Schweiz aufzutreten. Das steht zumindest auf meiner persönlichen Bucketlist. Und als DJ noch mehr zu touren, wär auch eine coole Sache.

Inspiriert dich die Arbeit als Sozialarbeiter auch zum Musik machen und umgekehrt?
Die Musik ist ein wunderbarer Ausgleich zur Arbeit. Gleichzeitig inspiriert mich aber auch die Arbeit, weil ich ja viel mit Menschen zu tun habe und dabei die Geschichten erlebe, die nur das Leben schreiben kann. Die unterschiedlichen Schicksale, aber auch das Leben allgemein, liefern mir die Inspiration für meine Songtexte. Die Balance zwischen Arbeiten und der Musik sind wie Ying und Yang in meinem Leben.
Was sagst du zur internationalen oder regionalen Musik- und Ausgeh-Szene?
Die regionale Musikszene finde ich extrem spannend. Wir haben viele junge Leute die mit einfachsten Mitteln Musik machen und kreativ sind. Da bin ich dann auch gerne unter den Zuschauern immer in der vordersten Reihe mit dabei. Dabei fällt mir auch oft auf, dass immer mehr Leute nicht bereit sind für Konzerttickets und Kulturangebote im Allgemeinen viel zu zahlen. Das ist sicher eine Diskrepanz, für die es eine Lösung braucht. Das kulturell wahnsinnig breite, zum Teil auch kostenlose, Angebote an Veranstaltungen in Basel ist sicher toll, man darf allerdings auch nicht vergessen, dass oft neben viel Herzblut auch sehr viel Zeit und auch Geld in den Events steckt, was refinanziert werden muss. Viele gute, aber auch sehr kleine Initiativen, die dennoch von jungen Leuten gut besucht sind, fahren daher oft finanziell am unteren Limit.
Singen auf Englisch oder Schweizerdeutsch? Und warum?
Schweizerdeutsch natürlich! Das ist meine Muttersprache, so fühle ich und so kann ich mich am Besten ausdrücken.
Wenn deine Musik ein Cocktail wäre, dann welcher?
Ich glaube, die wäre dann ein Mai Tai. Mit ganz viel Rum und einem kleinen
Schirmchen – stilecht serviert in einer Kokosnuss.

Wenn du eine Band mit international bekannten Musiker aus aller Welt gründen könntest, wie würde die Band heissen, welches Musikgenre würde sie bedienen und vor allem, welche Musiker würdest du wählen?
(lacht) Das ist echt eine schwere Frage! Es muss auf jeden Fall einen Schlagzeuger und einen Bassisten haben. Das wären dann Sly Dunbar und Robert Shakespeare vom Reggae-Duo «Sly & Robbie», die in den 70ern und 80ern massgeblich die Reggae-Rhythmen geprägt haben. Dann bräuchte es noch einen Gitarristen und ein bisschen Rock 'n' Roll, diese Position besetzt dann „the one and only“ Keith Richards. Mikey Board von den «Dubby Conquerors», ein wunderbarer Keyboarder, den ich kennengelernt habe und mit dem ich auch schon mehrmals performen durfte, würde dann das Quintett voll machen. Bandname: «The Legends Playing One Night with Yves».
Hast du zur Zeit einen Ohrwurm? Was machst du dagegen?
Im Moment «Monica Bellucci» von RIN. Haha, ja nichts mache ich dagegen. Ich höre mir den Song jeden Tag sehr oft an. Ich finde das super. Ich kann einen Song, den ich mag, ständig hören!

Wo kann man dich in Basel antreffen?
Die Feldbergstrasse rauf und runter und danach bei einem Cocktail im Smuk. Ansonsten für ein Konzert in der Kaschemme, an der Classique Night in der Heimat und mit unserer neuen Reihe natürlich im Viertel.
Wie wär’s mal mit…
…einer Brockitour im Kleinbasel, mit anschliessendem feinen Essen im Restaurant Boo an der Klybeckstrasse.

Wir danken Yves Loekito für das Interview und wünschen ihm auch weiterhin viel Freude, Erfolg und alles Gute für seine Projekte. Wir sind schon gespannt, was er als nächstes ausheckt. Für alle die nicht bis zum nächsten Live-Event warten wollen gibt es auf SoundCloud eine Kostprobe. Reinhören lohnt sich – ein bisschen Sommer im Herbst ist garantiert!
_
von Agnes Leclaire
am 23.10.2017
Fotos
Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär's mal mit einholen.

Inspiriert dich die Arbeit als Sozialarbeiter auch zum Musik machen und umgekehrt?
Die Musik ist ein wunderbarer Ausgleich zur Arbeit. Gleichzeitig inspiriert mich aber auch die Arbeit, weil ich ja viel mit Menschen zu tun habe und dabei die Geschichten erlebe, die nur das Leben schreiben kann. Die unterschiedlichen Schicksale, aber auch das Leben allgemein, liefern mir die Inspiration für meine Songtexte. Die Balance zwischen Arbeiten und der Musik sind wie Ying und Yang in meinem Leben.
Was sagst du zur internationalen oder regionalen Musik- und Ausgeh-Szene?
Die regionale Musikszene finde ich extrem spannend. Wir haben viele junge Leute die mit einfachsten Mitteln Musik machen und kreativ sind. Da bin ich dann auch gerne unter den Zuschauern immer in der vordersten Reihe mit dabei. Dabei fällt mir auch oft auf, dass immer mehr Leute nicht bereit sind für Konzerttickets und Kulturangebote im Allgemeinen viel zu zahlen. Das ist sicher eine Diskrepanz, für die es eine Lösung braucht. Das kulturell wahnsinnig breite, zum Teil auch kostenlose, Angebote an Veranstaltungen in Basel ist sicher toll, man darf allerdings auch nicht vergessen, dass oft neben viel Herzblut auch sehr viel Zeit und auch Geld in den Events steckt, was refinanziert werden muss. Viele gute, aber auch sehr kleine Initiativen, die dennoch von jungen Leuten gut besucht sind, fahren daher oft finanziell am unteren Limit.
Singen auf Englisch oder Schweizerdeutsch? Und warum?
Schweizerdeutsch natürlich! Das ist meine Muttersprache, so fühle ich und so kann ich mich am Besten ausdrücken.
Wenn deine Musik ein Cocktail wäre, dann welcher?
Ich glaube, die wäre dann ein Mai Tai. Mit ganz viel Rum und einem kleinen
Schirmchen – stilecht serviert in einer Kokosnuss.

Wenn du eine Band mit international bekannten Musiker aus aller Welt gründen könntest, wie würde die Band heissen, welches Musikgenre würde sie bedienen und vor allem, welche Musiker würdest du wählen?
(lacht) Das ist echt eine schwere Frage! Es muss auf jeden Fall einen Schlagzeuger und einen Bassisten haben. Das wären dann Sly Dunbar und Robert Shakespeare vom Reggae-Duo «Sly & Robbie», die in den 70ern und 80ern massgeblich die Reggae-Rhythmen geprägt haben. Dann bräuchte es noch einen Gitarristen und ein bisschen Rock 'n' Roll, diese Position besetzt dann „the one and only“ Keith Richards. Mikey Board von den «Dubby Conquerors», ein wunderbarer Keyboarder, den ich kennengelernt habe und mit dem ich auch schon mehrmals performen durfte, würde dann das Quintett voll machen. Bandname: «The Legends Playing One Night with Yves».
Hast du zur Zeit einen Ohrwurm? Was machst du dagegen?
Im Moment «Monica Bellucci» von RIN. Haha, ja nichts mache ich dagegen. Ich höre mir den Song jeden Tag sehr oft an. Ich finde das super. Ich kann einen Song, den ich mag, ständig hören!

Wo kann man dich in Basel antreffen?
Die Feldbergstrasse rauf und runter und danach bei einem Cocktail im Smuk. Ansonsten für ein Konzert in der Kaschemme, an der Classique Night in der Heimat und mit unserer neuen Reihe natürlich im Viertel.
Wie wär’s mal mit…
…einer Brockitour im Kleinbasel, mit anschliessendem feinen Essen im Restaurant Boo an der Klybeckstrasse.

Wir danken Yves Loekito für das Interview und wünschen ihm auch weiterhin viel Freude, Erfolg und alles Gute für seine Projekte. Wir sind schon gespannt, was er als nächstes ausheckt. Für alle die nicht bis zum nächsten Live-Event warten wollen gibt es auf SoundCloud eine Kostprobe. Reinhören lohnt sich – ein bisschen Sommer im Herbst ist garantiert!
_
von Agnes Leclaire
am 23.10.2017
Fotos
Shirin Zaid für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär's mal mit einholen.
Craft Distillers: Im Gespräch mit Joe Nyfeler und Yves Branchi
Alkohol kann Gift sein, aber auch Genuss, sagen die beiden Köpfe hinter dem Event-Label «Craft Distillers» und die Gründer der ersten Schweizer Spirituosen- und Likörmesse «Swiss Craft Spirits Festival», das am kommenden Wochenende zum zweiten Mal im Gundeldinger Feld über die Bühne geht. Mitten unter der Woche haben wir die zwei Herren, Joe Nyfeler und Yves Branchi, getroffen und mit ihnen über ihr junges Label gesprochen. Getrunken wurde Mate-Eistee.
![]()
Lieber Yves, lieber Joe, wer seid ihr und wer sind die Craft Distillers?
Joe: Wir sind Freunde aus dem Studium – zwei verrückte Typen mit spannenden Ideen – und haben deshalb vor zwei Jahren die Event-Label Craft Distillers «Crafts Distillers» gegründet.
Yves: Die Craft Distillers sind eine Marke, das Events mit Spirituosen organisiert. Dieses Jahr führen die Craft Distillers zum zweiten Mal das einmalige Erlebnis namens «Swiss Craft Spirits Festival» durch.
Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
Joe: An einem Augustsommerabend vor zwei Jahren hat Yves mich angerufen und meinte euphorisch, dass wir uns zusammensetzen müssten, bei Zigarre und Whisky, und Pläne schmieden sollten, ein Projekt in diese Richtung zu verfolgen.
Yves: Joe ist der Whisky-Begeisterte und ich habe damals schon ein bisschen Grappa eines Freundes aus dem Tessin hier in der Region verkauft. Und so kamen wir nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf die Idee, dass wir das unternehmerisch stärker verfolgen könnten. Wir haben dann erst einmal gebrainstormed, querbeet, was wir machen könnten und kamen dann auf die Idee, eine Messe für handgemachte Schweizer Spirituosen und Liköre zu organisieren. Ich bin sehr froh, dass Joe genügend verrückt war, mich mit dieser Idee zu begleiten und wir die Craft Distillers gemeinsam aufbauen.
![]()
Was mögt ihr an eurer Kooperation, was bereitet euch Schwierigkeiten?
Joe: Die Herausforderung ist, dass unsere Tagesrhythmen total verschieden sind. Während Yves inzwischen nur noch für die eigenen Projekte, also für die Craft Distillers und seinen eigenen Nocino, arbeitet, gehe ich einem geregelten Bürojob nach und mache die Arbeit bei den Craft Distillers als Hobby. Dementsprechend bedarf es etwas mehr Koordination und Absprache zwischen den Zuständigkeiten als auch der Verfügbarkeit. Da nehmen wir eigentlich ziemlich stark Rücksicht aufeinander, sonst wird es für uns beide als Team schnell einmal mühsam.
Yves: Ja, genau. Ich habe mich vor anderthalb Jahren entschieden, zur Zeit nur diesen Projekte nachzugehen. Was ich sehr an der Zusammenarbeit mit Joe schätze ist, dass wir aufgrund dieser verschiedenen Hintergründe auch unterschiedlich denken. Verschiedene Meinungen können dann in einer gemeinsamen, geteilten Idee fruchten, die wir weiterverfolgen und die oft ziemlich gut ankommen.
Joe: Was uns verbindet ist der Spirit. Wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet und wollen die Zukunft dieser Idee zusammen meistern. Ich wüsste niemanden, mit dem ich so eng zusammenarbeiten könnte. (Gangsterfistbump) Diesbezüglich sind wir wirklich ziemlich ähnlich: beide fühlen sich gleichermassen verpflichtet an diesem Strang zu ziehen.
Wie seid ihr auf diesen Geschmack gekommen?
Joe: Damals mit 18... (lacht) Was heisst «auf den Geschmack kommen»? Ich hatte mal einen feinen Whisky ausprobiert und gedacht, da gibt’s etwas, das Potenzial hat. Die Craft Distillers legen ihren Fokus ja absichtlich auf Schweizer Produkte, und dabei nicht nur auf Produkte, die gelagert und gereift sind, sondern auch solche, die direkt gebrannt und abgefüllt werden.
Yves: Als gebürtiger Tessiner habe ich Wein- und Grappa-Hersteller in der Familie. Als Exil-Tessiner wurde ich dann gefragt, ob ich die Produkte in der Deutschschweiz verkaufen würde. Eigentlich hatte ich zu Beginn eine andere Idee. Ich wollte einen Webshop mit Tessiner Grappa machen. Dann habe ich immer wieder darüber nachgedacht, inwiefern und wie ich diesen Grappa zu einem Geschäft machen könnte.
![]()
![]()
Wo seht ihr den Mehrwert der Craft Distillers für den Schweizer Spirituosenmarkt und insbesondere für die Region Basel?
Joe: Ich glaube, die Craft Distillers als Eventlabel sind etwas Junges, etwas Dynamisches. Dabei ist unser Geschmack, unser Wunsch die Grundlage der Eventorganisation. Kurzum: wir organisieren das Swiss Craft Spirits Festival so, wie wir es auch toll fänden, wo wir auch hingehen würden. Wir hoffen, dass das der Vorteil für die Branche, aber auch die Region ist. Ich bin aus der Region und ich glaube, so wie ich ticke, ticken noch ein paar Leute hier in der Stadt Basel, bzw. in der Nordwestschweiz.
Yves: Bevor wir angefangen haben, haben wir viel gelesen, dass es dem Spirituosenmarkt in der Schweiz nicht so gut geht. Wir wollten die traditionellen, lokalen Produkte entstauben und zusammen mit trendigen, neuen Produkten präsentieren. In diesem Sinne beabsichtigen wir, die Branche umzukrempeln. Hinzu kommt, dass es einen solchen Anlass noch nirgends in der Schweiz gibt. Es gibt verschiedene Genussmessen, aber eine Messe für Schweizer handgefertigte Spirituosen und Liköre nicht. Von dieser Einmaligkeit kann auch Basel profitieren.
![]()
Wer ist der typische Craft-Aficionado?
Joe: Unsere Besucher sind grundsätzlich neugierig, besitzen Qualitätsbewusstsein, Verständnis für Wertigkeit, sind entdeckungsfreudig – es können Rookies der Spirituosen- und Likörwelt wie auch Kenner sein. Wir gehen davon aus, dass die Besucher Neues einschätzen und beurteilen können oder das zumindest wollen und sich auf neue Geschmacks- und Geruchsrichtungen einlassen will.
Yves: Ich möchte zusätzlich noch auf den Erlebnisaspekt hinweisen. Die Craft Distillers wollen eine Atmosphäre kreieren, in welcher neue Produkte entdeckt werden können und so ein Erlebnis schaffen, das über das Konsumprodukt an sich herausgeht. Das Besucherprofil des letzten Festivals war sehr heterogen, sehr durchmischt im Alter wie auch bezüglich der Interessen und der Kenntnisse. Die Neugierde und das Interesse verbindet den Craft-Aficionado.
Alkohol ist ein eher negativ konnotiertes Genussmittel, wie geht ihr damit um?
Yves: Also wir gehen jetzt... (lacht)
Joe: Ja, das ist ein wichtiges Thema und wird oft stigmatisiert oder gar tabuisiert. Wir denken aber, dass wie bei vielen Genussmitteln, der Umgang damit zentral ist und das Umfeld eine bedeutende Rolle spielt. Beim Alkohol meint das ganz klar die Menge. Unser Fokus gilt gerade der Art und Weise und dem Umfeld des Genussmomentes. Und wir haben ein Auge drauf. Wir wollen Leute ansprechen, die den Sprit nicht einfach runterschütten, sondern ehrlich geniessen, entdecken und ausprobieren wollen. Die Messe ist auf das Qualitätsverständnis, den Genuss des Alkohols ausgerichtet. Wenn man mit Alkohol mit Bedacht umgeht, er genossen wird und die Qualität geschätzt wird, dann kann er durchaus auch eine Bereicherung sein.
Yves: «Alles und nichts ist Gift. Es hängt von der Dosis ab.» Wer hat’s gesagt? Alkohol ist ein Genussmittel und wird seit Jahrtausenden getrunken. Und ja, zu viel ist nicht gut! Aber Geniessen ist eine Qualitäts- und keine Quantitätsfrage. Diese Produkte, die wir promoten, sind nicht solche, die Jugendliche kaufen, um sich zu betrinken.
![]()
Wenn Yves eine Comicfigur wäre, welche wäre das?
Joe: Yves ist wie Tarzan – für ihn ist der Alltagsdschungel ein Abenteuer, wo es überall Neues zu entdecken gibt. Man muss nur die Augen offen halten!
Wenn Joe eine Comicfigur wäre, welche wäre das?
Yves: Lucky Luke – sorgt immer für Recht und Ordnung, mag Abenteuer und ist schnell im Umgang mit dem Colt.
Yves, als Nicht-Basler, was gefällt dir besonders hier? Wann vermisst du das Tessin nicht?
Yves: Was ich in Basel vermisse ist der See. Klar, die Basler sagen: «Wir haben den Rhein!», das sehe ich auch, aber das ist für mich was Anderes. Aber sonst gefällt es mir mega, weil es eine sehr offene, freundliche Stadt ist. Ist auch etwas mehr los hier als im Tessin. Um die Grössenverhältnisse klarzustellen: die ganze Stadt Basel hat ja ungefähr so viele Einwohner wie der Kanton Tessin. Das Klima gefällt mir, das ist ja ähnlich wie im Tessin. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, wieder im Tessin zu leben.
![]()
Was trinkt ihr wo in der Stadt gerne als Aperitif?
Joe: Ich komme gerne hierhin. Ich wohne im Gundeli und das WERK8 ist eine gute Adresse für einen Apéro am Abend, aber auch für Mittagessen oder ein Bier auf der Terrasse. Im Sommer bin ich auch sehr gerne in der Buvette auf dem Bollwerk.
Yves: Mir gefällt die Location vom WERK8 sehr gut und ich finde es toll, dass wir hier auch einen Teil des Swiss Craft Spirits Festival durchführen können. Sonst gehe ich auch gerne in die Baltazar.
...und wo und was nach einem langen Arbeitstag?
Joe: Ein gemütliches Bier
Yves: Noos (Yves eigener Tessiner Walnuss-Likör) – ich bin nicht so der Bier-Typ, und Wein trinke ich vor allem zum Essen. Sonst trinke ich tatsächlich gerne Spirituosen oder Cocktails.
Wenn ihr der König von Basel wärt, was würdet ihr euch für Basel wünschen?
Joe: Ich wünsche mir, dass Basel noch mehr zu einer innovativen, einer kreativen Stadt wird, wo Ideen umgesetzt und ausgelebt werden und proaktiv Möglichkeiten geschaffen werden, dass diese Ideen Realität werden können.
Yves: Als König würde ich den Rhein stauen, sodass wir einen See bekämen. (lacht) Nein, Spass beiseite. Ich wünsche mir nichts Dringliches, ich fühle mich sehr wohl hier.
![]()
![]()
Was habt ihr für die Zukunft geplant, was steht bei den Craft Distillers an?
Joe: Am Wochenende vom 20. & 21. Oktober 2017 findet das nächste Swiss Craft Spirits Festival im WERK8 und den launchlabs statt und das wollen wir reibungslos über die Bühne bringen. Neu bieten wir im Rahmen des Festivals auch Workshops an, an denen du deinen eigenen Gin distillieren und Cocktails mixen lernen kannst oder vertieftes Wissen über Zigarren und Kirsch vermittelt bekommst.
Yves: Das Festival soll zukünftig schweizweit nicht nur mit Genuss, sondern auch mit der Stadt Basel in Verbindung gebracht werden wird.
Joe: ...Isch geil! Gourmet-Gundeli ist das Stichwort!
Wie wär’s mal mit…
Joe: ...einer Rooftop-Bar in Basel?
Yves: ...einem Strand in Basel?
![]()
Ein herzliches Dankeschön an Joe und Yves, die mit Mut und Spürsinn lehren, dass Quantität im Alkohol berauschen, Qualität aber bereichern kann und so auf ihre eigene Art ein Stück Genuss-Geschichte in Basel schreiben. Salute!
_
von Judith Nyfeler und David Schneiter
am 16.10.2017
Fotos
Niels Franke für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär's mal mit einholen.
Alkohol kann Gift sein, aber auch Genuss, sagen die beiden Köpfe hinter dem Event-Label «Craft Distillers» und die Gründer der ersten Schweizer Spirituosen- und Likörmesse «Swiss Craft Spirits Festival», das am kommenden Wochenende zum zweiten Mal im Gundeldinger Feld über die Bühne geht. Mitten unter der Woche haben wir die zwei Herren, Joe Nyfeler und Yves Branchi, getroffen und mit ihnen über ihr junges Label gesprochen. Getrunken wurde Mate-Eistee.

Lieber Yves, lieber Joe, wer seid ihr und wer sind die Craft Distillers?
Joe: Wir sind Freunde aus dem Studium – zwei verrückte Typen mit spannenden Ideen – und haben deshalb vor zwei Jahren die Event-Label Craft Distillers «Crafts Distillers» gegründet.
Yves: Die Craft Distillers sind eine Marke, das Events mit Spirituosen organisiert. Dieses Jahr führen die Craft Distillers zum zweiten Mal das einmalige Erlebnis namens «Swiss Craft Spirits Festival» durch.
Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
Joe: An einem Augustsommerabend vor zwei Jahren hat Yves mich angerufen und meinte euphorisch, dass wir uns zusammensetzen müssten, bei Zigarre und Whisky, und Pläne schmieden sollten, ein Projekt in diese Richtung zu verfolgen.
Yves: Joe ist der Whisky-Begeisterte und ich habe damals schon ein bisschen Grappa eines Freundes aus dem Tessin hier in der Region verkauft. Und so kamen wir nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf die Idee, dass wir das unternehmerisch stärker verfolgen könnten. Wir haben dann erst einmal gebrainstormed, querbeet, was wir machen könnten und kamen dann auf die Idee, eine Messe für handgemachte Schweizer Spirituosen und Liköre zu organisieren. Ich bin sehr froh, dass Joe genügend verrückt war, mich mit dieser Idee zu begleiten und wir die Craft Distillers gemeinsam aufbauen.

Was mögt ihr an eurer Kooperation, was bereitet euch Schwierigkeiten?
Joe: Die Herausforderung ist, dass unsere Tagesrhythmen total verschieden sind. Während Yves inzwischen nur noch für die eigenen Projekte, also für die Craft Distillers und seinen eigenen Nocino, arbeitet, gehe ich einem geregelten Bürojob nach und mache die Arbeit bei den Craft Distillers als Hobby. Dementsprechend bedarf es etwas mehr Koordination und Absprache zwischen den Zuständigkeiten als auch der Verfügbarkeit. Da nehmen wir eigentlich ziemlich stark Rücksicht aufeinander, sonst wird es für uns beide als Team schnell einmal mühsam.
Yves: Ja, genau. Ich habe mich vor anderthalb Jahren entschieden, zur Zeit nur diesen Projekte nachzugehen. Was ich sehr an der Zusammenarbeit mit Joe schätze ist, dass wir aufgrund dieser verschiedenen Hintergründe auch unterschiedlich denken. Verschiedene Meinungen können dann in einer gemeinsamen, geteilten Idee fruchten, die wir weiterverfolgen und die oft ziemlich gut ankommen.
Joe: Was uns verbindet ist der Spirit. Wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet und wollen die Zukunft dieser Idee zusammen meistern. Ich wüsste niemanden, mit dem ich so eng zusammenarbeiten könnte. (Gangsterfistbump) Diesbezüglich sind wir wirklich ziemlich ähnlich: beide fühlen sich gleichermassen verpflichtet an diesem Strang zu ziehen.
Wie seid ihr auf diesen Geschmack gekommen?
Joe: Damals mit 18... (lacht) Was heisst «auf den Geschmack kommen»? Ich hatte mal einen feinen Whisky ausprobiert und gedacht, da gibt’s etwas, das Potenzial hat. Die Craft Distillers legen ihren Fokus ja absichtlich auf Schweizer Produkte, und dabei nicht nur auf Produkte, die gelagert und gereift sind, sondern auch solche, die direkt gebrannt und abgefüllt werden.
Yves: Als gebürtiger Tessiner habe ich Wein- und Grappa-Hersteller in der Familie. Als Exil-Tessiner wurde ich dann gefragt, ob ich die Produkte in der Deutschschweiz verkaufen würde. Eigentlich hatte ich zu Beginn eine andere Idee. Ich wollte einen Webshop mit Tessiner Grappa machen. Dann habe ich immer wieder darüber nachgedacht, inwiefern und wie ich diesen Grappa zu einem Geschäft machen könnte.


Wo seht ihr den Mehrwert der Craft Distillers für den Schweizer Spirituosenmarkt und insbesondere für die Region Basel?
Joe: Ich glaube, die Craft Distillers als Eventlabel sind etwas Junges, etwas Dynamisches. Dabei ist unser Geschmack, unser Wunsch die Grundlage der Eventorganisation. Kurzum: wir organisieren das Swiss Craft Spirits Festival so, wie wir es auch toll fänden, wo wir auch hingehen würden. Wir hoffen, dass das der Vorteil für die Branche, aber auch die Region ist. Ich bin aus der Region und ich glaube, so wie ich ticke, ticken noch ein paar Leute hier in der Stadt Basel, bzw. in der Nordwestschweiz.
Yves: Bevor wir angefangen haben, haben wir viel gelesen, dass es dem Spirituosenmarkt in der Schweiz nicht so gut geht. Wir wollten die traditionellen, lokalen Produkte entstauben und zusammen mit trendigen, neuen Produkten präsentieren. In diesem Sinne beabsichtigen wir, die Branche umzukrempeln. Hinzu kommt, dass es einen solchen Anlass noch nirgends in der Schweiz gibt. Es gibt verschiedene Genussmessen, aber eine Messe für Schweizer handgefertigte Spirituosen und Liköre nicht. Von dieser Einmaligkeit kann auch Basel profitieren.

Wer ist der typische Craft-Aficionado?
Joe: Unsere Besucher sind grundsätzlich neugierig, besitzen Qualitätsbewusstsein, Verständnis für Wertigkeit, sind entdeckungsfreudig – es können Rookies der Spirituosen- und Likörwelt wie auch Kenner sein. Wir gehen davon aus, dass die Besucher Neues einschätzen und beurteilen können oder das zumindest wollen und sich auf neue Geschmacks- und Geruchsrichtungen einlassen will.
Yves: Ich möchte zusätzlich noch auf den Erlebnisaspekt hinweisen. Die Craft Distillers wollen eine Atmosphäre kreieren, in welcher neue Produkte entdeckt werden können und so ein Erlebnis schaffen, das über das Konsumprodukt an sich herausgeht. Das Besucherprofil des letzten Festivals war sehr heterogen, sehr durchmischt im Alter wie auch bezüglich der Interessen und der Kenntnisse. Die Neugierde und das Interesse verbindet den Craft-Aficionado.
Alkohol ist ein eher negativ konnotiertes Genussmittel, wie geht ihr damit um?
Yves: Also wir gehen jetzt... (lacht)
Joe: Ja, das ist ein wichtiges Thema und wird oft stigmatisiert oder gar tabuisiert. Wir denken aber, dass wie bei vielen Genussmitteln, der Umgang damit zentral ist und das Umfeld eine bedeutende Rolle spielt. Beim Alkohol meint das ganz klar die Menge. Unser Fokus gilt gerade der Art und Weise und dem Umfeld des Genussmomentes. Und wir haben ein Auge drauf. Wir wollen Leute ansprechen, die den Sprit nicht einfach runterschütten, sondern ehrlich geniessen, entdecken und ausprobieren wollen. Die Messe ist auf das Qualitätsverständnis, den Genuss des Alkohols ausgerichtet. Wenn man mit Alkohol mit Bedacht umgeht, er genossen wird und die Qualität geschätzt wird, dann kann er durchaus auch eine Bereicherung sein.
Yves: «Alles und nichts ist Gift. Es hängt von der Dosis ab.» Wer hat’s gesagt? Alkohol ist ein Genussmittel und wird seit Jahrtausenden getrunken. Und ja, zu viel ist nicht gut! Aber Geniessen ist eine Qualitäts- und keine Quantitätsfrage. Diese Produkte, die wir promoten, sind nicht solche, die Jugendliche kaufen, um sich zu betrinken.

Wenn Yves eine Comicfigur wäre, welche wäre das?
Joe: Yves ist wie Tarzan – für ihn ist der Alltagsdschungel ein Abenteuer, wo es überall Neues zu entdecken gibt. Man muss nur die Augen offen halten!
Wenn Joe eine Comicfigur wäre, welche wäre das?
Yves: Lucky Luke – sorgt immer für Recht und Ordnung, mag Abenteuer und ist schnell im Umgang mit dem Colt.
Yves, als Nicht-Basler, was gefällt dir besonders hier? Wann vermisst du das Tessin nicht?
Yves: Was ich in Basel vermisse ist der See. Klar, die Basler sagen: «Wir haben den Rhein!», das sehe ich auch, aber das ist für mich was Anderes. Aber sonst gefällt es mir mega, weil es eine sehr offene, freundliche Stadt ist. Ist auch etwas mehr los hier als im Tessin. Um die Grössenverhältnisse klarzustellen: die ganze Stadt Basel hat ja ungefähr so viele Einwohner wie der Kanton Tessin. Das Klima gefällt mir, das ist ja ähnlich wie im Tessin. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, wieder im Tessin zu leben.

Was trinkt ihr wo in der Stadt gerne als Aperitif?
Joe: Ich komme gerne hierhin. Ich wohne im Gundeli und das WERK8 ist eine gute Adresse für einen Apéro am Abend, aber auch für Mittagessen oder ein Bier auf der Terrasse. Im Sommer bin ich auch sehr gerne in der Buvette auf dem Bollwerk.
Yves: Mir gefällt die Location vom WERK8 sehr gut und ich finde es toll, dass wir hier auch einen Teil des Swiss Craft Spirits Festival durchführen können. Sonst gehe ich auch gerne in die Baltazar.
...und wo und was nach einem langen Arbeitstag?
Joe: Ein gemütliches Bier
Yves: Noos (Yves eigener Tessiner Walnuss-Likör) – ich bin nicht so der Bier-Typ, und Wein trinke ich vor allem zum Essen. Sonst trinke ich tatsächlich gerne Spirituosen oder Cocktails.
Wenn ihr der König von Basel wärt, was würdet ihr euch für Basel wünschen?
Joe: Ich wünsche mir, dass Basel noch mehr zu einer innovativen, einer kreativen Stadt wird, wo Ideen umgesetzt und ausgelebt werden und proaktiv Möglichkeiten geschaffen werden, dass diese Ideen Realität werden können.
Yves: Als König würde ich den Rhein stauen, sodass wir einen See bekämen. (lacht) Nein, Spass beiseite. Ich wünsche mir nichts Dringliches, ich fühle mich sehr wohl hier.


Was habt ihr für die Zukunft geplant, was steht bei den Craft Distillers an?
Joe: Am Wochenende vom 20. & 21. Oktober 2017 findet das nächste Swiss Craft Spirits Festival im WERK8 und den launchlabs statt und das wollen wir reibungslos über die Bühne bringen. Neu bieten wir im Rahmen des Festivals auch Workshops an, an denen du deinen eigenen Gin distillieren und Cocktails mixen lernen kannst oder vertieftes Wissen über Zigarren und Kirsch vermittelt bekommst.
Yves: Das Festival soll zukünftig schweizweit nicht nur mit Genuss, sondern auch mit der Stadt Basel in Verbindung gebracht werden wird.
Joe: ...Isch geil! Gourmet-Gundeli ist das Stichwort!
Wie wär’s mal mit…
Joe: ...einer Rooftop-Bar in Basel?
Yves: ...einem Strand in Basel?

Ein herzliches Dankeschön an Joe und Yves, die mit Mut und Spürsinn lehren, dass Quantität im Alkohol berauschen, Qualität aber bereichern kann und so auf ihre eigene Art ein Stück Genuss-Geschichte in Basel schreiben. Salute!
_
von Judith Nyfeler und David Schneiter
am 16.10.2017
Fotos
Niels Franke für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär's mal mit einholen.
Schwarzer Peter: Manuela Jeker und Michel Steiner im Gespräch
Michel Steiner und Manuela Jeker erwarten uns am Montagmorgen gegen zehn Uhr, als wir – nach einem Kaffee vis-à-vis – beim Schwarzen Peter eintreffen. Für ein Gespräch über ihr Wirken als Sozialarbeiter haben wir uns verabredet. Die Beratung und das daran angrenzende autonome Büro im südlichen St. Johann sind für Klienten zu dieser Uhrzeit noch geschlossen. Wir nutzen die Gunst der Stunde und finden heraus, was #Lifeisstreet wirklich bedeutet.
![]()
Michel und Manuela, wer seid ihr und was macht der Schwarze Peter?
Michel: Ich arbeite seit neun Jahren beim Schwarzen Peter als Gassenarbeiter. Der Verein wurde 1983 gegründet – vor einem drittel Jahrhundert war das. Unsere Hauptaufgabe ist die Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlich zugänglichen Raum. Das heisst, wir gehen auf die Strasse und knüpfen da Kontakte mit den Leuten, anstatt zu warten, bis die Leute zu uns finden. Letzteres ist der zweite Teil unserer Arbeit. Wir bieten zweimal pro Woche eine offene Sprechstunde an und jeder darf da mit all seinen Anliegen vorbeikommen. Oft zeigt sich, dass nicht wir die richtigen sind. Der Schwarze Peter erfüllt in solchen Fällen eher eine Vermittlungsfunktion. Das nennen wir Triage. Das dritte Standbein sind verschiedene Aktionen und Projekte. Wir machen ein Grillfest oder organisieren ein Kleidersammeln und -verteilen. Ich denke gerade an Isomatten und Schlafsäcke für den Winter. Unsere vierte Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit und die politische Arbeit – die Kommunikation nach Aussen. Diese ist besonders wichtig, da es nicht ausreicht, den einzelnen Menschen zu helfen. An gewissen Situationen können wir gar nichts ändern und da ist es wichtig, dass wir das gesellschaftlich publizieren können und auch dafür einstehen.
Manuela: Ich bin Manuela und arbeite seit sechs Jahren beim Schwarzen Peter. Seit drei Jahren bin ich als Gassenarbeiterin und in der Co-Geschäftsleitung tätig. Wir sind ein egalitäres Team aus sechs Personen, dabei ist jeder verantwortlich für ein bestimmtes Ressort. Michel kümmert sich um unsere Finanzierung und ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.
![]()
![]()
Was liegt dem Schwarzen Peter für ein Verständnis von Armut zugrunde?
Der Name erinnert an das Kartenspiel, bei dem man den Schwarzen Peter ungewollt zieht und ihn natürlich sofort wieder loswerden will.
Michel: Im Spiel willst du den Schwarzen Peter immer rasch loswerden. Viele wollen unsere Klienten nun mal immer loswerden. Wir nicht. Wir nehmen auch den Schwarzen Peter, wir schieben die Leute eben nicht weiter. Das ist meine persönliche Interpretation.
Manuela: Auf der anderen Seite haben auch unsere Klienten den Schwarzen Peter gezogen. Es ist also eine gewisse Doppeldeutigkeit darin verborgen. Zu Beginn der Geschichte unserer Institution mussten die Gassenarbeiter vielen illegalen Tätigkeiten nachgehen und gegen grosse Windmühlen kämpfen. Dies hat sich gewandelt und wir sind heute als Institution etabliert. Es gibt Leute welche sich stark ab dem Namen Schwarzer Peter entrüsten. Ich denke, das ist ein Stück weit Verdrängung. Es darf ja nicht sein, diese Armut, die darf es ja nicht geben. Zu unserem Verständnis von Armut: Das Spektrum der Betroffenen wird breiter. Vor sechs Jahren zählten vor allem Süchtige und Leute in einem psychisch instabilen Zustand zu unseren Klienten. Heute gibt es vermehrt auch Leute, die eine eigene Firma hatten oder die anderswie in die Armut gerutscht sind. Überdies betreuen wir insgesamt mehr Leute.
Michel: Viel mehr Leute. Auf der Strasse ist es etwa gleich geblieben, hier in der Beratung hat es sich verdreifacht. Es kommen viel mehr Leute hierher, die vor ein paar Jahren noch nicht zu uns gekommen sind.
![]()
Die Aufsuchende Soziale Arbeit ist eure Leitidee. Was versteht ihr darunter?
Michel: Wir arbeiten mit zwei Methoden. Das eine ist, dass wir gezielt an Orte gehen, wo Leute sind, die wir kennen. Wir pflegen Beziehungen beim Claraplatz oder auf der Claramatte oder vor dem Hauptbahnhof. Das sind sogenannte Hotspots. Wir besuchen diese mehrmals wöchentlich. Daneben gibt es die Seismografie, so nennen wir die zweite Methode. Dabei nehmen wir den öffentlichen Raum wahr ohne einzugreifen. Man sieht wo es viele Leute hat, man entdeckt Konsumspuren. Wir stellen vielleicht fest, dass Bänke abgeschraubt wurden. Früher waren sie noch bequem, jetzt hat es plötzlich Sitzbänke, welche bewusst schräg gestaltet sind, also die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes. Im Unterschied zur ersten Variante – wir werden da immer ein Stück weit als Eindringlinge wahrgenommen – ist der Umstand in der zweiten Variante freier.
Manuela: Wobei wir uns niemals aufdrängen. Wenn wir zum Claraplatz gehen und feststellen, dass gewisse Personen uns gar nicht sehen wollen, dann lassen wir diese Leute in Ruhe. Der öffentliche Raum ist für Menschen, welche auf der Strasse leben, ihr Aufenthaltsraum, ihr Wohnzimmer.
Ihr sagt es gibt mehr Leute in der Beratung und gleich viele auf der Strasse. Ist das eine positive Entwicklung?
Michel: Ja und nein. Es nimmt uns auch Zeit weg um rauszugehen. Wir müssen heute aufpassen, dass wir genug Zeit finden, um auf die Strasse zu gehen.
Manuela: Toll ist, dass die Leute hierher kommen. Blöde ist, dass das Spektrum breiter wird. Leute, für die Armut ungewohnt ist, sind oft damit überfordert. Sie schämen sich. In solchen Situationen eine Lösung zu finden, ist oft ganz schwierig.
![]()
![]()
Ihr kommentiert teilweise öffentliche Situationen – häufig sehr direkt und manchmal auch etwas frech – etwa in eurem Printmagazin PETER oder auf Facebook. Gleichzeitig setzt ihr euch regelmässig mit verantwortlichen Politikern dieser Stadt zusammen. Wie gehen diese beiden Dinge einher?
Michel: Einerseits ist der Schwarzer Peter seit einem drittel Jahrhundert unterwegs und hatte immer ein wenig diese Rolle. Angefangen hat es im autonomen Jugendzentrum. Dort hat man die Aufsuchende Sozialarbeit ausprobiert. Einige Jahre später, anfangs-mitte der 80er Jahren gab es hier in Basel die offene Drogenszene, da hatte der Schwarze Peter eine ganz wichtige Rolle. Wir haben Spritzen verteilt, was damals noch verboten war und auf einen runden Tisch für verschiedene Interessenvertreter hingearbeitet. Daraus ist die heutige Viersäulen-Drogenpolitik gewachsen. Der Schwarze Peter hat sich immer klar und deutlich eingesetzt. Um deine Frage zu beantworten: Dass wir solche Dinge ansprechen können, ist einerseits das gewachsene Vertrauen. Die Leute wissen, dass wir gute Arbeit machen und dass wir nicht einfach reklamieren. Andererseits wird von uns erwartet, dass wir mitteilen, was wir da draussen sehen. Wenn das frech klingt, dann hat das damit zu tun, dass ich weiss, dass die Leute wissen, dass ich gute Arbeit leiste. Ein heikles Thema ist ja, dass wir von Stiftungen und Spenden abhängig sind. Viele Organisationen machen in dieser Situation den Mund wenig oder gar nicht auf. Das erleben wir gar nicht so.
Leute ohne Zuhause können bei euch vorübergehend eine Postanschrift erhalten.
Manuela: Im Moment sind bei uns circa 400 Leute angemeldet. Deren ganze Post kommt zu uns. Jemand von uns sortiert diese Briefe, damit unsere Klienten ihre Post abholen können. Diese Adressen brauchen unsere Kunden aber auch, damit Sie im System der Sozialhilfe und der Krankenkassen erfasst sind.
Michel: Wenn jemand nicht mehr auf dieser Liste steht, ist es in den seltensten Fällen weil diese Person eine Wohnung gefunden hat. Häufig kommt es daher, dass sie einige Wochen lang versifft hat, ihre Post zu holen. Wir müssen jede Woche mehrere Leute rausschmeissen und abmelden. Zum Teil kommen Sie wieder und das ist okay. Es gibt auch Leute die einmal kommen und dann nie mehr. Da erleben wir viele Leerläufe. Jede Woche kommen aber auch zwei, drei Leute vorbei, die uns sagen, dass sie eine Wohnung gefunden haben und deshalb die Adresse nicht mehr brauchen. Im Durchschnitt haben die Leute ein Postfach etwa ein halbes Jahr.
![]()
![]()
Von eurer Arbeit zu eurer Chemie: Wisst ihr, wie ihr beide als Team funktioniert?
Manuela: Ich finde wir sind ein gutes Team. Auch in einer Co-Geschäftsleitung ticken nicht alle Leute gleich. Ausgewogen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, beide machen das gleiche, sondern jeder lebt seine Rolle.
Michel: Ich bin vom Typ her sicher mehr als Alphatier unterwegs. Die Chefrolle läuft bei mir einfach automatisch ab. Das ist manchmal anstrengend für die anderen, manchmal ist man aber auch froh darum, dass jemand diese Rolle einnimmt. Ich versuche mich zurückzunehmen. Ich wünsche mir, dass Manuela dominanter ist zwischendurch. Es gibt Situationen, wo ich den Lead übergebe. Wenn das gelingt, ist das sehr angenehm.
Wer von euch beiden ist lustiger?
Manuela: Michel ist sehr witzig.
Michel: Haha. Klassische Witze erzählen kann ich nicht. Aber ich bin schon humorvoll.
![]()
In der Sozialarbeit ist Abgrenzung ein wichtiges Thema. Wie grenzt ihr euch ab?
Michel: Abgrenzen? Begegnungen machen unsere Arbeit schön. Viele Menschen sind eine Bereicherung.
Manuela: Im Grunde genommen schätzen wir ab, ob eine professionelle Beratung möglich und notwendig ist. Können wir keine sinnvolle Unterstützung leisten, so gehen wir weiter. Das hat nichts damit zu tun, Leute abzuschneiden, es gibt einfach Momente wo wir nicht helfen können.
Michel: Genau, wenn mich Leute nur noch konsumieren, wenn sie mir zum zehnten Mal das Gleiche erzählen oder sehr stark betrunken sind und nur noch quasseln, dann gehe ich weiter. Andererseits habe ich echte Freundschaften mit vielen unserer Klienten. Ich sehe das nicht als Abgrenzungsproblem, ich finde das ist natürlich. In Sozikreisen und in Ausbildungen wird dies kritisch betrachtet und als Tabu erkannt. Ich denke aber, dass man offen und reflektiert mit solchen Situation umgehen muss. Trotzdem ist die Psychohygiene wichtig, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den Geschichten dieser Leute hängen bleiben. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man sich nicht zu stark abgrenzt. Es gibt viele Leute die das Vertrauen zu uns haben, weil sie merken, dass wir Menschen sind und nicht nur abgeschottet hinter dem Bürotisch sitzen.
Manuela: Es geht darum, ein würdevolles Leben zu führen. Wir schauen wo eine Person steht und was für diese Person wichtig ist. Manchmal ist gar nicht deren Zeit um aufzuhören mit Drogen. Je nachdem braucht es ganz etwas Anderes. An eine Person zu treten, ohne alles zu Bewerten ist eine Entlastung für beide Seiten.
Gibt es Dinge, die euch nerven bei der Arbeit?
Manuela: Mir geht momentan nichts auf die Nerven.
Michel: 400 Postfächer zu haben finde ich echt nervig. Günstige Wohnungen fehlen. Federführend wäre hierbei der Kanton. Aber es fehlt in erster Linie am politischen Willen. Man kann die Lösung dieses Problems nicht von einzelnen Liegenschaftsverwaltungen erwarten. Die Gesellschaft als ganzes müsste hier klar vorwärts machen. Das ist das eine. Das andere, was für mich sehr anstrengend ist, ist fortwährend dem Geld nachzulaufen. Da musst du Briefe schreiben, Gesuche stellen. Ein tolles Heft machen. Damit die Leute bei den Stiftungen denken: „Ja doch, dem Schwarzen Peter geben wir 10'000, 20'000 Franken.“ Das ist der Teil meines Jobs, auf den ich verzichten könnte. Das ist mein Ressort und das mache ich sehr gut, aber das ist nicht lustig und am Ende des Jahres ist es immer eine knappe Sache. Es zieht Aufmerksamkeit und Energie auf sich, die wir bei unserer Arbeit brauchen könnten.
![]()
Welche Band hört ihr hier im Büro?
Manuela: Les Délicieuse ist eine tolle Band aus Basel, die hören wir gerne. Sie spielen Chanson-Punk. Ihre Musik hören wir immer am Morgen vor der Sitzung.
Michel: Naja. Wir hören hier vor allem ABBA. Schwarzer Peter ist ABBA. Und das Lieblingslied von Manuela ist (singt) DES-PA-SITO.
Wie wärs mal mit?
Manuela: Zahlbarem Wohnraum für alle.
Michel: Mit einem Betriebsausflug nach Hamburg.
![]()
Wir bedanken uns bei Michel und Manuela für das offene Gespräch und den Einblick in ein Vielen unbekanntes Basel. Wir wünschen dem Schwarzen Peter viele herzliche Begegnungen auf der Strasse und im autonomen Büro.
_
von Timon Sutter
am 09.10.2017
Fotos
Caroline Hancox für Wie wär’s mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär's mal mit einholen.
Michel Steiner und Manuela Jeker erwarten uns am Montagmorgen gegen zehn Uhr, als wir – nach einem Kaffee vis-à-vis – beim Schwarzen Peter eintreffen. Für ein Gespräch über ihr Wirken als Sozialarbeiter haben wir uns verabredet. Die Beratung und das daran angrenzende autonome Büro im südlichen St. Johann sind für Klienten zu dieser Uhrzeit noch geschlossen. Wir nutzen die Gunst der Stunde und finden heraus, was #Lifeisstreet wirklich bedeutet.

Michel und Manuela, wer seid ihr und was macht der Schwarze Peter?
Michel: Ich arbeite seit neun Jahren beim Schwarzen Peter als Gassenarbeiter. Der Verein wurde 1983 gegründet – vor einem drittel Jahrhundert war das. Unsere Hauptaufgabe ist die Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlich zugänglichen Raum. Das heisst, wir gehen auf die Strasse und knüpfen da Kontakte mit den Leuten, anstatt zu warten, bis die Leute zu uns finden. Letzteres ist der zweite Teil unserer Arbeit. Wir bieten zweimal pro Woche eine offene Sprechstunde an und jeder darf da mit all seinen Anliegen vorbeikommen. Oft zeigt sich, dass nicht wir die richtigen sind. Der Schwarze Peter erfüllt in solchen Fällen eher eine Vermittlungsfunktion. Das nennen wir Triage. Das dritte Standbein sind verschiedene Aktionen und Projekte. Wir machen ein Grillfest oder organisieren ein Kleidersammeln und -verteilen. Ich denke gerade an Isomatten und Schlafsäcke für den Winter. Unsere vierte Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit und die politische Arbeit – die Kommunikation nach Aussen. Diese ist besonders wichtig, da es nicht ausreicht, den einzelnen Menschen zu helfen. An gewissen Situationen können wir gar nichts ändern und da ist es wichtig, dass wir das gesellschaftlich publizieren können und auch dafür einstehen.
Manuela: Ich bin Manuela und arbeite seit sechs Jahren beim Schwarzen Peter. Seit drei Jahren bin ich als Gassenarbeiterin und in der Co-Geschäftsleitung tätig. Wir sind ein egalitäres Team aus sechs Personen, dabei ist jeder verantwortlich für ein bestimmtes Ressort. Michel kümmert sich um unsere Finanzierung und ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.


Was liegt dem Schwarzen Peter für ein Verständnis von Armut zugrunde?
Der Name erinnert an das Kartenspiel, bei dem man den Schwarzen Peter ungewollt zieht und ihn natürlich sofort wieder loswerden will.
Michel: Im Spiel willst du den Schwarzen Peter immer rasch loswerden. Viele wollen unsere Klienten nun mal immer loswerden. Wir nicht. Wir nehmen auch den Schwarzen Peter, wir schieben die Leute eben nicht weiter. Das ist meine persönliche Interpretation.
Manuela: Auf der anderen Seite haben auch unsere Klienten den Schwarzen Peter gezogen. Es ist also eine gewisse Doppeldeutigkeit darin verborgen. Zu Beginn der Geschichte unserer Institution mussten die Gassenarbeiter vielen illegalen Tätigkeiten nachgehen und gegen grosse Windmühlen kämpfen. Dies hat sich gewandelt und wir sind heute als Institution etabliert. Es gibt Leute welche sich stark ab dem Namen Schwarzer Peter entrüsten. Ich denke, das ist ein Stück weit Verdrängung. Es darf ja nicht sein, diese Armut, die darf es ja nicht geben. Zu unserem Verständnis von Armut: Das Spektrum der Betroffenen wird breiter. Vor sechs Jahren zählten vor allem Süchtige und Leute in einem psychisch instabilen Zustand zu unseren Klienten. Heute gibt es vermehrt auch Leute, die eine eigene Firma hatten oder die anderswie in die Armut gerutscht sind. Überdies betreuen wir insgesamt mehr Leute.
Michel: Viel mehr Leute. Auf der Strasse ist es etwa gleich geblieben, hier in der Beratung hat es sich verdreifacht. Es kommen viel mehr Leute hierher, die vor ein paar Jahren noch nicht zu uns gekommen sind.

Die Aufsuchende Soziale Arbeit ist eure Leitidee. Was versteht ihr darunter?
Michel: Wir arbeiten mit zwei Methoden. Das eine ist, dass wir gezielt an Orte gehen, wo Leute sind, die wir kennen. Wir pflegen Beziehungen beim Claraplatz oder auf der Claramatte oder vor dem Hauptbahnhof. Das sind sogenannte Hotspots. Wir besuchen diese mehrmals wöchentlich. Daneben gibt es die Seismografie, so nennen wir die zweite Methode. Dabei nehmen wir den öffentlichen Raum wahr ohne einzugreifen. Man sieht wo es viele Leute hat, man entdeckt Konsumspuren. Wir stellen vielleicht fest, dass Bänke abgeschraubt wurden. Früher waren sie noch bequem, jetzt hat es plötzlich Sitzbänke, welche bewusst schräg gestaltet sind, also die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes. Im Unterschied zur ersten Variante – wir werden da immer ein Stück weit als Eindringlinge wahrgenommen – ist der Umstand in der zweiten Variante freier.
Manuela: Wobei wir uns niemals aufdrängen. Wenn wir zum Claraplatz gehen und feststellen, dass gewisse Personen uns gar nicht sehen wollen, dann lassen wir diese Leute in Ruhe. Der öffentliche Raum ist für Menschen, welche auf der Strasse leben, ihr Aufenthaltsraum, ihr Wohnzimmer.
Ihr sagt es gibt mehr Leute in der Beratung und gleich viele auf der Strasse. Ist das eine positive Entwicklung?
Michel: Ja und nein. Es nimmt uns auch Zeit weg um rauszugehen. Wir müssen heute aufpassen, dass wir genug Zeit finden, um auf die Strasse zu gehen.
Manuela: Toll ist, dass die Leute hierher kommen. Blöde ist, dass das Spektrum breiter wird. Leute, für die Armut ungewohnt ist, sind oft damit überfordert. Sie schämen sich. In solchen Situationen eine Lösung zu finden, ist oft ganz schwierig.


Ihr kommentiert teilweise öffentliche Situationen – häufig sehr direkt und manchmal auch etwas frech – etwa in eurem Printmagazin PETER oder auf Facebook. Gleichzeitig setzt ihr euch regelmässig mit verantwortlichen Politikern dieser Stadt zusammen. Wie gehen diese beiden Dinge einher?
Michel: Einerseits ist der Schwarzer Peter seit einem drittel Jahrhundert unterwegs und hatte immer ein wenig diese Rolle. Angefangen hat es im autonomen Jugendzentrum. Dort hat man die Aufsuchende Sozialarbeit ausprobiert. Einige Jahre später, anfangs-mitte der 80er Jahren gab es hier in Basel die offene Drogenszene, da hatte der Schwarze Peter eine ganz wichtige Rolle. Wir haben Spritzen verteilt, was damals noch verboten war und auf einen runden Tisch für verschiedene Interessenvertreter hingearbeitet. Daraus ist die heutige Viersäulen-Drogenpolitik gewachsen. Der Schwarze Peter hat sich immer klar und deutlich eingesetzt. Um deine Frage zu beantworten: Dass wir solche Dinge ansprechen können, ist einerseits das gewachsene Vertrauen. Die Leute wissen, dass wir gute Arbeit machen und dass wir nicht einfach reklamieren. Andererseits wird von uns erwartet, dass wir mitteilen, was wir da draussen sehen. Wenn das frech klingt, dann hat das damit zu tun, dass ich weiss, dass die Leute wissen, dass ich gute Arbeit leiste. Ein heikles Thema ist ja, dass wir von Stiftungen und Spenden abhängig sind. Viele Organisationen machen in dieser Situation den Mund wenig oder gar nicht auf. Das erleben wir gar nicht so.
Leute ohne Zuhause können bei euch vorübergehend eine Postanschrift erhalten.
Manuela: Im Moment sind bei uns circa 400 Leute angemeldet. Deren ganze Post kommt zu uns. Jemand von uns sortiert diese Briefe, damit unsere Klienten ihre Post abholen können. Diese Adressen brauchen unsere Kunden aber auch, damit Sie im System der Sozialhilfe und der Krankenkassen erfasst sind.
Michel: Wenn jemand nicht mehr auf dieser Liste steht, ist es in den seltensten Fällen weil diese Person eine Wohnung gefunden hat. Häufig kommt es daher, dass sie einige Wochen lang versifft hat, ihre Post zu holen. Wir müssen jede Woche mehrere Leute rausschmeissen und abmelden. Zum Teil kommen Sie wieder und das ist okay. Es gibt auch Leute die einmal kommen und dann nie mehr. Da erleben wir viele Leerläufe. Jede Woche kommen aber auch zwei, drei Leute vorbei, die uns sagen, dass sie eine Wohnung gefunden haben und deshalb die Adresse nicht mehr brauchen. Im Durchschnitt haben die Leute ein Postfach etwa ein halbes Jahr.


Von eurer Arbeit zu eurer Chemie: Wisst ihr, wie ihr beide als Team funktioniert?
Manuela: Ich finde wir sind ein gutes Team. Auch in einer Co-Geschäftsleitung ticken nicht alle Leute gleich. Ausgewogen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, beide machen das gleiche, sondern jeder lebt seine Rolle.
Michel: Ich bin vom Typ her sicher mehr als Alphatier unterwegs. Die Chefrolle läuft bei mir einfach automatisch ab. Das ist manchmal anstrengend für die anderen, manchmal ist man aber auch froh darum, dass jemand diese Rolle einnimmt. Ich versuche mich zurückzunehmen. Ich wünsche mir, dass Manuela dominanter ist zwischendurch. Es gibt Situationen, wo ich den Lead übergebe. Wenn das gelingt, ist das sehr angenehm.
Wer von euch beiden ist lustiger?
Manuela: Michel ist sehr witzig.
Michel: Haha. Klassische Witze erzählen kann ich nicht. Aber ich bin schon humorvoll.

In der Sozialarbeit ist Abgrenzung ein wichtiges Thema. Wie grenzt ihr euch ab?
Michel: Abgrenzen? Begegnungen machen unsere Arbeit schön. Viele Menschen sind eine Bereicherung.
Manuela: Im Grunde genommen schätzen wir ab, ob eine professionelle Beratung möglich und notwendig ist. Können wir keine sinnvolle Unterstützung leisten, so gehen wir weiter. Das hat nichts damit zu tun, Leute abzuschneiden, es gibt einfach Momente wo wir nicht helfen können.
Michel: Genau, wenn mich Leute nur noch konsumieren, wenn sie mir zum zehnten Mal das Gleiche erzählen oder sehr stark betrunken sind und nur noch quasseln, dann gehe ich weiter. Andererseits habe ich echte Freundschaften mit vielen unserer Klienten. Ich sehe das nicht als Abgrenzungsproblem, ich finde das ist natürlich. In Sozikreisen und in Ausbildungen wird dies kritisch betrachtet und als Tabu erkannt. Ich denke aber, dass man offen und reflektiert mit solchen Situation umgehen muss. Trotzdem ist die Psychohygiene wichtig, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den Geschichten dieser Leute hängen bleiben. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man sich nicht zu stark abgrenzt. Es gibt viele Leute die das Vertrauen zu uns haben, weil sie merken, dass wir Menschen sind und nicht nur abgeschottet hinter dem Bürotisch sitzen.
Manuela: Es geht darum, ein würdevolles Leben zu führen. Wir schauen wo eine Person steht und was für diese Person wichtig ist. Manchmal ist gar nicht deren Zeit um aufzuhören mit Drogen. Je nachdem braucht es ganz etwas Anderes. An eine Person zu treten, ohne alles zu Bewerten ist eine Entlastung für beide Seiten.
Gibt es Dinge, die euch nerven bei der Arbeit?
Manuela: Mir geht momentan nichts auf die Nerven.
Michel: 400 Postfächer zu haben finde ich echt nervig. Günstige Wohnungen fehlen. Federführend wäre hierbei der Kanton. Aber es fehlt in erster Linie am politischen Willen. Man kann die Lösung dieses Problems nicht von einzelnen Liegenschaftsverwaltungen erwarten. Die Gesellschaft als ganzes müsste hier klar vorwärts machen. Das ist das eine. Das andere, was für mich sehr anstrengend ist, ist fortwährend dem Geld nachzulaufen. Da musst du Briefe schreiben, Gesuche stellen. Ein tolles Heft machen. Damit die Leute bei den Stiftungen denken: „Ja doch, dem Schwarzen Peter geben wir 10'000, 20'000 Franken.“ Das ist der Teil meines Jobs, auf den ich verzichten könnte. Das ist mein Ressort und das mache ich sehr gut, aber das ist nicht lustig und am Ende des Jahres ist es immer eine knappe Sache. Es zieht Aufmerksamkeit und Energie auf sich, die wir bei unserer Arbeit brauchen könnten.

Welche Band hört ihr hier im Büro?
Manuela: Les Délicieuse ist eine tolle Band aus Basel, die hören wir gerne. Sie spielen Chanson-Punk. Ihre Musik hören wir immer am Morgen vor der Sitzung.
Michel: Naja. Wir hören hier vor allem ABBA. Schwarzer Peter ist ABBA. Und das Lieblingslied von Manuela ist (singt) DES-PA-SITO.
Wie wärs mal mit?
Manuela: Zahlbarem Wohnraum für alle.
Michel: Mit einem Betriebsausflug nach Hamburg.

Wir bedanken uns bei Michel und Manuela für das offene Gespräch und den Einblick in ein Vielen unbekanntes Basel. Wir wünschen dem Schwarzen Peter viele herzliche Begegnungen auf der Strasse und im autonomen Büro.
_
von Timon Sutter
am 09.10.2017
Fotos
Caroline Hancox für Wie wär’s mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär's mal mit einholen.
Curated: Im Gespräch mit Samuel Seemann
Manchmal braucht es einen Perspektivenwechsel um im gewohnten Alltag das Besondere zu entdecken. Der in Zürich lebende Ostschweizer Samuel Wolfgang Seemann gewinnt Distanz in Athen und erschafft mit seinem Partner Deny Ammann Überblick und Aktualität in der Kunst. Curated ist ein Kunst-Assistent für global und hyperlokale Kunstnews in Echzeit. Wir sprachen mit dem Co-Entwickler über Kunst, Basel und über Sterling Kruger.
![]()
Lieber Sam, wer bist du und mit was füllst du dein Leben?
Ich wohne seit 2008 in Zürich und fülle meinen Tag hauptsächlich mit dem Konzipieren und Umsetzen von Websites, Web-Apps und digitalen Prototypen – und mit Kunst.
Ich bin ziemlich rastlos und möchte immer Neues lernen. In der Kunst sehe ich einen Ausgleich und Ergänzung. Ich lerne Neues, kann mich aber gleichzeitig vom Alltag abkapseln.
Wie war deine Zeit in Athen und was waren Beweggründe für diesen temporären Ortswechsel?
Nachdem ich mich entschlossen hatte meinen Job als Berater in der Werbung zu kündigen und mich selbstständig zu machen, offenbarte sich die Option für drei Monate gemeinsam mit
Amanda, Nonda, Jolly und Lucia in Exarchia, dem anarchischen Herzen von Athen zu leben. Das war eine tolle Zeit mit wundervoll inspirierenden Menschen. Dort habe ich dann das MVP (Minimum Viable Product) von Curated fertiggestellt. Mittlerweile ist Curated für die ganze Schweiz, Athen und weitere Städte wie Berlin, Paris, London, New York und Los Angeles verfügbar.
![]()
![]()
Kannst du uns mehr zu «Curated» erzählen?
Mein Partner Deny und ich haben noch vor meinem Athen-Aufenthalt angefangen an Curated zu arbeiten. Wir haben begonnen (möglichst) alle Kunstinstitutionen – also Offspaces, Galerien und Museen – auf der Welt zu indizieren und geo-basiert aufzubereiten. Curated ist gleichzeitig eine Community in Form einer Website, Instagram Feed und Facebook Chat-Bot. Mit Curated kann man Kunstnews von mehr als 25 Publishern lesen kann und gleichzeitig GPS-basiert Institutionen auf der ganzen Welt finden und sich erkundigen was dort stattfindet. Die Idee von Curated ist mit digitalen Mitteln die soziale und kulturelle Relevanz von Kunstinstitutionen zu fördern. Die Öffentlichkeitsarbeit für Kunstinstitutionen gestaltet sich je länger desto schwieriger. Wer keine grossen monetären Mittel (für Werbung) zur Verfügung hat, wird über den harten Kern hinaus nicht gehört. Curated soll hier Abhilfe schaffen und das globale und hyperlokale Kunstgeschehen in Echtzeit an das Publikum bringen.
![]()
Was hat Basel für eine Bedeutung für «Curated» und umgekehrt?
Basel besitzt eine extreme Dichte an Kunstinstitutionen mit einem abwechslungsreichen Programm und ist nicht zuletzt wegen der unzähligen Museen, der Mäzene, Art Basel und der LISTE Art Fair ein sehr wichtiger Kunststandort. Wusstet ihr, dass es in Basel 40 Museen und je etwa 30 Galerien und Offspaces gibt? Wir starten demnächst mit der Private Beta für Curated, wo Institutionen direkt über die Plattform Events und News veröffentlichen können. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen auch mit Basler Institutionen zusammenarbeiten zu dürfen.
Was sind deine Lieblingsorte in Basel?
Mein Lieblingsort ist in der Feldbergstrasse 89 – ISBILIR. Basel liebe ich für die Kunst und diesen Döner!
![]()
![]()
Wenn du dir ein Werk als Geschenk aussuchen könntest, welches wäre dieses und weshalb?
Ich würde mir Erwin Wurm's 'Curry Bus' aussuchen. So könnte ich wortwörtlich mit der Kunst leben und selbstgemachtes Bibimbap als Take-Away verkaufen, falls ich einmal knapp bei Kasse sein sollte.
Du bist Gastgeber und darfst sechs Künstler – auch verstorbene – zum Abendmahl einladen, wer würde eine Einladungskarte erhalten und weshalb?
Diego Velázquez, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Frida Khalo, Jenny Holzer und Sterling Ruby. Weil ich gespannt wäre auf eine Gesprächsrunde darüber, warum Marcel Duchamp's Schweigen überbewertet ist oder ob für Velázquez die Energieeffizienz von Jenny Holzer's Installationen eine Rolle spielt. Sterling Ruby würde dann Frida Kahlo an Raf Simons vermitteln, was für eine wunderbare Kollektion!
![]()
Und was stünde auf dem Menu und welche Musik liefe im Hintergrund, wie wäre das ganze Setting im Allgemeinen?
Weil James Turrell dann gerade eine Ausstellung für das MoMA PS1 vorbereitet, hat er uns netterweise seinen Roden Crater zur Verfügung gestellt. Da darf es nicht zu fettig zu und her gehen, denn das Abzugssystem ist noch nicht fertig ausgebaut. Deshalb interpretiert Nobuyuki Matsuhisa Gerichte zum Live-Jam von BadBadNotGood.
Welche Ausstellung/Museum hat dir am meisten imponiert?
Oh, da gibt es einige, aber wenn ich mich auf jüngere Ausstellungen und Orte die ich besucht habe festlegen müsste, dann wäre es das Louisiana Museum in der Nähe von Kopenhagen, die Sammlung Boros in Berlin, die Ausstellung von Sterling Ruby im Belvedere Museum Wien und vor kurzem Tomás Saraceno im Haus Konstruktiv Zürich.
![]()
![]()
Nebst Curated gibt es noch das Projekt Sterling Kruger,
kannst du uns dazu noch was sagen?
Sterling Kruger ist ein Experiment. Hauptsächlich ist es ein Instagram-Account welcher jeweils zwei Künstler, die ähnliche Materialien, Überlegungen oder Aussagen teilen einander gegenüberstellt. Dazu gehören aber auch reale Interventionen wie beispielsweise unser erster Release: Wir haben Champion- und Hanes-Sweater mit Namen von Museen bedruckt. Es geht darum Perspektiven zu verschieben – herauszufinden, ob ein Museum das nächste Supreme sein kann. Das kam sehr gut an und wir haben sogar erste Kollaborationsgespräche. Die nächste Intervention steht schon an und befasst sich mit längst verstorbenen Grössen der Malerei. Wir verbinden den White Cube mit einer DIY-Kultur und versuchen so das Interesse an Kunst auch in einer jüngeren Generation zu wecken.
Wie wär's mal mit…?
...tief einatmen, ausatmen, den Moment geniessen und weitermachen.
![]()
Wir danken Sam für das inspirierende Gespräch und dafür, dass er uns einmal mehr aufzeigt, dass eine kleine Auszeit oder ein Tapetenwechsel keinen Stillstand auslöst, sondern uns lehrt aus bereits Vorhandenem etwas Einzigartiges und Kreatives zu schaffen.
_
von Derya Cukadar
am 02.10.2017
Fotos
© Samuel Wolfgang Seemann
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Samuel Seemann einholen.
Manchmal braucht es einen Perspektivenwechsel um im gewohnten Alltag das Besondere zu entdecken. Der in Zürich lebende Ostschweizer Samuel Wolfgang Seemann gewinnt Distanz in Athen und erschafft mit seinem Partner Deny Ammann Überblick und Aktualität in der Kunst. Curated ist ein Kunst-Assistent für global und hyperlokale Kunstnews in Echzeit. Wir sprachen mit dem Co-Entwickler über Kunst, Basel und über Sterling Kruger.
Lieber Sam, wer bist du und mit was füllst du dein Leben?
Ich wohne seit 2008 in Zürich und fülle meinen Tag hauptsächlich mit dem Konzipieren und Umsetzen von Websites, Web-Apps und digitalen Prototypen – und mit Kunst.
Ich bin ziemlich rastlos und möchte immer Neues lernen. In der Kunst sehe ich einen Ausgleich und Ergänzung. Ich lerne Neues, kann mich aber gleichzeitig vom Alltag abkapseln.
Wie war deine Zeit in Athen und was waren Beweggründe für diesen temporären Ortswechsel?
Nachdem ich mich entschlossen hatte meinen Job als Berater in der Werbung zu kündigen und mich selbstständig zu machen, offenbarte sich die Option für drei Monate gemeinsam mit
Amanda, Nonda, Jolly und Lucia in Exarchia, dem anarchischen Herzen von Athen zu leben. Das war eine tolle Zeit mit wundervoll inspirierenden Menschen. Dort habe ich dann das MVP (Minimum Viable Product) von Curated fertiggestellt. Mittlerweile ist Curated für die ganze Schweiz, Athen und weitere Städte wie Berlin, Paris, London, New York und Los Angeles verfügbar.
Kannst du uns mehr zu «Curated» erzählen?
Mein Partner Deny und ich haben noch vor meinem Athen-Aufenthalt angefangen an Curated zu arbeiten. Wir haben begonnen (möglichst) alle Kunstinstitutionen – also Offspaces, Galerien und Museen – auf der Welt zu indizieren und geo-basiert aufzubereiten. Curated ist gleichzeitig eine Community in Form einer Website, Instagram Feed und Facebook Chat-Bot. Mit Curated kann man Kunstnews von mehr als 25 Publishern lesen kann und gleichzeitig GPS-basiert Institutionen auf der ganzen Welt finden und sich erkundigen was dort stattfindet. Die Idee von Curated ist mit digitalen Mitteln die soziale und kulturelle Relevanz von Kunstinstitutionen zu fördern. Die Öffentlichkeitsarbeit für Kunstinstitutionen gestaltet sich je länger desto schwieriger. Wer keine grossen monetären Mittel (für Werbung) zur Verfügung hat, wird über den harten Kern hinaus nicht gehört. Curated soll hier Abhilfe schaffen und das globale und hyperlokale Kunstgeschehen in Echtzeit an das Publikum bringen.
Was hat Basel für eine Bedeutung für «Curated» und umgekehrt?
Basel besitzt eine extreme Dichte an Kunstinstitutionen mit einem abwechslungsreichen Programm und ist nicht zuletzt wegen der unzähligen Museen, der Mäzene, Art Basel und der LISTE Art Fair ein sehr wichtiger Kunststandort. Wusstet ihr, dass es in Basel 40 Museen und je etwa 30 Galerien und Offspaces gibt? Wir starten demnächst mit der Private Beta für Curated, wo Institutionen direkt über die Plattform Events und News veröffentlichen können. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen auch mit Basler Institutionen zusammenarbeiten zu dürfen.
Was sind deine Lieblingsorte in Basel?
Mein Lieblingsort ist in der Feldbergstrasse 89 – ISBILIR. Basel liebe ich für die Kunst und diesen Döner!
Wenn du dir ein Werk als Geschenk aussuchen könntest, welches wäre dieses und weshalb?
Ich würde mir Erwin Wurm's 'Curry Bus' aussuchen. So könnte ich wortwörtlich mit der Kunst leben und selbstgemachtes Bibimbap als Take-Away verkaufen, falls ich einmal knapp bei Kasse sein sollte.
Du bist Gastgeber und darfst sechs Künstler – auch verstorbene – zum Abendmahl einladen, wer würde eine Einladungskarte erhalten und weshalb?
Diego Velázquez, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Frida Khalo, Jenny Holzer und Sterling Ruby. Weil ich gespannt wäre auf eine Gesprächsrunde darüber, warum Marcel Duchamp's Schweigen überbewertet ist oder ob für Velázquez die Energieeffizienz von Jenny Holzer's Installationen eine Rolle spielt. Sterling Ruby würde dann Frida Kahlo an Raf Simons vermitteln, was für eine wunderbare Kollektion!
Und was stünde auf dem Menu und welche Musik liefe im Hintergrund, wie wäre das ganze Setting im Allgemeinen?
Weil James Turrell dann gerade eine Ausstellung für das MoMA PS1 vorbereitet, hat er uns netterweise seinen Roden Crater zur Verfügung gestellt. Da darf es nicht zu fettig zu und her gehen, denn das Abzugssystem ist noch nicht fertig ausgebaut. Deshalb interpretiert Nobuyuki Matsuhisa Gerichte zum Live-Jam von BadBadNotGood.
Welche Ausstellung/Museum hat dir am meisten imponiert?
Oh, da gibt es einige, aber wenn ich mich auf jüngere Ausstellungen und Orte die ich besucht habe festlegen müsste, dann wäre es das Louisiana Museum in der Nähe von Kopenhagen, die Sammlung Boros in Berlin, die Ausstellung von Sterling Ruby im Belvedere Museum Wien und vor kurzem Tomás Saraceno im Haus Konstruktiv Zürich.

Nebst Curated gibt es noch das Projekt Sterling Kruger,
kannst du uns dazu noch was sagen?
Sterling Kruger ist ein Experiment. Hauptsächlich ist es ein Instagram-Account welcher jeweils zwei Künstler, die ähnliche Materialien, Überlegungen oder Aussagen teilen einander gegenüberstellt. Dazu gehören aber auch reale Interventionen wie beispielsweise unser erster Release: Wir haben Champion- und Hanes-Sweater mit Namen von Museen bedruckt. Es geht darum Perspektiven zu verschieben – herauszufinden, ob ein Museum das nächste Supreme sein kann. Das kam sehr gut an und wir haben sogar erste Kollaborationsgespräche. Die nächste Intervention steht schon an und befasst sich mit längst verstorbenen Grössen der Malerei. Wir verbinden den White Cube mit einer DIY-Kultur und versuchen so das Interesse an Kunst auch in einer jüngeren Generation zu wecken.
Wie wär's mal mit…?
...tief einatmen, ausatmen, den Moment geniessen und weitermachen.
Wir danken Sam für das inspirierende Gespräch und dafür, dass er uns einmal mehr aufzeigt, dass eine kleine Auszeit oder ein Tapetenwechsel keinen Stillstand auslöst, sondern uns lehrt aus bereits Vorhandenem etwas Einzigartiges und Kreatives zu schaffen.
_
von Derya Cukadar
am 02.10.2017
Fotos
© Samuel Wolfgang Seemann
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Samuel Seemann einholen.
1.1 Space for Zeitgeist: Deborah Holman und Roberto Ronzani im Gespräch
Von wegen die Jugend von heutzutage. Dass man im jungen Alter auch aktiv etwas zur Kultur beitragen kann, beweisen Deborah Holman und Roberto Ronzani mit ihrem Projekt 1.1 Space for Zeitgeist. Und dass die Medien einen dabei nicht verblöden lassen ebenso: Die beiden nutzen nämlich diverse soziale Medien, um ihren realen Ausstellungsraum und dessen Inhalte Menschen ortsunabhängig zugänglich zu machen. Passend zum digitalen Hype ist auch ihr Konzept, denn: Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Was die beiden uns zu erzählen haben, wo sie überall zu finden sind und was Rihanna und Sita Abellan damit zu tun haben, erfahrt ihr im Folgenden.
![]()
Liebe Deborah, lieber Roberto wer oder was ist 1.1 Space for Zeitgeist?
Deborah: Das 1.1 ist ein Raum für Zeitgeist, in dem monatlich Ausstellungen von jungen Künstlern stattfinden. Dieser wird von mir, Deborah Holman gemeinsam mit Roberto Ronzani geführt. Wir sind selber auch Künstler und sehen uns deshalb nicht als Kuratoren an.
Roberto: Dito. Zurzeit befinden wir uns im Kulturhaus R105 an der Reinacherstrasse 105 in Basel.
Seit wann existiert das Ganze?
Deborah: Die Idee entstand etwa im Mai 2015. Bis dann aber die erste Ausstellung stattfand wurde es Oktober 2015.
Roberto: Ich glaube Deborah hatte die Idee schon längere Zeit im Hinterkopf. Mit meiner Anfrage auszustellen ergab sich eine passende Möglichkeit, das Ganze umzusetzen.
![]()
![]()
Weshalb ist so ein Ort in Basel gut aufgehoben?
Deborah: Dass der Raum in Basel ist, spielt eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle, insofern, dass wir oft über das Internet Ausstellende scouten und viel Content vor allem auf unseren Instagram Account stellen, sodass auch Leute, die nicht vor Ort sind daran teilhaben können. Natürlich sind wir aber dennoch sehr gerne in Basel. Ich kann mir diesen Raum, so wie er jetzt ist, in keiner anderen Stadt vorstellen, da es hier eine lange Geschichte an Off-Spaces gibt und ich selbst aus der Region komme.
Roberto: Ich glaube, dass Basel so eine Plattform nötig hat, es tut der Stadt gut. Wir kennen viele Leute, die allein oder in kleinen Kreisen ihre Projekte realisieren und nur mit wenigen Leuten teilen. Unsere Idee ist es, diese Leute zusammenzubringen, sodass Neues entstehen kann.
![]()
Wo in Basel treibt ihr euch gerne rum?
Deborah: Das Kleinbasel gefällt mir sehr, da es so vielfältig ist. Aber auch das Dreispitz-Areal ganz in unserer Nähe mit dem Oslo 10, dem H3K und dem Offcut, und die Kaschemme in der Breite sind tolle Orte.
Roberto: Ja, diese gefallen mir auch. Ich bin zusätzlich ein Fan vom Ausstellungsraum Klingental und natürlich der Kunsthalle Basel. Es interessieren mich aber auch Orte, an denen sich Leute noch kurz nach der Schule oder der Arbeit treffen.
Ihr seid online sehr präsent. Was gibt's da nebst eurem Instagram Account sonst noch?
Deborah: Mittlerweile haben wir unseren Tumblr Blog gelauncht und unseren Soundcloud Account mit einem Weihnachtsmix von Boeystraat eingeweiht.
Roberto: Auf’s neue Jahr 2016 kommt dann die Webseite dazu.
![]()
Wie kam es zur Namensgebung 1.1 Space for Zeitgeist?
Deborah: Ganz einfach: Laut Grundrissplan des Gebäudes befinden wir uns im Raum 1.1.
Wer hat bisher alles so bei euch ausgestellt?
Deborah: Bisher hat Roberto Ronzani als Erster im Oktober/November 2015 ausgestellt. Weiter geht’s dann im Januar 2016.
Zur vergangenen Ausstellung “Confused by being confused” von Roberto Ronzani – wie kam es dazu und was war das Konzept dahinter?
Deborah: Roberto kam im Mai 2015 auf mich zu und hat mich gefragt, ob er im 1.1 ausstellen dürfe. Damals habe ich den Raum noch als Atelier genutzt. Ich fand es eine tolle Idee und seine Arbeiten sowie das Konzept für CBBC gefielen mir sehr gut. So hat sich dann auch gleich die Idee zur gemeinsamen Gründung des 1.1 entwickelt.
Roberto: Ich schuf im Ausstellungsraum mit Gemälden, Zeichnungen und Objekten eine adoleszente Stimmung, es sollte sich so anfühlen, als würde man das Zimmer eines Teenagers betreten. Alles war sehr dicht angeordnet und sah spontan platziert aus. Teenage Angst und pubertäre Verwirrungen sind Themen, mit denen ich mich auseinandersetze.
![]()
Wie wählt ihr die ausstellenden Künstler aus?
Deborah: Wir haben keinen fixen Kriterienkatalog. Bis jetzt haben wir uns vor allem auf Instagram umgeschaut und Freunde und Bekannte angesprochen, von denen wir behaupten, dass sie dem Zeitgeist unserer Generation, die mit Internet und grösstenteils mit sozialen Medien aufgewachsen ist, entsprechen. Es ist uns wichtig, dass es Abwechslung gibt und nicht nur ein Medium vertreten wird.
![]()
Wer stellt als Nächstes aus?
Deborah: Ende Januar wird Manuela Soto bei uns sein und an der Vernissage der Museumsnacht am 22. Januar und am 23. Januar 2015 tätowieren. Ihre Zeichnungen, Flashes und Drucke werden während 22.1. - 30.1.2015 ausgestellt und von ihr bedruckte Kleidungsstücke und Zines zu kaufen sein.
![]()
![]()
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Deborah: Wir kennen ihre Arbeit von Instagram und haben sie angeschrieben. Sie war von Anfang an dabei.
Weshalb sollte euch unsere Leserschaft unbedingt besuchen kommen?
Deborah: Kommt einfach vorbei und findet es am Besten selber raus.
![]()
Wenn 1.1 Space for Zeitgeist essbar wäre, was wäre es?
Deborah: Ein Buffet mit allen möglichen Gerichten und Küchen – alles selbst gekocht.
Roberto: Es wäre ein frischer Fruchtsalat mit Schärfe.
Wie wär’s mal mit...
Deborah: …sich an der Museumsnacht #shlagtatts tätowieren lassen!
Roberto: …Pizza.
![]()
Wir danken Deborah und Roberto für die Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere Ausstellungen im Namen des Zeitgeistes. Rihanna's Gangsterfreundin und Selfiequeen Sita Abellan, welche im Musikvideo zu Bitch Better Have My Money mitwirkt, hat ein Soto Manga Tattoo – besuch auch du Deborah, Roberto und Manuela Soto im Januar 2016 und lass dir dein eigenes stechen.
_
von Ana Brankovic
am 28.12.2015
Fotos
© 1.1 Space for Zeitgeist und Instagram
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei 1.1 Space for Zeitgeist einholen.
Von wegen die Jugend von heutzutage. Dass man im jungen Alter auch aktiv etwas zur Kultur beitragen kann, beweisen Deborah Holman und Roberto Ronzani mit ihrem Projekt 1.1 Space for Zeitgeist. Und dass die Medien einen dabei nicht verblöden lassen ebenso: Die beiden nutzen nämlich diverse soziale Medien, um ihren realen Ausstellungsraum und dessen Inhalte Menschen ortsunabhängig zugänglich zu machen. Passend zum digitalen Hype ist auch ihr Konzept, denn: Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Was die beiden uns zu erzählen haben, wo sie überall zu finden sind und was Rihanna und Sita Abellan damit zu tun haben, erfahrt ihr im Folgenden.

Liebe Deborah, lieber Roberto wer oder was ist 1.1 Space for Zeitgeist?
Deborah: Das 1.1 ist ein Raum für Zeitgeist, in dem monatlich Ausstellungen von jungen Künstlern stattfinden. Dieser wird von mir, Deborah Holman gemeinsam mit Roberto Ronzani geführt. Wir sind selber auch Künstler und sehen uns deshalb nicht als Kuratoren an.
Roberto: Dito. Zurzeit befinden wir uns im Kulturhaus R105 an der Reinacherstrasse 105 in Basel.
Seit wann existiert das Ganze?
Deborah: Die Idee entstand etwa im Mai 2015. Bis dann aber die erste Ausstellung stattfand wurde es Oktober 2015.
Roberto: Ich glaube Deborah hatte die Idee schon längere Zeit im Hinterkopf. Mit meiner Anfrage auszustellen ergab sich eine passende Möglichkeit, das Ganze umzusetzen.


Weshalb ist so ein Ort in Basel gut aufgehoben?
Deborah: Dass der Raum in Basel ist, spielt eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle, insofern, dass wir oft über das Internet Ausstellende scouten und viel Content vor allem auf unseren Instagram Account stellen, sodass auch Leute, die nicht vor Ort sind daran teilhaben können. Natürlich sind wir aber dennoch sehr gerne in Basel. Ich kann mir diesen Raum, so wie er jetzt ist, in keiner anderen Stadt vorstellen, da es hier eine lange Geschichte an Off-Spaces gibt und ich selbst aus der Region komme.
Roberto: Ich glaube, dass Basel so eine Plattform nötig hat, es tut der Stadt gut. Wir kennen viele Leute, die allein oder in kleinen Kreisen ihre Projekte realisieren und nur mit wenigen Leuten teilen. Unsere Idee ist es, diese Leute zusammenzubringen, sodass Neues entstehen kann.

Wo in Basel treibt ihr euch gerne rum?
Deborah: Das Kleinbasel gefällt mir sehr, da es so vielfältig ist. Aber auch das Dreispitz-Areal ganz in unserer Nähe mit dem Oslo 10, dem H3K und dem Offcut, und die Kaschemme in der Breite sind tolle Orte.
Roberto: Ja, diese gefallen mir auch. Ich bin zusätzlich ein Fan vom Ausstellungsraum Klingental und natürlich der Kunsthalle Basel. Es interessieren mich aber auch Orte, an denen sich Leute noch kurz nach der Schule oder der Arbeit treffen.
Ihr seid online sehr präsent. Was gibt's da nebst eurem Instagram Account sonst noch?
Deborah: Mittlerweile haben wir unseren Tumblr Blog gelauncht und unseren Soundcloud Account mit einem Weihnachtsmix von Boeystraat eingeweiht.
Roberto: Auf’s neue Jahr 2016 kommt dann die Webseite dazu.
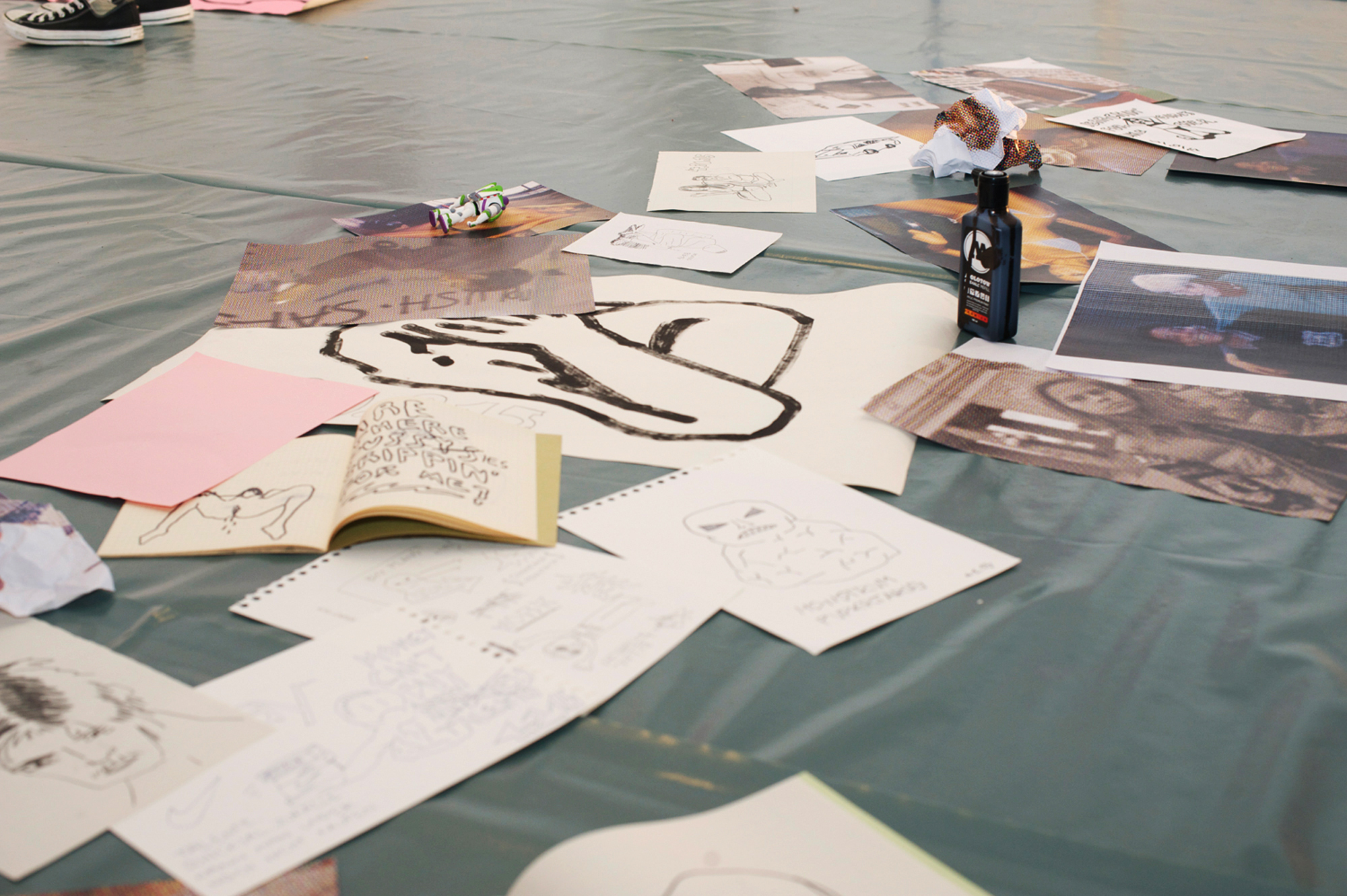
Wie kam es zur Namensgebung 1.1 Space for Zeitgeist?
Deborah: Ganz einfach: Laut Grundrissplan des Gebäudes befinden wir uns im Raum 1.1.
Wer hat bisher alles so bei euch ausgestellt?
Deborah: Bisher hat Roberto Ronzani als Erster im Oktober/November 2015 ausgestellt. Weiter geht’s dann im Januar 2016.
Zur vergangenen Ausstellung “Confused by being confused” von Roberto Ronzani – wie kam es dazu und was war das Konzept dahinter?
Deborah: Roberto kam im Mai 2015 auf mich zu und hat mich gefragt, ob er im 1.1 ausstellen dürfe. Damals habe ich den Raum noch als Atelier genutzt. Ich fand es eine tolle Idee und seine Arbeiten sowie das Konzept für CBBC gefielen mir sehr gut. So hat sich dann auch gleich die Idee zur gemeinsamen Gründung des 1.1 entwickelt.
Roberto: Ich schuf im Ausstellungsraum mit Gemälden, Zeichnungen und Objekten eine adoleszente Stimmung, es sollte sich so anfühlen, als würde man das Zimmer eines Teenagers betreten. Alles war sehr dicht angeordnet und sah spontan platziert aus. Teenage Angst und pubertäre Verwirrungen sind Themen, mit denen ich mich auseinandersetze.

Wie wählt ihr die ausstellenden Künstler aus?
Deborah: Wir haben keinen fixen Kriterienkatalog. Bis jetzt haben wir uns vor allem auf Instagram umgeschaut und Freunde und Bekannte angesprochen, von denen wir behaupten, dass sie dem Zeitgeist unserer Generation, die mit Internet und grösstenteils mit sozialen Medien aufgewachsen ist, entsprechen. Es ist uns wichtig, dass es Abwechslung gibt und nicht nur ein Medium vertreten wird.
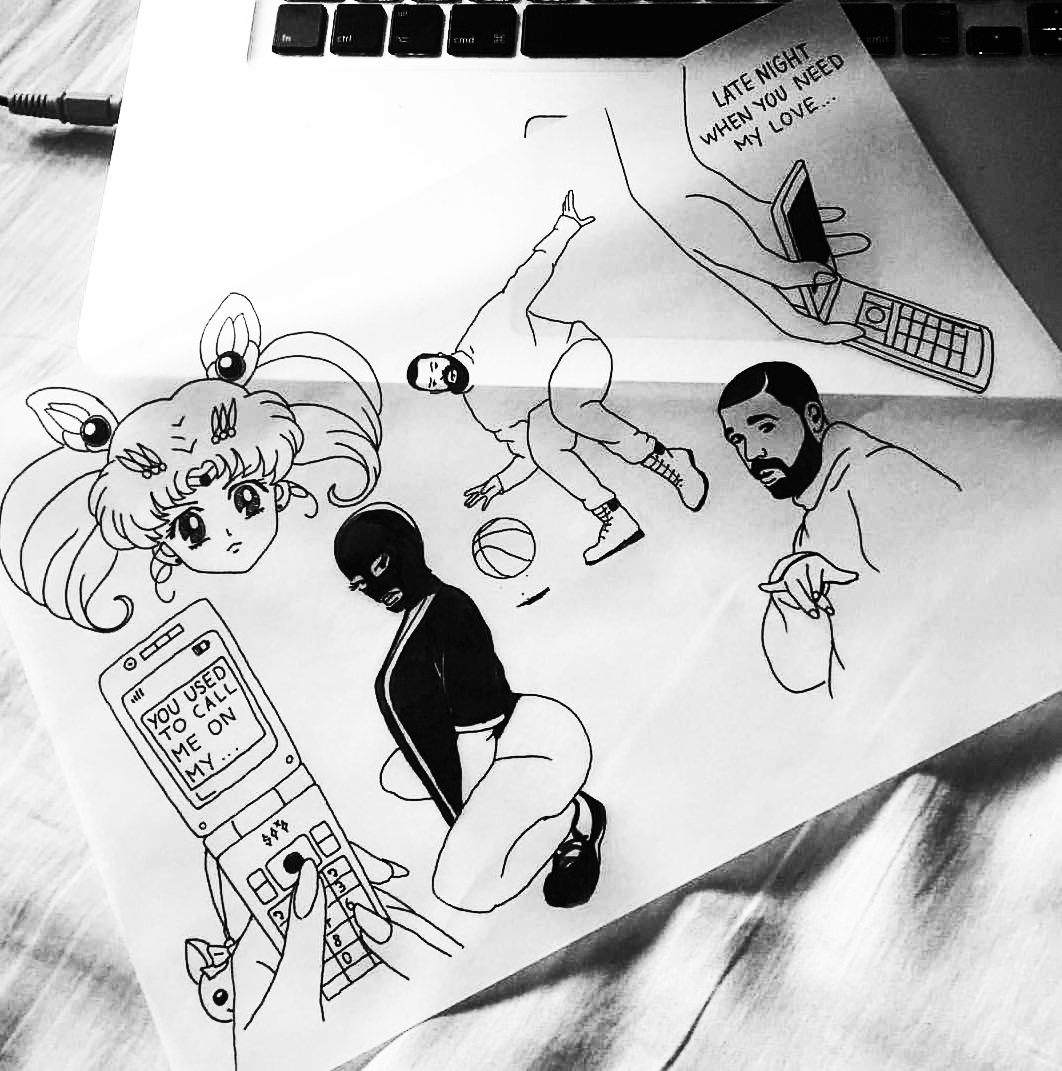
Wer stellt als Nächstes aus?
Deborah: Ende Januar wird Manuela Soto bei uns sein und an der Vernissage der Museumsnacht am 22. Januar und am 23. Januar 2015 tätowieren. Ihre Zeichnungen, Flashes und Drucke werden während 22.1. - 30.1.2015 ausgestellt und von ihr bedruckte Kleidungsstücke und Zines zu kaufen sein.


Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Deborah: Wir kennen ihre Arbeit von Instagram und haben sie angeschrieben. Sie war von Anfang an dabei.
Weshalb sollte euch unsere Leserschaft unbedingt besuchen kommen?
Deborah: Kommt einfach vorbei und findet es am Besten selber raus.

Wenn 1.1 Space for Zeitgeist essbar wäre, was wäre es?
Deborah: Ein Buffet mit allen möglichen Gerichten und Küchen – alles selbst gekocht.
Roberto: Es wäre ein frischer Fruchtsalat mit Schärfe.
Wie wär’s mal mit...
Deborah: …sich an der Museumsnacht #shlagtatts tätowieren lassen!
Roberto: …Pizza.

Wir danken Deborah und Roberto für die Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere Ausstellungen im Namen des Zeitgeistes. Rihanna's Gangsterfreundin und Selfiequeen Sita Abellan, welche im Musikvideo zu Bitch Better Have My Money mitwirkt, hat ein Soto Manga Tattoo – besuch auch du Deborah, Roberto und Manuela Soto im Januar 2016 und lass dir dein eigenes stechen.
_
von Ana Brankovic
am 28.12.2015
Fotos
© 1.1 Space for Zeitgeist und Instagram
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei 1.1 Space for Zeitgeist einholen.
La Fourchette: Im Gespräch mit Claire Guerrier und Maya Totaro
Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen, sagte Winston Churchill. Was gut ist, muss nicht immer um die halbe Welt gereist sein, sondern ist manchmal in Nachbarsgarten, sagen Claire und Maya.
Diese zwei Zitate vereint, umschreiben den Spirit des Café/Restaurant La Fourchette, welches sich im Herzen des Kleinbasels befindet. Wir trafen die zwei Gründerinnen zum Gespräch über ihr Herzstück.
![]()
Ihr Lieben, wer steckt hinter La Fourchette und wie kam es dazu, dass ihr heute das La Fourchette betreibt?
Hinter La Fourchette steckt vor allem eine 10 jährige Freundschaft zwischen zwei Frauen (Claire und Maya) und eine gemeinsame Leidenschaft fürs Kulinarische und dieselbe Lebenseinstellung zum Umgang mit Lebensmitteln. Die Zusammenarbeit begann bei einem Projekt von Claire, sie veranstaltete erotische Lesungen, welche mit einem sinnlichen, mehrgängigen Menu begleitet wurden und ich griff ihr unter die Arme. Wir empfanden die Komponente von uns beiden sehr spannend und als dann vor mehr als einem Jahr die Option bestand an der Klybeckstrasse 122 unser Wohnzimmer zu erweitern und das ehemalige Chez Erica zu übernehmen, wussten wir, dass wir diese Chance nutzen mussten.
Weshalb der Name «La Fourchette»?
Die Gabel ist für uns die Versinnbildlichung von lustvollem und bodenständigem Essen.
![]()
Wer war für das Einrichtungskonzept zuständig?
Wir! Gemeinsam haben wir die ehemalige Beiz umgebaut, gestaltet und eingerichtet. Unser Hauptanliegen war es, dass wir für unsere Gäste ein heimeliges und wohliges Ambiente erzeugen.
![]()
![]()
Wie viel Leute arbeiten für La Fourchette und wie würdet ihr euer Teamspirit umschreiben?
Wir sind ein zehnköpfiges Team, uns mit einberechnet. Unser Teamgeist ist sehr familiär und der Umgang respektvoll. Unser Traum war es, dass nur Männer für uns arbeiten, dies bleibt wohl nur ein Traum, denn unser Team besteht beinahe nur aus Frauen. (lacht).
Beschreibt Eure Gäste mit Lebensmittel
Eine Kiste voller lokalem Gemüse, angemacht mit Gewürzen aus aller Welt, ohne Vorbehalte.
![]()
![]()
![]()
Empfehlungen von euch an eure Gäste:
a) bestes Getränk b) beste La Fourchette Verkostung
Bei dieser Kälte und Tristesse empfehlen wir euch wärmstens unseren Hot oder Happy Ginger, welcher aus natürlichen Zutaten besteht und in Kleinbasel produziert wird. Danach sollte die Welt um einiges wärmer und fröhlicher erscheinen. (lacht). Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, sollte das Lamm Tajine und ein Glas vom edlen Tropfen Binet Jacquet nicht verpassen. Die Kombination ist nicht nur ein Schmaus, sondern unterstützt einen Bauernhof im Berneroberland und einen im St. Johann wohnhaften Winzer.
Und für alle Naschkatzen und Naschkater empfehlen wir unser hausgemachtes Tarte Tatin, denn für Süsses sollte man sich immer ein Plätzchen im Magen freihalten.
Wir sind sehr von eurer Philosophie begeistert, die Haltung und Wertschätzung der regionalen und saisonalen Lebensmittel. Wart ihr schon immer darauf sensibilisiert oder kam dies erst durch einen Wertewandel?
Genau, das ist unsere Haltung und auch unser Hauptanliegen. Wir wollen aufzeigen, wie vielfältig die saisonale und lokale Küche sein kann um weitere Leute von dieser Haltung zu begeistern. Dies gilt nicht nur für das La Fourchette sondern auch bei uns zu Hause.
![]()
![]()
Saisonal, regional und bio haben Vor- und Nachteile, welche sind das für euch?
Über Vor - und Nachteile machen wir uns keine Gedanken. Es geht klar um die Anpassungsfähigkeit und die Flexibilität, die von uns und nicht von der Natur ausgehen soll. Dies ist nicht immer einfach und bedacht hie und da Kompromissen. Was uns eine grosse Zufriedenheit schenkt ist, dass wir die Personen, die hinter den Produkten stehen, kennen. Um ein Beispiel zu nennen: Frank von Moos liefert uns einen unglaublich leckeren Honig aus dem Gundeli-Gärtli.
Was nimmt ihr aus 2015 ins neue Jahr mit?
2015 nahm UNS mit und wir sind voll dabei...wir schwimmen im grossen Ozean... und freuen uns aufs 2016!
![]()
![]()
Was wünscht ihr euch fürs kommende Jahr und was der Welt?
Fürs 2016 wünschen wir uns eine neue Zitruspresse, die effizienter ist, um uns an gut besuchten Wochenenden zu entlasten. Und für die Welt wünschen wir uns mehr Toleranz, Akzeptanz, Hingabe und eine Riesenprise Humor.
![]()
Wie wär’s mal mit...
...einem 48-Stunden-Tag und einer Wanderung durch das poppige, gefährliche Kleinbasel...vom Markt zur Designerboutique, vom Friseur zum Brocki, von der Kunstgalerie zur Dönerbude, von allerlei Cafégeschmäckern bis zur schönsten Whiskeybar, die Basel je hatte (Angels Share in der Feldbergstrasse)... es lebe das Kleinblasel!
![]()
Herzlichen Dank für eure Zeit und das Interview - wir können das La Fourchette nur wärmstens weiterempfehlen.
von Derya Cukadar
am 21.12.2015
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen, sagte Winston Churchill. Was gut ist, muss nicht immer um die halbe Welt gereist sein, sondern ist manchmal in Nachbarsgarten, sagen Claire und Maya.
Diese zwei Zitate vereint, umschreiben den Spirit des Café/Restaurant La Fourchette, welches sich im Herzen des Kleinbasels befindet. Wir trafen die zwei Gründerinnen zum Gespräch über ihr Herzstück.

Ihr Lieben, wer steckt hinter La Fourchette und wie kam es dazu, dass ihr heute das La Fourchette betreibt?
Hinter La Fourchette steckt vor allem eine 10 jährige Freundschaft zwischen zwei Frauen (Claire und Maya) und eine gemeinsame Leidenschaft fürs Kulinarische und dieselbe Lebenseinstellung zum Umgang mit Lebensmitteln. Die Zusammenarbeit begann bei einem Projekt von Claire, sie veranstaltete erotische Lesungen, welche mit einem sinnlichen, mehrgängigen Menu begleitet wurden und ich griff ihr unter die Arme. Wir empfanden die Komponente von uns beiden sehr spannend und als dann vor mehr als einem Jahr die Option bestand an der Klybeckstrasse 122 unser Wohnzimmer zu erweitern und das ehemalige Chez Erica zu übernehmen, wussten wir, dass wir diese Chance nutzen mussten.
Weshalb der Name «La Fourchette»?
Die Gabel ist für uns die Versinnbildlichung von lustvollem und bodenständigem Essen.

Wer war für das Einrichtungskonzept zuständig?
Wir! Gemeinsam haben wir die ehemalige Beiz umgebaut, gestaltet und eingerichtet. Unser Hauptanliegen war es, dass wir für unsere Gäste ein heimeliges und wohliges Ambiente erzeugen.


Wie viel Leute arbeiten für La Fourchette und wie würdet ihr euer Teamspirit umschreiben?
Wir sind ein zehnköpfiges Team, uns mit einberechnet. Unser Teamgeist ist sehr familiär und der Umgang respektvoll. Unser Traum war es, dass nur Männer für uns arbeiten, dies bleibt wohl nur ein Traum, denn unser Team besteht beinahe nur aus Frauen. (lacht).
Beschreibt Eure Gäste mit Lebensmittel
Eine Kiste voller lokalem Gemüse, angemacht mit Gewürzen aus aller Welt, ohne Vorbehalte.



Empfehlungen von euch an eure Gäste:
a) bestes Getränk b) beste La Fourchette Verkostung
Bei dieser Kälte und Tristesse empfehlen wir euch wärmstens unseren Hot oder Happy Ginger, welcher aus natürlichen Zutaten besteht und in Kleinbasel produziert wird. Danach sollte die Welt um einiges wärmer und fröhlicher erscheinen. (lacht). Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, sollte das Lamm Tajine und ein Glas vom edlen Tropfen Binet Jacquet nicht verpassen. Die Kombination ist nicht nur ein Schmaus, sondern unterstützt einen Bauernhof im Berneroberland und einen im St. Johann wohnhaften Winzer.
Und für alle Naschkatzen und Naschkater empfehlen wir unser hausgemachtes Tarte Tatin, denn für Süsses sollte man sich immer ein Plätzchen im Magen freihalten.
Wir sind sehr von eurer Philosophie begeistert, die Haltung und Wertschätzung der regionalen und saisonalen Lebensmittel. Wart ihr schon immer darauf sensibilisiert oder kam dies erst durch einen Wertewandel?
Genau, das ist unsere Haltung und auch unser Hauptanliegen. Wir wollen aufzeigen, wie vielfältig die saisonale und lokale Küche sein kann um weitere Leute von dieser Haltung zu begeistern. Dies gilt nicht nur für das La Fourchette sondern auch bei uns zu Hause.


Saisonal, regional und bio haben Vor- und Nachteile, welche sind das für euch?
Über Vor - und Nachteile machen wir uns keine Gedanken. Es geht klar um die Anpassungsfähigkeit und die Flexibilität, die von uns und nicht von der Natur ausgehen soll. Dies ist nicht immer einfach und bedacht hie und da Kompromissen. Was uns eine grosse Zufriedenheit schenkt ist, dass wir die Personen, die hinter den Produkten stehen, kennen. Um ein Beispiel zu nennen: Frank von Moos liefert uns einen unglaublich leckeren Honig aus dem Gundeli-Gärtli.
Was nimmt ihr aus 2015 ins neue Jahr mit?
2015 nahm UNS mit und wir sind voll dabei...wir schwimmen im grossen Ozean... und freuen uns aufs 2016!


Was wünscht ihr euch fürs kommende Jahr und was der Welt?
Fürs 2016 wünschen wir uns eine neue Zitruspresse, die effizienter ist, um uns an gut besuchten Wochenenden zu entlasten. Und für die Welt wünschen wir uns mehr Toleranz, Akzeptanz, Hingabe und eine Riesenprise Humor.

Wie wär’s mal mit...
...einem 48-Stunden-Tag und einer Wanderung durch das poppige, gefährliche Kleinbasel...vom Markt zur Designerboutique, vom Friseur zum Brocki, von der Kunstgalerie zur Dönerbude, von allerlei Cafégeschmäckern bis zur schönsten Whiskeybar, die Basel je hatte (Angels Share in der Feldbergstrasse)... es lebe das Kleinblasel!

Herzlichen Dank für eure Zeit und das Interview - wir können das La Fourchette nur wärmstens weiterempfehlen.
von Derya Cukadar
am 21.12.2015
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
Hinterhof Basel: Im Gespräch mit Julian Schärer und Lukas Rytz
Statt Angst und Panik über schliessende Clubs zu schüren, wählen wir den Weg, das noch Bestehende zu würdigen und die Energie und Zeit, welche in das Schaffen einer Nachtkultur mit Qualität gesteckt wurde, Revue passieren zu lassen – natürlich mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Julian Schärer und Lukas Rytz sind seit einigen Jahren Teil des Teams Hinterhof, von welchem damals niemand gedacht hätte, dass dieser bis heute noch bestehen würde. Die beiden gewährten uns einen spannenden und ausführlichen Einblick in die Geschichte und hinter die Kulissen des Basler Hinterhofs – nehmet euch Zeit und leset.
![]()
Lieber Lukas Rytz, lieber Julian Schärer wie kamt ihr dazu, im Basler Club Hinterhof zu arbeiten und was genau macht ihr da?
Lukas: Ich habe im Herbst 2011 als Praktikant bei der Hinterhof Bar angefangen, nachdem ich 2007 für mein Studium in Geschichte und Medienwissenschaften nach Basel gezogen bin. Da der Vertrag Ende des Jahres hätte auslaufen sollen, habe ich mich auf eine Wiederaufnahme meiner akademischen Ausbildung eingestellt. Es ging dann doch alles länger als gedacht und ich bin bis heute im Hinterhof geblieben. An der Uni hingegen bin ich seit viereinhalb Jahren zwar eingeschrieben, habe aber nie die Zeit gefunden, Kurse zu besuchen oder Arbeiten zu schreiben, was nach der Schliessung der Hinterhof Bar im März 2016 zuoberst auf meiner To Do Liste steht - neben einer längeren Reise nach Japan. Was meine Funktion betrifft: Seit geraumer Zeit bin ich zusammen mit Philippe Hersberger Hauptverantwortlicher für das Programm im Hinterhof und alle damit verbundenen Aufgaben. Ich arbeite aber auch als Abendverantwortlicher, also Nightmanager und betreue an den Clubnächten unsere Gastkünstler, hole sie am Flughafen ab, gehe mit ihnen Essen und kümmere mich darum, dass es ihnen an nichts fehlt.
Julian: Ich wurde 2012 zum ersten mal als DJ in der Hinterhof Bar gebucht. Man hat sich von Anfang an gut verstanden, musikalisch wie menschlich. Die Bookings wurden immer regelmässiger bis ich dann im Januar 2013 zur Unterstützung fix in das Hinterhof Team geholt wurde. Was als kleines Pensum begann wurde stetig mehr. Ich habe mich schnell und gut in die Arbeit hinter den Kulissen eingelebt. Auflegen tu ich immer noch regelmässig, arbeite ebenfalls als Nightmanager, verbringe aber auch den Grossteil meiner Arbeitszeit unter der Woche im Büro und unterstütze Lukas im Booking.
![]()
Wem gehört der Hinterhof eigentlich?
Julian und Lukas: Die Hinterhof Bar oder Hinterhof gehört Philippe Hersberger und Lukas Riesen, welche diesen 2010 mit einigen engen und langjährigen Freunden aus der Taufe gehoben haben. Der Vertrag für das Gebäude an der Münchensteinerstrasse war schon immer auf ein Jahr befristet und sie nutzten die Location zunächst als Showroom für das Hinterhof Cocktailcatering, da beide eine Vergangenheit in der Barkultur haben. Ihnen, Christian Hausmann und natürlich dem ganzen Barteam sind die grossartigen Cocktails zu verdanken, die es Abend für Abend bei uns gibt. Irgendwann wollten sie aus dem alten Fabrikgebäude mehr machen und so wurde es kurzerhand – trotz all der Risiken und der kurzfristigen Perspektive – mit viel Arbeit und DIY-Attitude zu einem Club- und Konzertlokal mit Dachterrasse umfunktioniert. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Jungs, dass sie den Mut hatten, einen solchen Ort auf- und bis heute durchzuziehen.
![]()
Wie viele Leute arbeiten da?
Julian und Lukas: Das ist natürlich saisonal bedingt. Im Winter sind es mit Festangestellten, Barkeepern, Kassen- und Garderobenpersonal, Reinigungskräften und Securities um die 40 Leute, im Sommer kommt natürlich das Barpersonal auf der Dachterrasse dazu, die ja nur über die Sommermonate geöffnet ist. Das sind doch einige Angestellte, für die man auch eine Verantwortung trägt. Viele arbeiten neben dem Studium oder einem Teilzeitjob bei uns, weil sie den Ort und das Team sehr schätzen. Und einige sind auch schon seit den Anfängen dabei.
Beschreibt das Team in 3 Adjektiven.
Julian und Lukas: Familiär, kreativ, anspruchsvoll.
![]()
Wie wählt ihr eure Acts aus und wie läuft so ein Booking eigentlich ab?
Lukas: Das ist ganz unterschiedlich. Einerseits bucht man natürlich am liebsten DJs, Live Acts und Bands, die man selber sehr schätzt, deren Produktionen, Sets oder Auftritte man kennt und mag. Und man tauscht sich mit Freunden, Mitarbeitern, lokalen DJs und Musikliebhabern aus, was für spannende elektronische Musik, Labels und Künstler es zurzeit zu verfolgen gilt. Anderseits muss man auch das Gespür dafür aufbringen, Sachen zu buchen, auf die das Publikum in Basel, dem Dreiländereck und der Schweiz gerade Lust hat. Zudem versucht man auch einen Mittelweg zu finden zwischen Bookings, die wirtschaftlich eher auf der sicheren Seite sind und Abenden, wo man sich nicht so sicher ist, ob dann dafür irgendjemand an die Münchensteinerstrasse rausfährt. Nicht, weil der Künstler nicht toll wäre, sondern weil ihn wenige kennen und die Leute bei Acts, die nicht so gross oder bekannt sind, eher Skepsis an den Tag legen, was wir eigentlich sehr schade finden. Aber das ist ja auch das Spannende, zu versuchen, das Publikum herauszufordern und auch auf neue Musik und Künstler aufmerksam zu machen. Das kann funktionieren oder auch nicht, halte ich aber für einen wichtigen Teil unseres Jobs. Im Endeffekt muss gute Musik das Hauptkriterium sein und nicht die Wirtschaftlichkeit. Was den Booking-Ablauf betrifft: Das geht dann wie in der Branche mittlerweile üblich immer über eine Booking-Agentur, mit der man mögliche Daten bespricht, über die Gage eines Künstlers verhandelt und andere allfällige Punkte, die Vertragsbestandteil sind, klärt. Das kann je nach Dauer, Regelmässigkeit und Intensität der Zusammenarbeit freundschaftlich oder kollegial ablaufen, aber auch einen sehr geschäftlichen Ton haben.
![]()
Wo geht ihr in Sachen Musik sonst so gerne hin in Basel?
Lukas: Da ich mittlerweile wieder in Bern wohne, bin ich nicht mehr ganz so häufig in Basel unterwegs, auch, weil ich meist eine Nacht pro Wochenende im Club arbeite und dann den anderen Abend gerne eher ruhig angehe, zu Hause oder auch mal in einer cozy Bar. Zudem gehe ich auch immer mal wieder in Bern (Bonsoir, Kapitel, Reitschule), Zürich (Zukunft, Kauz) oder auch Frankfurt und Berlin aus, weil ich es interessant finde zu sehen, was Kulturschaffende respektive Clubs in anderen Städten so machen. Was Konzerte betrifft, gehe ich immer mal wieder in die Kaserne, weil sie es doch regelmässig schaffen, ein abwechslungsreiches und spannendes Live-Programm auf die Beine zu stellen und dabei auch immer mal wieder Risiken eingehen. Für elektronische Musik ist sicher auch der Nordstern ein Fixpunkt in Basel, um den man nicht herumkommt, und den ich für einen bestimmten Künstler auch ab und an mal besuche. Ausserdem mag ich die Phae Parties in der Lady Bar, weil ich Denis / Garçon und Dominic / Agonis als DJs sehr schätze, sie immer Künstler buchen, die ich persönlich mag und sie auch bei uns in der Hinterhof Bar tolle Sachen machen (Traxx Up!, Giegling Nächte). Auch die Kaschemme finde ich einen spannenden Ort, bin aber meist zu bequem, um dann tatsächlich an die Lehenmattstrasse zu fahren (lacht). Beim Thema Musik in Basel nicht vergessen darf man natürlich Plattfon Records an der Feldbergstrasse. Michi und Muriel haben eine wunderbare Auswahl an House-, Disco- und Technoplatten und man findet von HipHop über Indie-Rock, Metal, Afrobeat und Cosmic bis hin zu irgendwelchen Drone- und Noise-Scheiben eigentlich in jedem Genre etwas Spannendes. Ausserdem wird im Plattfon auch fast jeder fündig, der Literatur zum Thema Musik, Poptheorie oder einer bestimmten Musikkultur sucht.
Julian: Unsere Interessen und Gewohnheiten decken sich da. Es kommt durchaus auch vor,
dass man uns ausserhalb des Hinterhofs gemeinsam antrifft, wie eben zum Beispiel im Plattfon.
![]()
Tauscht ihr euch geschäftlich in Sachen Musik/Bookings auch mit anderen Locations wie dem Nordstern oder Kaschemme aus?
Julian und Lukas: Man ist sicher immer mal wieder in Kontakt mit anderen Locations, sei dies, um zu schauen, dass man an einem bestimmten Datum kein musikalisch allzu ähnliches Booking bestätigt oder um zu fragen, ob Interesse an einem Künstler besteht, den man nicht selber buchen kann, weil das Datum schon besetzt ist. Zudem hat etwa der Nordstern diesen Sommer zusammen mit uns drei Partys auf unserer Dachterrasse veranstaltet, die jeweils auf sehr viel Anklang gestossen sind. Eine weitere Kooperation zwischen uns, dem Nordstern sowie einem Veranstalter aus Deutschland ging diesen September zum ersten Mal über die Bühne: das Air Festival.
![]()
Was bietet der Hinterhof nebst tollen Parties sonst noch?
Lukas: Da fällt mir natürlich als erstes die Dachterrasse ein, die ich für einen - nicht nur in Basel - einzigartigen Ort halte. Mit der unglaublich gut sortierten Bar, den grossartigen Barkeepern, dem argentinischen Grill Che Que Lomo und der wunderbar entspannten Atmosphäre gab es in den letzten Jahren kaum einen Ort, an dem ich mich im Sommer wohler gefühlt und wo ich mehr Zeit vertrödelt hätte. Und auch da hat immer mal wieder eine tolle Band gespielt oder ein Poetry Slam stattgefunden, was auch immer ein schöner Ausgleich zum doch sehr stark elektronisch geprägten Programm im Club war. Im Club gab es neben den Parties natürlich auch immer wieder tolle Konzerte, meist unter der Woche. So haben über die letzten Jahre Bands wie Bilderbuch, Jojo Mayer’s Nerve, Sebastien Tellier, Cut Copy, Efterklang oder Büne Hubers Meccano Destructif Commando bei uns gespielt.
Zudem gab es bis vor zwei Jahren noch den Hinterhof Offspace, den unsere Freunde Thomas Keller und Johannes Willi betrieben haben und wo regelmässig spannende Ausstellungen und Kunstperformances stattfanden, aber auch zum Teil irrwitzige Ideen und Installationen umgesetzt wurden, die das Clubpublikum, welches meist freien Zugang zum Offspace hatte, zum Teil schon irritiert oder herausgefordert haben. Und dann muss man sicher die Club Bar erwähnen, die einer klassischen Cocktailbar in Sachen Qualität, Service und Knowhow in nichts nachsteht und an der man bis zum heutigen Tag um 4 Uhr morgens noch einen Dry Martini im Spitzglas serviert kriegt. Ich kenne keinen anderen Club, der so etwas konsequent durchzieht und bin überzeugt davon, dass unser Publikum das auch sehr schätzt. Last but not least will ich natürlich Herr Wiegands Wurst-Life-Balance nicht vergessen, bei ihm gibt’s definitiv die besten Hot-Dogs der Stadt.
![]()
Wann müsst ihr das Gebäude endgültig verlassen und gibt’s schon Pläne für einen Neuanfang in Basel?
Julian und Lukas: Nun, die letzte Party findet bei uns am Osterwochenende statt. Wir starten am Donnerstag, dem 24. März 2016 mit einem letzten Konzert und einer Afterparty und bespielen die Hinterhof Bar dann über das ganze Wochenende bis am Montagmorgen. Natürlich ist die Motivation hoch, an einem neuen Ort weiterzumachen. Immerhin war die Hinterhof Bar für uns alle die letzten 2, 3, 4 oder 6 Jahre zentraler Lebensinhalt. Wir können uns beide nicht vorstellen uns nicht weiterhin intensiv mit Clubkultur und Musik zu beschäftigen. Diese Tätigkeit ermöglicht es unsere Passion als Beruf auszuüben. Ein grosses Privileg! Konkrete respektive spruchreife Pläne gibt es noch nicht, aber wir prüfen zur Zeit verschiedene Optionen und Standorte.
![]()
Es gab ein langes hin und her bezüglich dem Basler Nachtleben, Bassregelungen und Tralala. Wenn ihr euch bei der Stadt Basel etwas wünschen könntet, was wäre dies?
Lukas: Die Diskussion um das „Basler Clubsterben“ und die neue Empfehlung zur Mitberücksichtigung der dB(C)-Werte im Clubbetrieb hat sicherlich hohe Wellen geschlagen. Ich sehe das alles aber nicht so tragisch und frage mich, ob eine „Kultur der Empörung“, wie sie meines Erachtens betrieben wurde und zum Teil weiterhin wird, wirklich lösungsorientiert ist. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte von elektronischer Musik und Clubkultur auseinandersetzt weiss, dass das Nachtleben schon immer einen starken temporären, unvorhersehbaren und fluktuierenden Charakter hatte. Das war und ist in New York nicht anders als in Basel. Eine Installation im Berliner Club Stattbad, welcher kürzlich schliessen musste, beschreibt das sehr treffend: „All palaces are temporary palaces.“ Dieser Satz trägt irgendwie die Zuversicht und den Optimismus, aber auch das Wissen um die Vergänglichkeit – Werte, welche Clubkultur schon immer ausgemacht haben – in sich. Man weiss, es wird schon irgendwie weitergehen, einen neuen Palast geben. Und was die Stadt Basel betrifft: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Behörden durchaus gesprächsbereit und an gemeinsamen Lösungen interessiert sind, wenn man als Club aktiv auf sie zugeht. Ich bin der Meinung, dass da auch eine Holschuld seitens der Clubbetreiber und Kulturschaffenden besteht und man es sich doch etwas einfach macht, wenn man alles auf mangelnde Kommunikation und komplizierte bürokratische Abläufe der Behörden abschiebt. Nichtsdestotrotz wäre ein klares Bekenntnis der Stadt zu einem vielseitigen, spannenden und jungen Nachtleben natürlich wünschenswert. Man darf auch nicht vergessen, dass Clubs und Kulturbetriebe Arbeitsplätze schaffen, Hotelübernachtungen und Taxifahrten generieren und als KMU’s auch ihren Teil zum Wirtschaftsstandort Basel beitragen.
![]()
Beschreibt ein klassisches Arbeitswochenende im Hinterhof.
Julian und Lukas: Hier muss man vielleicht vorweg nehmen, dass der grösste Teil unseres Arbeitspensums unter der Woche anfällt und in erster Linie aus Büroarbeit besteht, also Mails schreiben und beantworten, mit Agenturen, Künstlern und Veranstaltern Gespräche führen, Verträge unterzeichnen, Flüge, Hotels und Restaurants buchen oder sich mit der SUISA herumschlagen. Die Einsätze an den Wochenenden sind in diesem Sinne ein eher kleiner aber doch sehr intensiver Teil unserer Arbeit. Julian und ich sind dann in erster Linie als Abendverantwortliche / Nightmanager oder Künstlerbetreuer / Hosts vor Ort. Beim Nightmanagement fungiert man als Knotenpunkt eines Clubabends. Betritt im Normalfall den Hinterhof als Erster und verlässt ihn als Letzter. Man koordiniert alle Mitarbeiter, muss sich auf die Details achten, schauen, dass alles rund läuft und immer auf spezielle Situationen, welche die Nacht so mit sich bringt gefasst sein.
![]()
Wenn der Hinterhof an einem Wochenende essbar wäre, wie würde der Freitag, wie der Samstag und wie der Sonntag schmecken?
Julian und Lukas: Der Hinterhof wäre wohl eher trink- als essbar und würde nach Champagner, „Philosophie des Glücks“ und Bloody Mary schmecken. In dieser Reihenfolge.
Welcher Act war bisher euer grösstes Highlight und weshalb?
Lukas: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Damit einem ein Abend in guter Erinnerung bleibt, muss ja nicht nur die „Performance“ der Musiker stimmen respektive die Musik an sich gefallen, sondern es müssen Gäste und im besten Falle auch Freunde da sein, denen die Musik auch zusagt, die Stimmung im Club muss passen aber auch die eigene Gefühlslage und die Beziehung zum DJ/Künstler, gerade als Host respektive Mitarbeiter des Clubs. Müsste ich aber spontan ein paar Namen nennen: DJ Harvey, Jeff Mills, DJ Koze, die Smallpeople aus Hamburg, die Giegling Labelnächte, Manamana von KANN Records aus Leipzig, Ben UFO & Joy Orbison, Oskar Offermann & Edward, DVS1 oder auch die Nächte mit den Schweden von Studio Barnhus aka Axel Boman, Pedrodollar & Kornél Kovacs.
Julian: Das sehe ich sehr ähnlich. John Talabot, Âme & Howling würde ich dieser Liste noch
hinzufügen.
![]()
Welchen für euch absolut einzigartigen Song würdet ihr euren treuen Gästen widmen?
Lukas: Gwen McCrae – Keep The Fire Burning (Atlantic Records, 1982)
Ein grossartiger, tanzbarer Disco-Tune, mit dem ich sehr viele schöne Momente verbinde und der dazu aufruft, die Liebe immer wieder neu zu entfachen. Und das tun ja auch unsere treuen Gäste immer von Neuem.
3 A.M. – I Love This Place (Movin’ Records, 1994)
Klassischer Garage House aus New Jersey und eine Liebeserklärung an „This Place“, die unsere Gäste regelmässig an uns aussprechen.
Julian: Chad Valley – Fall 4 U (Kim Browns 1 Take 2 Tracks Edit)
Dieser Track verkörpert für mich die ganze Hinterhof-Experience. Er verbindet Erinnerungen an laue Sommerabende, durchschwitzte Clubnächte und an viele Momente mit speziellen Menschen. Er beinhaltet auch den Zwischennutzungscharakter des Hinterhofs und die Vergänglichkeit des Moments.
Wie wär’s mal mit...
...etwas mehr musikalischer Neugier und Offenheit beim Ausgehen. And how about some love?
![]()
Liebsten Dank an Julian und Lukas, die sich Zeit für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen nahmen und damit dem Hinterhof Artikel die nötige Portion an Zeitlosigkeit verliehen haben. Und natürlich auch ein grosses Danke an Philippe Hersberger und Lukas Riesen, die das ganze Projekt ins Rollen gebracht und bis heute aufrecht erhalten haben. Wir stimmen mit ihrer Einstellung vollkommen überein: How about some love? Sei es in der Basler Clubkultur oder im Alltag.
von Ana Brankovic
am 14.07.2015
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
© Partybilder Michael Hochreutener
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit oder Michael Hochreutender einholen.
Statt Angst und Panik über schliessende Clubs zu schüren, wählen wir den Weg, das noch Bestehende zu würdigen und die Energie und Zeit, welche in das Schaffen einer Nachtkultur mit Qualität gesteckt wurde, Revue passieren zu lassen – natürlich mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Julian Schärer und Lukas Rytz sind seit einigen Jahren Teil des Teams Hinterhof, von welchem damals niemand gedacht hätte, dass dieser bis heute noch bestehen würde. Die beiden gewährten uns einen spannenden und ausführlichen Einblick in die Geschichte und hinter die Kulissen des Basler Hinterhofs – nehmet euch Zeit und leset.

Lieber Lukas Rytz, lieber Julian Schärer wie kamt ihr dazu, im Basler Club Hinterhof zu arbeiten und was genau macht ihr da?
Lukas: Ich habe im Herbst 2011 als Praktikant bei der Hinterhof Bar angefangen, nachdem ich 2007 für mein Studium in Geschichte und Medienwissenschaften nach Basel gezogen bin. Da der Vertrag Ende des Jahres hätte auslaufen sollen, habe ich mich auf eine Wiederaufnahme meiner akademischen Ausbildung eingestellt. Es ging dann doch alles länger als gedacht und ich bin bis heute im Hinterhof geblieben. An der Uni hingegen bin ich seit viereinhalb Jahren zwar eingeschrieben, habe aber nie die Zeit gefunden, Kurse zu besuchen oder Arbeiten zu schreiben, was nach der Schliessung der Hinterhof Bar im März 2016 zuoberst auf meiner To Do Liste steht - neben einer längeren Reise nach Japan. Was meine Funktion betrifft: Seit geraumer Zeit bin ich zusammen mit Philippe Hersberger Hauptverantwortlicher für das Programm im Hinterhof und alle damit verbundenen Aufgaben. Ich arbeite aber auch als Abendverantwortlicher, also Nightmanager und betreue an den Clubnächten unsere Gastkünstler, hole sie am Flughafen ab, gehe mit ihnen Essen und kümmere mich darum, dass es ihnen an nichts fehlt.
Julian: Ich wurde 2012 zum ersten mal als DJ in der Hinterhof Bar gebucht. Man hat sich von Anfang an gut verstanden, musikalisch wie menschlich. Die Bookings wurden immer regelmässiger bis ich dann im Januar 2013 zur Unterstützung fix in das Hinterhof Team geholt wurde. Was als kleines Pensum begann wurde stetig mehr. Ich habe mich schnell und gut in die Arbeit hinter den Kulissen eingelebt. Auflegen tu ich immer noch regelmässig, arbeite ebenfalls als Nightmanager, verbringe aber auch den Grossteil meiner Arbeitszeit unter der Woche im Büro und unterstütze Lukas im Booking.
Wem gehört der Hinterhof eigentlich?
Julian und Lukas: Die Hinterhof Bar oder Hinterhof gehört Philippe Hersberger und Lukas Riesen, welche diesen 2010 mit einigen engen und langjährigen Freunden aus der Taufe gehoben haben. Der Vertrag für das Gebäude an der Münchensteinerstrasse war schon immer auf ein Jahr befristet und sie nutzten die Location zunächst als Showroom für das Hinterhof Cocktailcatering, da beide eine Vergangenheit in der Barkultur haben. Ihnen, Christian Hausmann und natürlich dem ganzen Barteam sind die grossartigen Cocktails zu verdanken, die es Abend für Abend bei uns gibt. Irgendwann wollten sie aus dem alten Fabrikgebäude mehr machen und so wurde es kurzerhand – trotz all der Risiken und der kurzfristigen Perspektive – mit viel Arbeit und DIY-Attitude zu einem Club- und Konzertlokal mit Dachterrasse umfunktioniert. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Jungs, dass sie den Mut hatten, einen solchen Ort auf- und bis heute durchzuziehen.

Wie viele Leute arbeiten da?
Julian und Lukas: Das ist natürlich saisonal bedingt. Im Winter sind es mit Festangestellten, Barkeepern, Kassen- und Garderobenpersonal, Reinigungskräften und Securities um die 40 Leute, im Sommer kommt natürlich das Barpersonal auf der Dachterrasse dazu, die ja nur über die Sommermonate geöffnet ist. Das sind doch einige Angestellte, für die man auch eine Verantwortung trägt. Viele arbeiten neben dem Studium oder einem Teilzeitjob bei uns, weil sie den Ort und das Team sehr schätzen. Und einige sind auch schon seit den Anfängen dabei.
Beschreibt das Team in 3 Adjektiven.
Julian und Lukas: Familiär, kreativ, anspruchsvoll.
Wie wählt ihr eure Acts aus und wie läuft so ein Booking eigentlich ab?
Lukas: Das ist ganz unterschiedlich. Einerseits bucht man natürlich am liebsten DJs, Live Acts und Bands, die man selber sehr schätzt, deren Produktionen, Sets oder Auftritte man kennt und mag. Und man tauscht sich mit Freunden, Mitarbeitern, lokalen DJs und Musikliebhabern aus, was für spannende elektronische Musik, Labels und Künstler es zurzeit zu verfolgen gilt. Anderseits muss man auch das Gespür dafür aufbringen, Sachen zu buchen, auf die das Publikum in Basel, dem Dreiländereck und der Schweiz gerade Lust hat. Zudem versucht man auch einen Mittelweg zu finden zwischen Bookings, die wirtschaftlich eher auf der sicheren Seite sind und Abenden, wo man sich nicht so sicher ist, ob dann dafür irgendjemand an die Münchensteinerstrasse rausfährt. Nicht, weil der Künstler nicht toll wäre, sondern weil ihn wenige kennen und die Leute bei Acts, die nicht so gross oder bekannt sind, eher Skepsis an den Tag legen, was wir eigentlich sehr schade finden. Aber das ist ja auch das Spannende, zu versuchen, das Publikum herauszufordern und auch auf neue Musik und Künstler aufmerksam zu machen. Das kann funktionieren oder auch nicht, halte ich aber für einen wichtigen Teil unseres Jobs. Im Endeffekt muss gute Musik das Hauptkriterium sein und nicht die Wirtschaftlichkeit. Was den Booking-Ablauf betrifft: Das geht dann wie in der Branche mittlerweile üblich immer über eine Booking-Agentur, mit der man mögliche Daten bespricht, über die Gage eines Künstlers verhandelt und andere allfällige Punkte, die Vertragsbestandteil sind, klärt. Das kann je nach Dauer, Regelmässigkeit und Intensität der Zusammenarbeit freundschaftlich oder kollegial ablaufen, aber auch einen sehr geschäftlichen Ton haben.

Wo geht ihr in Sachen Musik sonst so gerne hin in Basel?
Lukas: Da ich mittlerweile wieder in Bern wohne, bin ich nicht mehr ganz so häufig in Basel unterwegs, auch, weil ich meist eine Nacht pro Wochenende im Club arbeite und dann den anderen Abend gerne eher ruhig angehe, zu Hause oder auch mal in einer cozy Bar. Zudem gehe ich auch immer mal wieder in Bern (Bonsoir, Kapitel, Reitschule), Zürich (Zukunft, Kauz) oder auch Frankfurt und Berlin aus, weil ich es interessant finde zu sehen, was Kulturschaffende respektive Clubs in anderen Städten so machen. Was Konzerte betrifft, gehe ich immer mal wieder in die Kaserne, weil sie es doch regelmässig schaffen, ein abwechslungsreiches und spannendes Live-Programm auf die Beine zu stellen und dabei auch immer mal wieder Risiken eingehen. Für elektronische Musik ist sicher auch der Nordstern ein Fixpunkt in Basel, um den man nicht herumkommt, und den ich für einen bestimmten Künstler auch ab und an mal besuche. Ausserdem mag ich die Phae Parties in der Lady Bar, weil ich Denis / Garçon und Dominic / Agonis als DJs sehr schätze, sie immer Künstler buchen, die ich persönlich mag und sie auch bei uns in der Hinterhof Bar tolle Sachen machen (Traxx Up!, Giegling Nächte). Auch die Kaschemme finde ich einen spannenden Ort, bin aber meist zu bequem, um dann tatsächlich an die Lehenmattstrasse zu fahren (lacht). Beim Thema Musik in Basel nicht vergessen darf man natürlich Plattfon Records an der Feldbergstrasse. Michi und Muriel haben eine wunderbare Auswahl an House-, Disco- und Technoplatten und man findet von HipHop über Indie-Rock, Metal, Afrobeat und Cosmic bis hin zu irgendwelchen Drone- und Noise-Scheiben eigentlich in jedem Genre etwas Spannendes. Ausserdem wird im Plattfon auch fast jeder fündig, der Literatur zum Thema Musik, Poptheorie oder einer bestimmten Musikkultur sucht.
Julian: Unsere Interessen und Gewohnheiten decken sich da. Es kommt durchaus auch vor,
dass man uns ausserhalb des Hinterhofs gemeinsam antrifft, wie eben zum Beispiel im Plattfon.
Tauscht ihr euch geschäftlich in Sachen Musik/Bookings auch mit anderen Locations wie dem Nordstern oder Kaschemme aus?
Julian und Lukas: Man ist sicher immer mal wieder in Kontakt mit anderen Locations, sei dies, um zu schauen, dass man an einem bestimmten Datum kein musikalisch allzu ähnliches Booking bestätigt oder um zu fragen, ob Interesse an einem Künstler besteht, den man nicht selber buchen kann, weil das Datum schon besetzt ist. Zudem hat etwa der Nordstern diesen Sommer zusammen mit uns drei Partys auf unserer Dachterrasse veranstaltet, die jeweils auf sehr viel Anklang gestossen sind. Eine weitere Kooperation zwischen uns, dem Nordstern sowie einem Veranstalter aus Deutschland ging diesen September zum ersten Mal über die Bühne: das Air Festival.

Was bietet der Hinterhof nebst tollen Parties sonst noch?
Lukas: Da fällt mir natürlich als erstes die Dachterrasse ein, die ich für einen - nicht nur in Basel - einzigartigen Ort halte. Mit der unglaublich gut sortierten Bar, den grossartigen Barkeepern, dem argentinischen Grill Che Que Lomo und der wunderbar entspannten Atmosphäre gab es in den letzten Jahren kaum einen Ort, an dem ich mich im Sommer wohler gefühlt und wo ich mehr Zeit vertrödelt hätte. Und auch da hat immer mal wieder eine tolle Band gespielt oder ein Poetry Slam stattgefunden, was auch immer ein schöner Ausgleich zum doch sehr stark elektronisch geprägten Programm im Club war. Im Club gab es neben den Parties natürlich auch immer wieder tolle Konzerte, meist unter der Woche. So haben über die letzten Jahre Bands wie Bilderbuch, Jojo Mayer’s Nerve, Sebastien Tellier, Cut Copy, Efterklang oder Büne Hubers Meccano Destructif Commando bei uns gespielt.
Zudem gab es bis vor zwei Jahren noch den Hinterhof Offspace, den unsere Freunde Thomas Keller und Johannes Willi betrieben haben und wo regelmässig spannende Ausstellungen und Kunstperformances stattfanden, aber auch zum Teil irrwitzige Ideen und Installationen umgesetzt wurden, die das Clubpublikum, welches meist freien Zugang zum Offspace hatte, zum Teil schon irritiert oder herausgefordert haben. Und dann muss man sicher die Club Bar erwähnen, die einer klassischen Cocktailbar in Sachen Qualität, Service und Knowhow in nichts nachsteht und an der man bis zum heutigen Tag um 4 Uhr morgens noch einen Dry Martini im Spitzglas serviert kriegt. Ich kenne keinen anderen Club, der so etwas konsequent durchzieht und bin überzeugt davon, dass unser Publikum das auch sehr schätzt. Last but not least will ich natürlich Herr Wiegands Wurst-Life-Balance nicht vergessen, bei ihm gibt’s definitiv die besten Hot-Dogs der Stadt.
Wann müsst ihr das Gebäude endgültig verlassen und gibt’s schon Pläne für einen Neuanfang in Basel?
Julian und Lukas: Nun, die letzte Party findet bei uns am Osterwochenende statt. Wir starten am Donnerstag, dem 24. März 2016 mit einem letzten Konzert und einer Afterparty und bespielen die Hinterhof Bar dann über das ganze Wochenende bis am Montagmorgen. Natürlich ist die Motivation hoch, an einem neuen Ort weiterzumachen. Immerhin war die Hinterhof Bar für uns alle die letzten 2, 3, 4 oder 6 Jahre zentraler Lebensinhalt. Wir können uns beide nicht vorstellen uns nicht weiterhin intensiv mit Clubkultur und Musik zu beschäftigen. Diese Tätigkeit ermöglicht es unsere Passion als Beruf auszuüben. Ein grosses Privileg! Konkrete respektive spruchreife Pläne gibt es noch nicht, aber wir prüfen zur Zeit verschiedene Optionen und Standorte.

Es gab ein langes hin und her bezüglich dem Basler Nachtleben, Bassregelungen und Tralala. Wenn ihr euch bei der Stadt Basel etwas wünschen könntet, was wäre dies?
Lukas: Die Diskussion um das „Basler Clubsterben“ und die neue Empfehlung zur Mitberücksichtigung der dB(C)-Werte im Clubbetrieb hat sicherlich hohe Wellen geschlagen. Ich sehe das alles aber nicht so tragisch und frage mich, ob eine „Kultur der Empörung“, wie sie meines Erachtens betrieben wurde und zum Teil weiterhin wird, wirklich lösungsorientiert ist. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte von elektronischer Musik und Clubkultur auseinandersetzt weiss, dass das Nachtleben schon immer einen starken temporären, unvorhersehbaren und fluktuierenden Charakter hatte. Das war und ist in New York nicht anders als in Basel. Eine Installation im Berliner Club Stattbad, welcher kürzlich schliessen musste, beschreibt das sehr treffend: „All palaces are temporary palaces.“ Dieser Satz trägt irgendwie die Zuversicht und den Optimismus, aber auch das Wissen um die Vergänglichkeit – Werte, welche Clubkultur schon immer ausgemacht haben – in sich. Man weiss, es wird schon irgendwie weitergehen, einen neuen Palast geben. Und was die Stadt Basel betrifft: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Behörden durchaus gesprächsbereit und an gemeinsamen Lösungen interessiert sind, wenn man als Club aktiv auf sie zugeht. Ich bin der Meinung, dass da auch eine Holschuld seitens der Clubbetreiber und Kulturschaffenden besteht und man es sich doch etwas einfach macht, wenn man alles auf mangelnde Kommunikation und komplizierte bürokratische Abläufe der Behörden abschiebt. Nichtsdestotrotz wäre ein klares Bekenntnis der Stadt zu einem vielseitigen, spannenden und jungen Nachtleben natürlich wünschenswert. Man darf auch nicht vergessen, dass Clubs und Kulturbetriebe Arbeitsplätze schaffen, Hotelübernachtungen und Taxifahrten generieren und als KMU’s auch ihren Teil zum Wirtschaftsstandort Basel beitragen.

Beschreibt ein klassisches Arbeitswochenende im Hinterhof.
Julian und Lukas: Hier muss man vielleicht vorweg nehmen, dass der grösste Teil unseres Arbeitspensums unter der Woche anfällt und in erster Linie aus Büroarbeit besteht, also Mails schreiben und beantworten, mit Agenturen, Künstlern und Veranstaltern Gespräche führen, Verträge unterzeichnen, Flüge, Hotels und Restaurants buchen oder sich mit der SUISA herumschlagen. Die Einsätze an den Wochenenden sind in diesem Sinne ein eher kleiner aber doch sehr intensiver Teil unserer Arbeit. Julian und ich sind dann in erster Linie als Abendverantwortliche / Nightmanager oder Künstlerbetreuer / Hosts vor Ort. Beim Nightmanagement fungiert man als Knotenpunkt eines Clubabends. Betritt im Normalfall den Hinterhof als Erster und verlässt ihn als Letzter. Man koordiniert alle Mitarbeiter, muss sich auf die Details achten, schauen, dass alles rund läuft und immer auf spezielle Situationen, welche die Nacht so mit sich bringt gefasst sein.
Wenn der Hinterhof an einem Wochenende essbar wäre, wie würde der Freitag, wie der Samstag und wie der Sonntag schmecken?
Julian und Lukas: Der Hinterhof wäre wohl eher trink- als essbar und würde nach Champagner, „Philosophie des Glücks“ und Bloody Mary schmecken. In dieser Reihenfolge.
Welcher Act war bisher euer grösstes Highlight und weshalb?
Lukas: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Damit einem ein Abend in guter Erinnerung bleibt, muss ja nicht nur die „Performance“ der Musiker stimmen respektive die Musik an sich gefallen, sondern es müssen Gäste und im besten Falle auch Freunde da sein, denen die Musik auch zusagt, die Stimmung im Club muss passen aber auch die eigene Gefühlslage und die Beziehung zum DJ/Künstler, gerade als Host respektive Mitarbeiter des Clubs. Müsste ich aber spontan ein paar Namen nennen: DJ Harvey, Jeff Mills, DJ Koze, die Smallpeople aus Hamburg, die Giegling Labelnächte, Manamana von KANN Records aus Leipzig, Ben UFO & Joy Orbison, Oskar Offermann & Edward, DVS1 oder auch die Nächte mit den Schweden von Studio Barnhus aka Axel Boman, Pedrodollar & Kornél Kovacs.
Julian: Das sehe ich sehr ähnlich. John Talabot, Âme & Howling würde ich dieser Liste noch
hinzufügen.

Welchen für euch absolut einzigartigen Song würdet ihr euren treuen Gästen widmen?
Lukas: Gwen McCrae – Keep The Fire Burning (Atlantic Records, 1982)
Ein grossartiger, tanzbarer Disco-Tune, mit dem ich sehr viele schöne Momente verbinde und der dazu aufruft, die Liebe immer wieder neu zu entfachen. Und das tun ja auch unsere treuen Gäste immer von Neuem.
3 A.M. – I Love This Place (Movin’ Records, 1994)
Klassischer Garage House aus New Jersey und eine Liebeserklärung an „This Place“, die unsere Gäste regelmässig an uns aussprechen.
Julian: Chad Valley – Fall 4 U (Kim Browns 1 Take 2 Tracks Edit)
Dieser Track verkörpert für mich die ganze Hinterhof-Experience. Er verbindet Erinnerungen an laue Sommerabende, durchschwitzte Clubnächte und an viele Momente mit speziellen Menschen. Er beinhaltet auch den Zwischennutzungscharakter des Hinterhofs und die Vergänglichkeit des Moments.
Wie wär’s mal mit...
...etwas mehr musikalischer Neugier und Offenheit beim Ausgehen. And how about some love?

Liebsten Dank an Julian und Lukas, die sich Zeit für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen nahmen und damit dem Hinterhof Artikel die nötige Portion an Zeitlosigkeit verliehen haben. Und natürlich auch ein grosses Danke an Philippe Hersberger und Lukas Riesen, die das ganze Projekt ins Rollen gebracht und bis heute aufrecht erhalten haben. Wir stimmen mit ihrer Einstellung vollkommen überein: How about some love? Sei es in der Basler Clubkultur oder im Alltag.
von Ana Brankovic
am 14.07.2015
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
© Partybilder Michael Hochreutener
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit oder Michael Hochreutender einholen.
Popup Press: Im Gespräch mit den Gründern Adrian und Chris
Passend zu den Themen Tattoo, Sex und Vandalismus lieferten uns die beiden Gründer des Basler Selfpublisher Verlages Popup Press spannende Einblicke in ihr Tun und Schaffen. Seit 2009 vereinen Adrian und Chris die Arbeiten lokaler und internationaler Künstler in kleinen aber feinen Fanzines, welche durch die freundschaftliche Vernetzung rund um die Welt kommen und immer wieder mal an Buchmessen wie beispielsweise I Never Read zu sehen sind.
![]()
Lieber Adrian, Lieber Chris, für alle, die Popup Press nicht kennen – nennt einen Werbespruch für eure Publikationen.
Pop it like it's hot!
Wer oder was steckt hinter Popup Press?
Chris und Adrian: Wir haben Popup Press 2009 zu Viert gestartet, mittlerweile machen wir das hauptsächlich zu Zweit: Adrian in Basel, Christoph in Berlin. Das funktioniert ganz gut bei uns, kein Krampf. Mal macht der Eine 'nen Vorschlag, Mal der Andere. Oft kommen befreundete Künstler auf uns zu, Mal sprechen wir sie an. In einigen Fällen haben wir auch initiativ Leute kontaktiert, die wir noch nicht kannten, weil wir ihre Arbeiten super fanden und es gut in unser Programm passt. Wir bieten jungen KünstlerInnen die Möglichkeit, sich in gedruckter Form zu präsentieren. Die Druckkosten und der Vertrieb werden von uns übernommen und die Künstler erhalten je nach Auflage 10-20 Exemplare ihres Zines. In den letzten Jahren haben sich die Themen Tattoo, Vandalismus und Sex als unsere Haupthemen abgezeichnet, meist in Form von Fotografie oder Zeichnung.
Wenn Popup Press eine Droge wäre, was wäre es und welche Wirkung hätte diese?
Chris: Es wär auf jeden Fall ein Gin Tonic mit 'ner Spur MDMA und 'ner viertel Pappe - is für jeden was dabei. 'Ne Mischung aus Action, grinsen und Farben.
Wem würdet ihr eure Zines empfehlen?
Adrian: Bei uns ist eigentlich für jeden was dabei. Aber unsere Stammkunden sind leider meist tättowierte, sexbesessene Freunde des Vandalismus.
![]()
![]()
Und wem würdet ihr mit den Zines gerne mal ins Gesicht schlagen?
Chris: Allen Nazis - im engeren und weiteren Sinne...
Adrian: ...aber lass uns da vorher noch ein Hardcover Buch machen.
![]()
Wo in Basel hängen Popup Pressler am liebsten rum?
Adrian: Die Fassbar/Sääli ist unser Wohnzimmer,
der Corner (Bushaltestelle Feldbergstrasse) ist unser Garten,
der Rhein unser Pool.
![]()
Welches sind deine 3 unter Popup Press erschiene Lieblinge und weshalb?
Chris: „Born to be“ aus Nostalgie, dies war unser erster Zine Titel. "Red-Handed", da sind viele Homies drin und vielleicht der „Marblelous“ Print von Jean Raphael Ruff. Wir variieren gerne Mal, von Zine, Buch, Shirt bis hin zu Postern und Prints. Übrigens gibt es demnächst das erste Tape.
Jemand gründet Popdown Press und macht genau das Gegenteil von euch, wie antwortet ihr auf das Projekt?
Chris: Da bleiben wir tolerant - ist uns Latte...
Adrian: ...natürlich nicht! Die würden wir kalt machen.
![]()
Was ist euer Wort und Unwort des Jahres, weshalb?
Adrian: Wörter sind auch nur Buchstaben und können nichts dafür!
Mit welchem Song würde eine Popup Press Party enden?
Chris: Curren$y & Harry Fraud ft. Styles P - WOH
Wie wär’s mal mit...
...Banana Split!
![]()
Wir danken Adi und Chris für die spannenden Antworten und die dazu wunderbar passenden rohen Smartphone Bilder. Wer sich sein eigenes Popup Press Zine sichern möchte, kann dies bei Jenny im wunderbaren Basler AISSO Shop oder in der Gallery Daeppen tun.
von Ana Brankovic
am 07.12.2015
Fotos
© Popup Press
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Popup Press einholen.
Passend zu den Themen Tattoo, Sex und Vandalismus lieferten uns die beiden Gründer des Basler Selfpublisher Verlages Popup Press spannende Einblicke in ihr Tun und Schaffen. Seit 2009 vereinen Adrian und Chris die Arbeiten lokaler und internationaler Künstler in kleinen aber feinen Fanzines, welche durch die freundschaftliche Vernetzung rund um die Welt kommen und immer wieder mal an Buchmessen wie beispielsweise I Never Read zu sehen sind.

Lieber Adrian, Lieber Chris, für alle, die Popup Press nicht kennen – nennt einen Werbespruch für eure Publikationen.
Pop it like it's hot!
Wer oder was steckt hinter Popup Press?
Chris und Adrian: Wir haben Popup Press 2009 zu Viert gestartet, mittlerweile machen wir das hauptsächlich zu Zweit: Adrian in Basel, Christoph in Berlin. Das funktioniert ganz gut bei uns, kein Krampf. Mal macht der Eine 'nen Vorschlag, Mal der Andere. Oft kommen befreundete Künstler auf uns zu, Mal sprechen wir sie an. In einigen Fällen haben wir auch initiativ Leute kontaktiert, die wir noch nicht kannten, weil wir ihre Arbeiten super fanden und es gut in unser Programm passt. Wir bieten jungen KünstlerInnen die Möglichkeit, sich in gedruckter Form zu präsentieren. Die Druckkosten und der Vertrieb werden von uns übernommen und die Künstler erhalten je nach Auflage 10-20 Exemplare ihres Zines. In den letzten Jahren haben sich die Themen Tattoo, Vandalismus und Sex als unsere Haupthemen abgezeichnet, meist in Form von Fotografie oder Zeichnung.
Wenn Popup Press eine Droge wäre, was wäre es und welche Wirkung hätte diese?
Chris: Es wär auf jeden Fall ein Gin Tonic mit 'ner Spur MDMA und 'ner viertel Pappe - is für jeden was dabei. 'Ne Mischung aus Action, grinsen und Farben.
Wem würdet ihr eure Zines empfehlen?
Adrian: Bei uns ist eigentlich für jeden was dabei. Aber unsere Stammkunden sind leider meist tättowierte, sexbesessene Freunde des Vandalismus.

Und wem würdet ihr mit den Zines gerne mal ins Gesicht schlagen?
Chris: Allen Nazis - im engeren und weiteren Sinne...
Adrian: ...aber lass uns da vorher noch ein Hardcover Buch machen.
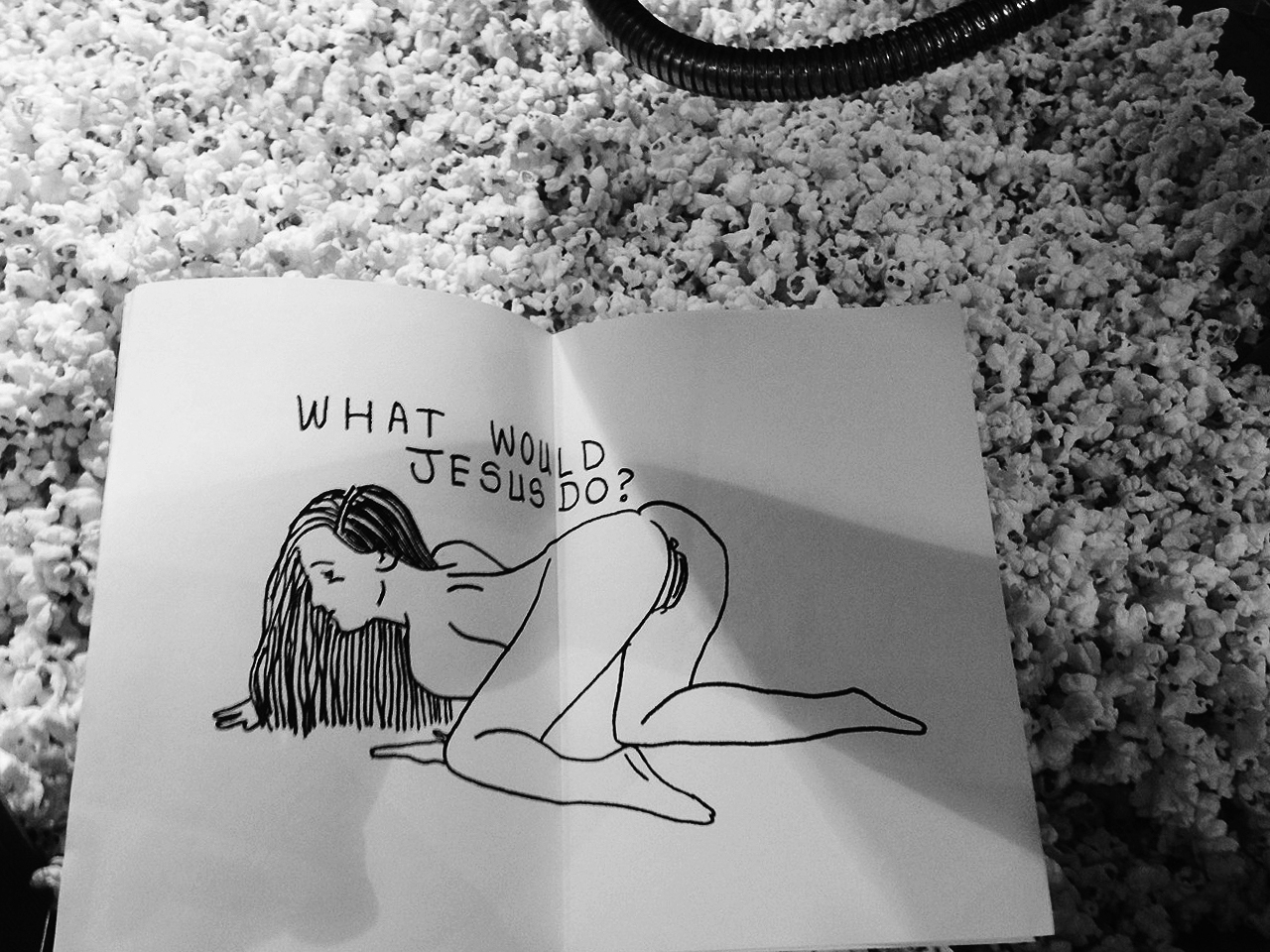
Wo in Basel hängen Popup Pressler am liebsten rum?
Adrian: Die Fassbar/Sääli ist unser Wohnzimmer,
der Corner (Bushaltestelle Feldbergstrasse) ist unser Garten,
der Rhein unser Pool.
Welches sind deine 3 unter Popup Press erschiene Lieblinge und weshalb?
Chris: „Born to be“ aus Nostalgie, dies war unser erster Zine Titel. "Red-Handed", da sind viele Homies drin und vielleicht der „Marblelous“ Print von Jean Raphael Ruff. Wir variieren gerne Mal, von Zine, Buch, Shirt bis hin zu Postern und Prints. Übrigens gibt es demnächst das erste Tape.
Jemand gründet Popdown Press und macht genau das Gegenteil von euch, wie antwortet ihr auf das Projekt?
Chris: Da bleiben wir tolerant - ist uns Latte...
Adrian: ...natürlich nicht! Die würden wir kalt machen.
Was ist euer Wort und Unwort des Jahres, weshalb?
Adrian: Wörter sind auch nur Buchstaben und können nichts dafür!
Mit welchem Song würde eine Popup Press Party enden?
Chris: Curren$y & Harry Fraud ft. Styles P - WOH
Wie wär’s mal mit...
...Banana Split!
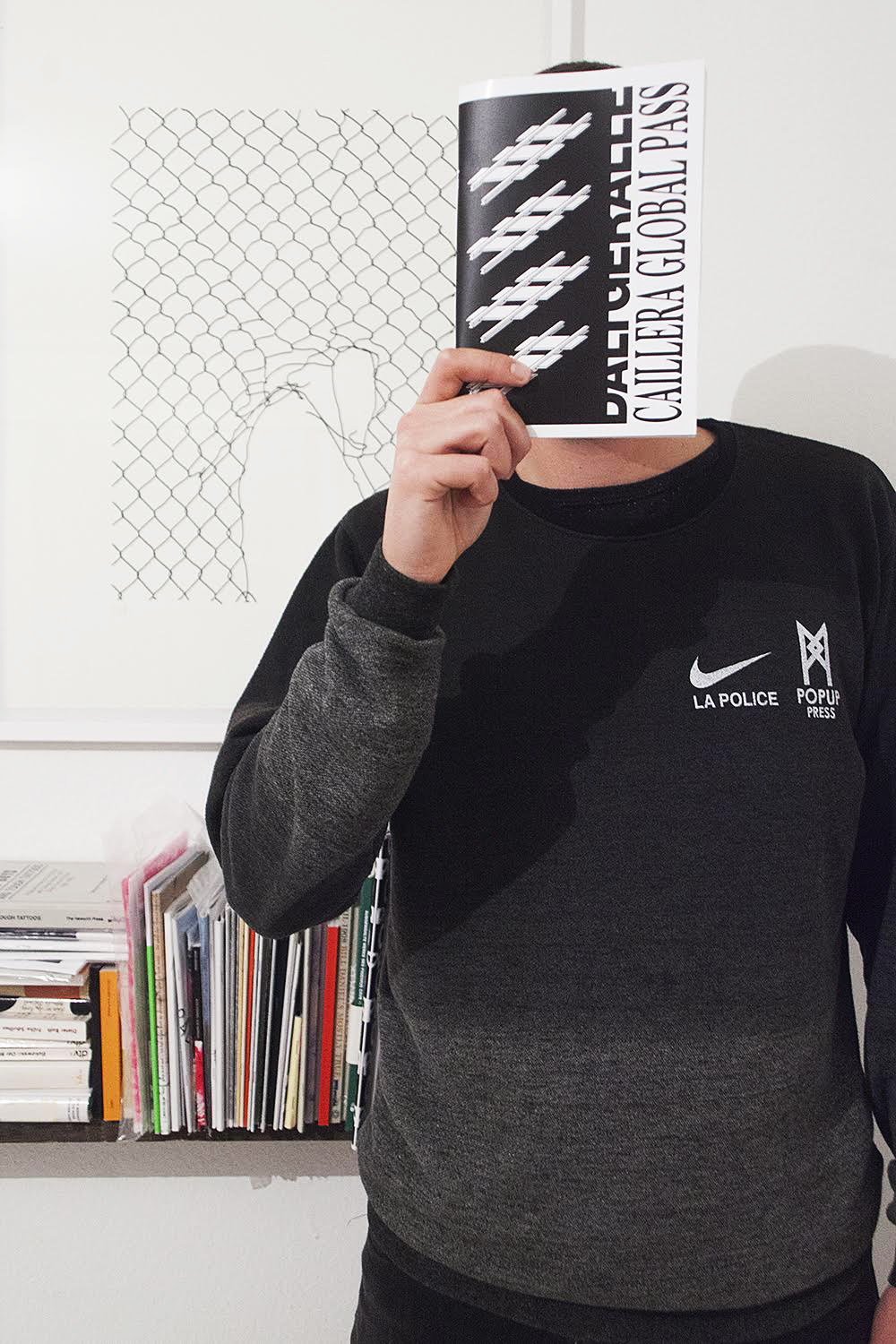
Wir danken Adi und Chris für die spannenden Antworten und die dazu wunderbar passenden rohen Smartphone Bilder. Wer sich sein eigenes Popup Press Zine sichern möchte, kann dies bei Jenny im wunderbaren Basler AISSO Shop oder in der Gallery Daeppen tun.
von Ana Brankovic
am 07.12.2015
Fotos
© Popup Press
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Popup Press einholen.
Zum Goldenen Fass: Im Gespräch mit Bettina Larghi, Gilbert Engelhard und Ueli Gerber
Oft haben wir die Protagonisten unserer Artikel gefragt, welches denn ihr Lieblingsrestaurant in Basel sei. Die Antwort war meist eindeutig das Restaurant Zum Goldenen Fass. Vor zwei Wochen gönnten wir uns einen Drink in der Fass Bar und heute folgt die Fortsetzung mit dem Restaurant und dem Sääli, denn wir trafen das Trio Bettina Larghi, Gilbert Engelhard und Ueli Gerber zu einem Gespräch.
![]()
Hallo ihr Lieben, wer steckt hinter dem Goldenen Fass und seit wann existiert dieses?
Das Fass gibt es schon seit über 30 Jahren und in der heutigen Konstellation seit Herbst 2008. Wir sind alle Quereinsteiger, die allerdings schon vor der Selbstständigkeit jahrzehntelang in der Basler Gastroszene gearbeitet haben. Wir, Bettina Larghi (Restaurant), Gilbert Engelhard (Küche) und Ueli Gerber, führen das Restaurant Zum Goldenen Fass seither. Wobei Ueli bereits 2000 die Fass Bar übernommen hat und seit 2010 auch fürs Programm im Sääli zuständig ist. Auch betreiben wir seit 2013 die Flora Buvette am Kleinbasler Rheinufer als Sommerableger.
Was war in der Liegenschaft, bevor diese zum Goldenen Fass wurde?
Es war vorher eine einfache Herberge und dazu gibt es eine spannende Geschichte, die vor ein paar Jahren bei uns im Sääli als Theaterstück aufgeführt wurde. Mehr dazu siehe hier.
![]()
Zum Goldenen Fass – Wie kam es zur Namensgebung?
Das Haus hiess schon damals so, warum wissen wir nicht. Aber der Name passt.
Wer machte das Konzept für die Inneneinrichtung?
Dies war eine Zusammenarbeit mit Jens Müller und Thomas Wüthrich von Panterapantera, die für das Erscheinungsbild vom Restaurant zuständig waren und fürs Sääli haben wir uns mit Marco Merz und Marion Clauss zusammengetan. Unser Budget war eher klein, daher versuchten wir mit kleinen Änderungen eine grosse Wirkung zu erzielen. Wir haben vorhandene Gegebenheiten, wie den dunklen Parkettboden und die weissen Plättli in der Sääli Bar aufgenommen und weiterentwickelt. Wichtig waren uns auch die schlichten Holztische aus Eiche und ein Lichtkonzept. Die Farbe Schwarz zieht sich als Thema von den Wänden über die Metrokacheln hinter der Bar bis zum Design der Speisekarten durch.
![]()
![]()
Wenn das Goldene Fass ein Song wäre, wie würde es klingen?
Ein Gemisch aus Peter Alexanders Die kleine Kneipe
dem Stonesklassiker Paint it Black
und Iggy Pops Hymne Lust for Life
Beschreibe euren Teamspirit in einem treffenden Satz.
„One Love“ oder "Alle machen Alles."
![]()
Beschreibt eure Gäste in 3 Adjektiven.
Offen, ess- und trinkfreudig
Kundenkontakt – was war bisher euer lustigstes Ereignis?
Im Sääli gab es regelmässig so genannte Singlepartys, d.h. es wurden die kleinen 7 inch Schallplatten aufgelegt. Anfänglich kamen aber Gäste, welche eine Partnerbörse erwarteten – wobei beim Tanzen kann sich so was auch gut finden lassen.
![]()
![]()
Was kann man bei euch Essen?
Unsere Küche ist frisch, schnörkellos und kreativ. Alles ist hausgemacht vom Brot über die Saucen bis zur Wurst oder Pasta. Alle zwei Wochen wird das Angebot auf der grossen Karte gewechselt. Das Spezielle ist, dass wir sowohl ein 3-, 4- oder 5-Gangmenü Surprise, als auch einfache Gerichte wie Fish & Chips anbieten. Denn uns ist es wichtig, dass auch fürs kleine Budget etwas dabei ist. Die kleine Karte gibt es für Spätesser bis 23:30 Uhr, eine gute Alternative zu einem Döner. Unsere aktuelle Karte findet ihr auf unserer Website unter hier.
![]()
![]()
![]()
Was mögt ihr am Goldenen Fass?
Die Mischung aus unserem Team und den immer wieder neu zusammen gewürfelten Gästekombinationen. Viele Mitarbeiter sind schon seit Beginn mit dabei, es ist ein tolles Team, welches das Fass mit ausmacht. So kommt es öfters vor, dass wir unsere Freizeit gerne auch mal im Fass verbringen.
Weshalb sollte unsere Leserschaft unbedingt ins Goldene Fass kommen?
In unserem kleinen „3-Sparten-Haus“ kannst Du die ganze Nacht verbringen: Erst Apéro in der Bar, dann fein essen im Restaurant, danach bis spät Kultur & Nightlife im Sääli.
![]()
![]()
Wo in Basel geht ihr persönlich gerne hin?
Wir sind hauptsächlich im Kleinbasel unterwegs und empfehlen da Graziella (Espresso & Arancinis), Avant-Gouz (Sandwiches), Gatto Nero (Salat & Risotto), Flore (Wein), KaBar (Sonnenterasse), la Fourchette (Tarte Tatin), Café Frühling (Cappuccino), Renée (Whiskey -, Champagnerauswahl & Öffnungszeiten), Plattfon (gute Musik), Brockis (Lämpli), Claudia Güdel (Mäntel), Riviera (neues Outfit), Marinsel (Geschenkideen). Im Grossbasel essen wir z.B. gerne bei 5 Signori.
![]()
![]()
Wie sieht ein perfektes Weekend aus in Basel?
Schlafen, gut essen und Sonne am Rhein – that's it!
Wie wär's mal mit...
...essen, trinken und tanzen bei uns im Fass und mehr Trinkgeld!
![]()
Danke, Danke, Danke dem Trio für den Einblick und für das Interview. Kalte Wintertage laden zu gemütlichen und warmen Abenden im Fass ein. Ein goldenes Beispiel sind Gilbis Moules et Frites, damit wird bei Minusgraden die Sehnsucht vom warmen Süden gestillt – Ä Guetä!
von Derya Cukadar
am 30.11.2015
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.

Hallo ihr Lieben, wer steckt hinter dem Goldenen Fass und seit wann existiert dieses?
Das Fass gibt es schon seit über 30 Jahren und in der heutigen Konstellation seit Herbst 2008. Wir sind alle Quereinsteiger, die allerdings schon vor der Selbstständigkeit jahrzehntelang in der Basler Gastroszene gearbeitet haben. Wir, Bettina Larghi (Restaurant), Gilbert Engelhard (Küche) und Ueli Gerber, führen das Restaurant Zum Goldenen Fass seither. Wobei Ueli bereits 2000 die Fass Bar übernommen hat und seit 2010 auch fürs Programm im Sääli zuständig ist. Auch betreiben wir seit 2013 die Flora Buvette am Kleinbasler Rheinufer als Sommerableger.
Was war in der Liegenschaft, bevor diese zum Goldenen Fass wurde?
Es war vorher eine einfache Herberge und dazu gibt es eine spannende Geschichte, die vor ein paar Jahren bei uns im Sääli als Theaterstück aufgeführt wurde. Mehr dazu siehe hier.

Zum Goldenen Fass – Wie kam es zur Namensgebung?
Das Haus hiess schon damals so, warum wissen wir nicht. Aber der Name passt.
Wer machte das Konzept für die Inneneinrichtung?
Dies war eine Zusammenarbeit mit Jens Müller und Thomas Wüthrich von Panterapantera, die für das Erscheinungsbild vom Restaurant zuständig waren und fürs Sääli haben wir uns mit Marco Merz und Marion Clauss zusammengetan. Unser Budget war eher klein, daher versuchten wir mit kleinen Änderungen eine grosse Wirkung zu erzielen. Wir haben vorhandene Gegebenheiten, wie den dunklen Parkettboden und die weissen Plättli in der Sääli Bar aufgenommen und weiterentwickelt. Wichtig waren uns auch die schlichten Holztische aus Eiche und ein Lichtkonzept. Die Farbe Schwarz zieht sich als Thema von den Wänden über die Metrokacheln hinter der Bar bis zum Design der Speisekarten durch.


Wenn das Goldene Fass ein Song wäre, wie würde es klingen?
Ein Gemisch aus Peter Alexanders Die kleine Kneipe
dem Stonesklassiker Paint it Black
und Iggy Pops Hymne Lust for Life
Beschreibe euren Teamspirit in einem treffenden Satz.
„One Love“ oder "Alle machen Alles."

Beschreibt eure Gäste in 3 Adjektiven.
Offen, ess- und trinkfreudig
Kundenkontakt – was war bisher euer lustigstes Ereignis?
Im Sääli gab es regelmässig so genannte Singlepartys, d.h. es wurden die kleinen 7 inch Schallplatten aufgelegt. Anfänglich kamen aber Gäste, welche eine Partnerbörse erwarteten – wobei beim Tanzen kann sich so was auch gut finden lassen.


Was kann man bei euch Essen?
Unsere Küche ist frisch, schnörkellos und kreativ. Alles ist hausgemacht vom Brot über die Saucen bis zur Wurst oder Pasta. Alle zwei Wochen wird das Angebot auf der grossen Karte gewechselt. Das Spezielle ist, dass wir sowohl ein 3-, 4- oder 5-Gangmenü Surprise, als auch einfache Gerichte wie Fish & Chips anbieten. Denn uns ist es wichtig, dass auch fürs kleine Budget etwas dabei ist. Die kleine Karte gibt es für Spätesser bis 23:30 Uhr, eine gute Alternative zu einem Döner. Unsere aktuelle Karte findet ihr auf unserer Website unter hier.



Was mögt ihr am Goldenen Fass?
Die Mischung aus unserem Team und den immer wieder neu zusammen gewürfelten Gästekombinationen. Viele Mitarbeiter sind schon seit Beginn mit dabei, es ist ein tolles Team, welches das Fass mit ausmacht. So kommt es öfters vor, dass wir unsere Freizeit gerne auch mal im Fass verbringen.
Weshalb sollte unsere Leserschaft unbedingt ins Goldene Fass kommen?
In unserem kleinen „3-Sparten-Haus“ kannst Du die ganze Nacht verbringen: Erst Apéro in der Bar, dann fein essen im Restaurant, danach bis spät Kultur & Nightlife im Sääli.


Wo in Basel geht ihr persönlich gerne hin?
Wir sind hauptsächlich im Kleinbasel unterwegs und empfehlen da Graziella (Espresso & Arancinis), Avant-Gouz (Sandwiches), Gatto Nero (Salat & Risotto), Flore (Wein), KaBar (Sonnenterasse), la Fourchette (Tarte Tatin), Café Frühling (Cappuccino), Renée (Whiskey -, Champagnerauswahl & Öffnungszeiten), Plattfon (gute Musik), Brockis (Lämpli), Claudia Güdel (Mäntel), Riviera (neues Outfit), Marinsel (Geschenkideen). Im Grossbasel essen wir z.B. gerne bei 5 Signori.


Wie sieht ein perfektes Weekend aus in Basel?
Schlafen, gut essen und Sonne am Rhein – that's it!
Wie wär's mal mit...
...essen, trinken und tanzen bei uns im Fass und mehr Trinkgeld!

Danke, Danke, Danke dem Trio für den Einblick und für das Interview. Kalte Wintertage laden zu gemütlichen und warmen Abenden im Fass ein. Ein goldenes Beispiel sind Gilbis Moules et Frites, damit wird bei Minusgraden die Sehnsucht vom warmen Süden gestillt – Ä Guetä!
von Derya Cukadar
am 30.11.2015
Fotos
© Oliver Hochstrasser für Wie wär's mal mit
Wer die Bilder weiterverwenden möchte, muss sich die Rechte bei Wie wär’s mal mit einholen.
James Gruntz: Im Gespräch mit dem Schweizer Musiker
Wie wärs mal mit frischer, guter Musik? Das 27-jährige Schweizer Multitalent namens James Gruntz beglückt die Schweiz derzeit mit einer Tour. Hingehen lohnt sich, denn der musikalische Autodidakt gewann nicht nur den Basler Pop Preis 2014, sondern stürmt diverse Charts. Sein Album Belvedere umfasst Blues, Beats und Balladen. Seine Musik ist nachdenklich, tanzbar und herzerwämend.
![]()
James, im 2014 hast Du den Basler Pop-Preis gewonnen, was ist Basel deiner Meinung nach: Kulturstadt oder ländlicher Szenetreff?
Kulturstadt, ganz klar. Da kommt man nicht nur zusammen, da lebt man auch. Ausserdem gibt es in Basel vorwiegend Basel. Also eine Szene im Land, vielleicht. Noch weiter wird aber meinem Gefühl nach nicht unterteilt. Deshalb gilt "Szeni" auch noch nicht als Schimpfwort und man geht immer noch in die Mitte.
Das Album Belvedere umfasst Blues, Beats und Balladen: Welche Musik erwärmt dein Herz?
Gute Musik, ganz klar. Stilrichtungen sind Hilfen für Unwissende, im schlimmsten Fall Gefühlstote, im Endeffekt aber unnötig und stumpf. Zum Tauchen braucht man keinen Schorchel, und man merkt rasch, dass unter der Oberfläche alles anders ist, oder alles gleich.
Wenn dein neues Album Belvedere eine Farbe wäre, welche wäre das und wieso?
Das weiss ich ganz genau: Pantone 3272 C - eine Art Türkis. Die findet man überall auf den Drucksachen von "Belvedere".
Im Basler Zolli: Welches Tier entspricht deiner Musik?
Ui, der Zolli und die Tiere. Vielleicht am ehesten dem Zolli selber. Aber ohne die Tiere. Ausser den Störchen vielleicht.
Was sind deine musikalischen Vorsätze fürs 2015?
Ich singe vor den Konzerten nie ein und mache mir auch keine Vorsätze. Das ist mir zu sportlich. Die wichtigen Dinge passieren eh nicht so wie geplant, und wichtig, das mag ich.
Wie wär's mal mit...
...Gemütlichkeit.
_
von Simone Kuster
im Januar 2015
Foto: James Gruntz
Wie wärs mal mit frischer, guter Musik? Das 27-jährige Schweizer Multitalent namens James Gruntz beglückt die Schweiz derzeit mit einer Tour. Hingehen lohnt sich, denn der musikalische Autodidakt gewann nicht nur den Basler Pop Preis 2014, sondern stürmt diverse Charts. Sein Album Belvedere umfasst Blues, Beats und Balladen. Seine Musik ist nachdenklich, tanzbar und herzerwämend.

James, im 2014 hast Du den Basler Pop-Preis gewonnen, was ist Basel deiner Meinung nach: Kulturstadt oder ländlicher Szenetreff?
Kulturstadt, ganz klar. Da kommt man nicht nur zusammen, da lebt man auch. Ausserdem gibt es in Basel vorwiegend Basel. Also eine Szene im Land, vielleicht. Noch weiter wird aber meinem Gefühl nach nicht unterteilt. Deshalb gilt "Szeni" auch noch nicht als Schimpfwort und man geht immer noch in die Mitte.
Das Album Belvedere umfasst Blues, Beats und Balladen: Welche Musik erwärmt dein Herz?
Gute Musik, ganz klar. Stilrichtungen sind Hilfen für Unwissende, im schlimmsten Fall Gefühlstote, im Endeffekt aber unnötig und stumpf. Zum Tauchen braucht man keinen Schorchel, und man merkt rasch, dass unter der Oberfläche alles anders ist, oder alles gleich.
Wenn dein neues Album Belvedere eine Farbe wäre, welche wäre das und wieso?
Das weiss ich ganz genau: Pantone 3272 C - eine Art Türkis. Die findet man überall auf den Drucksachen von "Belvedere".
Im Basler Zolli: Welches Tier entspricht deiner Musik?
Ui, der Zolli und die Tiere. Vielleicht am ehesten dem Zolli selber. Aber ohne die Tiere. Ausser den Störchen vielleicht.
Was sind deine musikalischen Vorsätze fürs 2015?
Ich singe vor den Konzerten nie ein und mache mir auch keine Vorsätze. Das ist mir zu sportlich. Die wichtigen Dinge passieren eh nicht so wie geplant, und wichtig, das mag ich.
Wie wär's mal mit...
...Gemütlichkeit.
_
von Simone Kuster
im Januar 2015
Foto: James Gruntz
Lieber eine Ecke ab haben
Man muss nicht weit reisen oder stundenlang im Internet verweilen, um Neues und Aufregendes zu entdecken - denn direkt vor der Haustür, gleich ums Eck spielen sich tolle Szenen ab. Und vielleicht hat ja dein Nachbar, der täglich um 20 Uhr mit seinem Malteser Gassi geht die spannendere Story zu erzählen als Instagram?
Wie wär's mal mit tollen Eindrücken gleich bei dir um die Ecke?
Ana und Derya haben für euch ihre Wohnecken visuell erforscht und hin und wieder mal ein interessantes Schwätzchen mit ihren Nachbarn gehalten - Hashtag Alltagskultur.
Auch du hast eine Stadt, ein Zuhause, einen Viertel, eine Gegend, eine Strasse, einen Block - nicht nur der Berliner Rapper Sido.
An der Ecke Gundeldingerstrasse/Gempenstrasse - von Derya Cukadar
Gündelü, 4053, G-Undeli - in diesem Quartier ist Derya aufgewachsen.
![]()
![]()
Aller guten Dinge sind drei - so auch das Gundeldingen, welches in die folgenden drei Wohnbezirke unterteilt ist:
Margarethen (Bahnhof SBB, Winkelriedplatz, Pruntrutermatte)
Thierstein (Bruderholzstrasse, Tellplatz, Liesbergermatte)
Delsbergerallee (Heiliggeistkirche, Delsbergerallee)
![]()
![]()
Ob Jugendtreffpunkt, ein Kinderspielplatz oder spannende Strassenmalereien - die kunterbunte Mischung schmückt in diesem Quartier das Stadtbild.
![]()
![]()
Das Gundeli liegt im südlichen Teil von Basel und ist mindestens genau so warmherzig und lebendig wie man es sich aus den Südstaaten gewohnt ist.
![]()
![]()
Vom trendigen Seven Sneaker Store, über frisches Fladenbrot aus dem Murat Imbiss bis hin zum großzügigen Kulturangebot vom Gundeldinger Feld - das Quartier bietet für jedermann was. Allein schon der abendliche Spaziergang bietet den Sinnen ein wahres Kino.
![]()
![]()
An der Ecke Austrasse/Burgunderstrasse - von Ana Brankovic
Nur knappe 10 Minuten Velofahrt vom Gundeli und Derya entfernt ist Ana zuhause - im wunderschönen Spalenquartier umgeben von all seinen Schätzen.
![]()
![]()
Hier im jüdischen Basler Viertel gibt es an der Ecke Austrasse/Burgunderstrasse einiges zu entdecken: Nebst einem spannenden Generationenclash von Babies, Studenten bis hin zu Rentnern und allen Dazwischenliegenden finden sich beim genaueren Hinsehen zahlreiche interessante Institutionen und Gebäude - so beispielsweise die jüdische Bäckerei Schmutz, das Möbelatelier Jakob & Partner, ein Kaffeemaschinenhandel namens Moratex sowie das Kinderhuus Zottelbär.
![]()
![]()
![]()
![]()
Doch nicht nur das: Wie wär's mal mit einer wunderschönen grünen Oase in der Stadt? Schon manche gemütliche Abende wurden hier unter den Liebsten verbracht - und ja: auch süsse Schildkröten und andere Teichbewohner sind hier im Quartier sesshaft geworden.
![]()
![]()
![]()
Grau in Grau kann auch entzücken - natürlich nur, wenn von der Natur als Gestein gegeben und mit viel Liebe zum Detail versehen.
![]()
Und ach ja, da war da noch die an The Great Gatsby erinnernde Gartendusche.
![]()
Nun ist es allmählich an der Zeit, den Garten Eden zu verlassen und ins Studentenleben einzutauchen.
![]()
![]()
An der Burgunderstrasse finden sich nämlich auch zwei WG Häuser von der WoVe Basel: für Studenten und Praktikanten only.
![]()
![]()
![]()
![]()
Sei dies ein Bachelor- oder Masterstudium in Musik, Mode, Szenografie, Visueller Kommunikation oder ein Praktikum bei Herzog und De Meuron - hier vereinen sich alle harmonisch unter einem Dach.
![]()
![]()
Auch die wunderbar benannte Feierabendstrasse kreuzt die Burgunderstrasse - und siehe da: nicht nur Paris hat eine Kirche namens Sacré-Cœur, nein auch in Basel an der Feierabendstrasse 66 geht's gleichnamig sakral zu und her.
Und was wäre eine Strasse ohne einen unheimlichen Mythos? Hier an der Ecke Austrasse/Burgunderstrasse steht nämlich auch ein Haus, welches seit Jahren alle Fenster bis aufs oberste Geschoss geschlossen hält - ob da wohl eine neue WG entsteht? Wer weiss..
![]()
Wir gehen liebend gerne in unseren Quartieren spazieren und stossen dabei immer wieder auf interessante Nachbarn und Geschichten aus dem Alltag - falls auch du an deiner Ecke Spannendes zu berichten hast, gerne her damit!
_
von Ana Brankovic und Derya Cukadar
am 01.12.2014
Fotos
© Wie wär's mal mit
Man muss nicht weit reisen oder stundenlang im Internet verweilen, um Neues und Aufregendes zu entdecken - denn direkt vor der Haustür, gleich ums Eck spielen sich tolle Szenen ab. Und vielleicht hat ja dein Nachbar, der täglich um 20 Uhr mit seinem Malteser Gassi geht die spannendere Story zu erzählen als Instagram?
Wie wär's mal mit tollen Eindrücken gleich bei dir um die Ecke?
Ana und Derya haben für euch ihre Wohnecken visuell erforscht und hin und wieder mal ein interessantes Schwätzchen mit ihren Nachbarn gehalten - Hashtag Alltagskultur.
Auch du hast eine Stadt, ein Zuhause, einen Viertel, eine Gegend, eine Strasse, einen Block - nicht nur der Berliner Rapper Sido.
An der Ecke Gundeldingerstrasse/Gempenstrasse - von Derya Cukadar
Gündelü, 4053, G-Undeli - in diesem Quartier ist Derya aufgewachsen.
Aller guten Dinge sind drei - so auch das Gundeldingen, welches in die folgenden drei Wohnbezirke unterteilt ist:
Margarethen (Bahnhof SBB, Winkelriedplatz, Pruntrutermatte)
Thierstein (Bruderholzstrasse, Tellplatz, Liesbergermatte)
Delsbergerallee (Heiliggeistkirche, Delsbergerallee)
Ob Jugendtreffpunkt, ein Kinderspielplatz oder spannende Strassenmalereien - die kunterbunte Mischung schmückt in diesem Quartier das Stadtbild.
Das Gundeli liegt im südlichen Teil von Basel und ist mindestens genau so warmherzig und lebendig wie man es sich aus den Südstaaten gewohnt ist.
Vom trendigen Seven Sneaker Store, über frisches Fladenbrot aus dem Murat Imbiss bis hin zum großzügigen Kulturangebot vom Gundeldinger Feld - das Quartier bietet für jedermann was. Allein schon der abendliche Spaziergang bietet den Sinnen ein wahres Kino.
An der Ecke Austrasse/Burgunderstrasse - von Ana Brankovic
Nur knappe 10 Minuten Velofahrt vom Gundeli und Derya entfernt ist Ana zuhause - im wunderschönen Spalenquartier umgeben von all seinen Schätzen.
Hier im jüdischen Basler Viertel gibt es an der Ecke Austrasse/Burgunderstrasse einiges zu entdecken: Nebst einem spannenden Generationenclash von Babies, Studenten bis hin zu Rentnern und allen Dazwischenliegenden finden sich beim genaueren Hinsehen zahlreiche interessante Institutionen und Gebäude - so beispielsweise die jüdische Bäckerei Schmutz, das Möbelatelier Jakob & Partner, ein Kaffeemaschinenhandel namens Moratex sowie das Kinderhuus Zottelbär.
Doch nicht nur das: Wie wär's mal mit einer wunderschönen grünen Oase in der Stadt? Schon manche gemütliche Abende wurden hier unter den Liebsten verbracht - und ja: auch süsse Schildkröten und andere Teichbewohner sind hier im Quartier sesshaft geworden.
Grau in Grau kann auch entzücken - natürlich nur, wenn von der Natur als Gestein gegeben und mit viel Liebe zum Detail versehen.
Und ach ja, da war da noch die an The Great Gatsby erinnernde Gartendusche.
Nun ist es allmählich an der Zeit, den Garten Eden zu verlassen und ins Studentenleben einzutauchen.
An der Burgunderstrasse finden sich nämlich auch zwei WG Häuser von der WoVe Basel: für Studenten und Praktikanten only.
Sei dies ein Bachelor- oder Masterstudium in Musik, Mode, Szenografie, Visueller Kommunikation oder ein Praktikum bei Herzog und De Meuron - hier vereinen sich alle harmonisch unter einem Dach.
Auch die wunderbar benannte Feierabendstrasse kreuzt die Burgunderstrasse - und siehe da: nicht nur Paris hat eine Kirche namens Sacré-Cœur, nein auch in Basel an der Feierabendstrasse 66 geht's gleichnamig sakral zu und her.
Und was wäre eine Strasse ohne einen unheimlichen Mythos? Hier an der Ecke Austrasse/Burgunderstrasse steht nämlich auch ein Haus, welches seit Jahren alle Fenster bis aufs oberste Geschoss geschlossen hält - ob da wohl eine neue WG entsteht? Wer weiss..
Wir gehen liebend gerne in unseren Quartieren spazieren und stossen dabei immer wieder auf interessante Nachbarn und Geschichten aus dem Alltag - falls auch du an deiner Ecke Spannendes zu berichten hast, gerne her damit!
_
von Ana Brankovic und Derya Cukadar
am 01.12.2014
Fotos
© Wie wär's mal mit
Cyberdiät mit Sommerschnee und Alpendüften
Kalte, klare Bergluft. Wir ziehen uns gerne in die atemberaubende Natur zurück, um die Zeit für einen kurzen Moment zu entschleunigen und neue Wege ausserhalb der Stadt zu erkunden. So auch Laure Aebi, welche sich für uns die Zeit nahm auf ihrer faszinierenden Bergtour mit Freunden tolle Momentaufnahmen zu knipsen und ihre Erlebnisse in Worte zu fassen - diese könnt ihr im Folgenden nachlesen. Nun, wie wär's mal mit ein bisschen Sommerschnee und frischen Alpendüften passend zur allmählich spürbaren Kältewelle in Basel?
![]()
Raus aus der Stadt – rauf auf die Berge! Die Route führt uns von Curaglia durch Heidelbeerbüsche hoch zur urchig-gemütlichen Medelserhütte. Dort legen wir mit blauen Zungen die Rucksäcke ab und klettern hinter der Hütte auf den Piz Caschleglia - denn wir wollen heute noch vom Gipfel aus ins Tal hinunter sehen.
![]()
Oben angekommen sehen wir allerdings nichts ausser uns selbst. Lediglich das Gipfelbuch und die nasse Stirn bestätigen, dass wir nun 2676 Meter über Basel sitzen. Unten (und doch oben) in der Medelserhütte verbringen wir einen Abend in der warmen Stube mit Bärgler-Z’Nacht, Jass sowie Kaffi Pflüümli und lassen uns vor der frühen Nachtruhe vom Hüttenwart das Wetter prognostizieren und den Tourentee ausschenken.
![]()
Die Nacht ist kurz, der Morgen hektisch. Nach dem nahrhaften Z’Morge um 6 Uhr früh und einem Gesichtsbad mit eiskaltem, klaren Bergwasser starten wir unsere Tour unter tanzenden Schneeflocken in den dicken Nebel hinein.
Schon bald stehen wir unten am Glatscher da Lavaz, der laut Hüttenwart problemlos ohne Steigeisen überquert werden kann. Wir stapfen also drauflos und suchen uns einen Weg - denn das Ende des Gletschers ist wegen des Nebels nicht in Sicht. Bald schon sitzen wir im Seich: Zu früh verlassen wir die Moräne und stehen am abgrundtiefen Eishang.
![]()
Der Blick nach rechts zeigt eine hohe, eisige Schneefläche, der Blick nach links führt steil nach unten, wo zackige Steine und Spalten still daliegen. Einer von uns steht mitten in einem Eisfeld und kann sich nicht weiter bewegen, ohne sich einen wahrscheinlichen Rutsch in die spitzen Steine zu gönnen. Mit Geschick montiert er seine Steigeisen, die er als Einziger von uns glücklicherweise dabei hat. Mit den Eisen am Schuh überquert er nun am bequemsten und sichersten den Gletscher.
![]()
Ich stapfe weiter in meinen hier in der unsicheren Umgebung lächerlichen Wanderschuhen und spüre nicht nur das Gewicht meines Rucksacks auf den Schultern, sondern auch einen schweren Klumpen, der mir tief im Magen hockt - wie nach einer weihnächtlichen Raclettevöllerei, jedoch alles andere als wohlig schmeckend.
Zurück auf der Moräne kraxeln wir auf allen Vieren weiter und erreichen endlich die Fuorcla Sura da Lavaz. Hier oben stehen wir an der Scheide zwischen Graubünden und Tessin, Norden und Süden, dem neblignassen Gletscher und der lang ersehnten Greinaebene.
![]()
Durch Geröll steigen wir ab und stechen mitten in die herrlich sonnige Greina. Unterwegs treffen wir zwei Russen in Trekkingschuhen an, die noch naiver als wir den herzigen Glatscher da Lavaz überqueren wollen. Wir warnen sie vor und spazieren weiter durch die Greina, die sich in altweibersommerlichen Farben vor uns erstreckt und mit glitzernden Bächlein, Murmeli und Edelweiss stolz ihre ocker-grün-silberne Schönheit zelebriert.
![]()
Bezirzt von der Greinapracht und entspannt nach dem aufregenden Morgen gelangen wir zur Motterasciohütte, wo wir mit wärmenden Sonnenstrahlen, Bergpanorama und Blick auf den Lago di Luzzone belohnt werden. Der Abstieg zum Stausee führt entlang einer tiefen, azurnen Schlucht.
Am Seeufer kaufen wir Tessiner Alpkäse und frischen Joghurt währendem wir auf den Alpenbus warten, der uns nach Malvaglia bringt. Dort verbringen wir nämlich drei Tage in einem steinernen Tessiner Dorfhaus und lassen unsere Bergtour damit wunderbar ausklingen.
_
von Laure Aebi
am 24.11.2014
Fotos
© Lorea Schönenberger
Kalte, klare Bergluft. Wir ziehen uns gerne in die atemberaubende Natur zurück, um die Zeit für einen kurzen Moment zu entschleunigen und neue Wege ausserhalb der Stadt zu erkunden. So auch Laure Aebi, welche sich für uns die Zeit nahm auf ihrer faszinierenden Bergtour mit Freunden tolle Momentaufnahmen zu knipsen und ihre Erlebnisse in Worte zu fassen - diese könnt ihr im Folgenden nachlesen. Nun, wie wär's mal mit ein bisschen Sommerschnee und frischen Alpendüften passend zur allmählich spürbaren Kältewelle in Basel?

Raus aus der Stadt – rauf auf die Berge! Die Route führt uns von Curaglia durch Heidelbeerbüsche hoch zur urchig-gemütlichen Medelserhütte. Dort legen wir mit blauen Zungen die Rucksäcke ab und klettern hinter der Hütte auf den Piz Caschleglia - denn wir wollen heute noch vom Gipfel aus ins Tal hinunter sehen.

Oben angekommen sehen wir allerdings nichts ausser uns selbst. Lediglich das Gipfelbuch und die nasse Stirn bestätigen, dass wir nun 2676 Meter über Basel sitzen. Unten (und doch oben) in der Medelserhütte verbringen wir einen Abend in der warmen Stube mit Bärgler-Z’Nacht, Jass sowie Kaffi Pflüümli und lassen uns vor der frühen Nachtruhe vom Hüttenwart das Wetter prognostizieren und den Tourentee ausschenken.

Die Nacht ist kurz, der Morgen hektisch. Nach dem nahrhaften Z’Morge um 6 Uhr früh und einem Gesichtsbad mit eiskaltem, klaren Bergwasser starten wir unsere Tour unter tanzenden Schneeflocken in den dicken Nebel hinein.
Schon bald stehen wir unten am Glatscher da Lavaz, der laut Hüttenwart problemlos ohne Steigeisen überquert werden kann. Wir stapfen also drauflos und suchen uns einen Weg - denn das Ende des Gletschers ist wegen des Nebels nicht in Sicht. Bald schon sitzen wir im Seich: Zu früh verlassen wir die Moräne und stehen am abgrundtiefen Eishang.

Der Blick nach rechts zeigt eine hohe, eisige Schneefläche, der Blick nach links führt steil nach unten, wo zackige Steine und Spalten still daliegen. Einer von uns steht mitten in einem Eisfeld und kann sich nicht weiter bewegen, ohne sich einen wahrscheinlichen Rutsch in die spitzen Steine zu gönnen. Mit Geschick montiert er seine Steigeisen, die er als Einziger von uns glücklicherweise dabei hat. Mit den Eisen am Schuh überquert er nun am bequemsten und sichersten den Gletscher.
Ich stapfe weiter in meinen hier in der unsicheren Umgebung lächerlichen Wanderschuhen und spüre nicht nur das Gewicht meines Rucksacks auf den Schultern, sondern auch einen schweren Klumpen, der mir tief im Magen hockt - wie nach einer weihnächtlichen Raclettevöllerei, jedoch alles andere als wohlig schmeckend.
Zurück auf der Moräne kraxeln wir auf allen Vieren weiter und erreichen endlich die Fuorcla Sura da Lavaz. Hier oben stehen wir an der Scheide zwischen Graubünden und Tessin, Norden und Süden, dem neblignassen Gletscher und der lang ersehnten Greinaebene.

Durch Geröll steigen wir ab und stechen mitten in die herrlich sonnige Greina. Unterwegs treffen wir zwei Russen in Trekkingschuhen an, die noch naiver als wir den herzigen Glatscher da Lavaz überqueren wollen. Wir warnen sie vor und spazieren weiter durch die Greina, die sich in altweibersommerlichen Farben vor uns erstreckt und mit glitzernden Bächlein, Murmeli und Edelweiss stolz ihre ocker-grün-silberne Schönheit zelebriert.

Bezirzt von der Greinapracht und entspannt nach dem aufregenden Morgen gelangen wir zur Motterasciohütte, wo wir mit wärmenden Sonnenstrahlen, Bergpanorama und Blick auf den Lago di Luzzone belohnt werden. Der Abstieg zum Stausee führt entlang einer tiefen, azurnen Schlucht.
Am Seeufer kaufen wir Tessiner Alpkäse und frischen Joghurt währendem wir auf den Alpenbus warten, der uns nach Malvaglia bringt. Dort verbringen wir nämlich drei Tage in einem steinernen Tessiner Dorfhaus und lassen unsere Bergtour damit wunderbar ausklingen.
_
von Laure Aebi
am 24.11.2014
Fotos
© Lorea Schönenberger
Nächster Halt: Weltstadt Basel
Einer der wohl angenehmsten Nichtstuer-Tage ist der Sonntag - und dieser sollte am liebsten nie enden.
Wer kennt es nicht: Es ist 17 Uhr und man fragt sich, was man denn bloss Leckeres zum Znacht kochen soll - und vor allem: wo kriegt man an einem Sonntag in der Schweiz die nötigen Zutaten dazu? Wer nun glaubt, Spätis gäbe es nur in Berlin, der irrt sich gewaltig - Basel kann da locker mithalten. Wie wärs mal mit einem kulinarischen Sonntagsausflug rund um die Welt bis nach Indien?
![]()
![]()
Unseren ersten leckeren Zwischenhalt machen wir bei Familie Vivegananthan in der Küchengasse 9 am Bahnhof SBB. Dort warten exotische Köstlichkeiten wie frischer Fisch aus Sri Lanka, Gemüse und Früchte aus Thailand, Indien und Afrika, sowie unser absoluter Favorit: das exotische Knabberzeug wie z.B. gesalzene Bananenchips für den regelmässigen Tatort Fernsehabend am Sonntag.
![]()
![]()
Suru und Dekan, die beiden Geschwister aus Sri Lanka, helfen ihrem Vater gerne in seinem Lebensmittel Lädeli aus und sind eine sehr freundliche Anlaufstelle bei allerlei Fragen zu den noch unbekannten Produkten - welche übrigens in Nu unseren hungrigen Gaumen erobert haben.
![]()
Ihre kulturelle Offenheit und Zugänglichkeit färbt aber auch positiv auf die Kundschaft ab: hin und wieder bekommt man hier tolle Rezepte von netten Miteinkäufern zugesteckt, die man zuvor noch nie gesehen hat. Liebe scheint wohl tatsächlich durch den Magen zu gehen.
![]()
Vom kleinen Sri Lanka am Bahnhof SBB geht’s mit dem 30er Bus weiter zum Kontinent Indien beim Erasmusplatz. Kurz nachdem man den Basler Ganges via Johanniterbrücke überquert hat, stösst man auf den Imbiss Singh Indian Food. Auch wenn die Aussentemperatur nicht wie gwünscht tropisch mitspielt, zaubern einem die wahrscheinlich köstlichsten und knusprigsten Samosas der Stadt ein wohlig warmes Gefühl im ganzen Körper.
![]()
![]()
Nach der kleinen Stärkung geht’s zu Fuss weiter in die Breisacherstrasse Richtung Oetlingerstrasse, wo wir auf das Lebensmittellädelchen Maxi treffen. In diesem tamilischen Familienbetrieb wird man liebevoll von der Familie Suthan empfangen und freundlich beraten.
![]()
![]()
Nebst hippen Getränken wie Club Mate und Gazosa findet man hier natürlich auch indische Spezialitäten, darunter pikante Gewürzmischungen oder Teigprodukte wie Porotta sowie Samosa.
![]()
Wer immernoch nicht genug hat, sollte ganz in der Näher unbedingt Frau Devi einen Besuch abstatten. Ihr kleines Indien befindet sich in der Oetlingerstrasse 35. Frau Devi bietet nebst würzigem Pakora auch ein unglaublich leckeres Linsen Dal an und ist immer für ein kleines Schwätzchen zu haben.
![]()
![]()
![]()
Wir freuen uns darüber, unser Fernweh in unmittelbarer Nähe stillen zu können und dabei auch noch derart warmherzig empfangen zu werden. Ob Kroatien, die Türkei, Indien oder Afrika: all die wunderschöne kulturelle Vielfalt findet sich in Basel wieder.
Wir mögen die interessanten Einwanderer, welche unser Stadtbild schmücken und uns mit ihrem Dasein nicht nur kulinarisch sondern auch zwischenmenschlich bereichern. Vielen lieben Dank und einen Toast auf die Völkerwanderung und auf dass wir alle Erdlinge sind!
_
von Derya Cukadar und Ana Brankovic
am 17.11.2014
Fotos
© Wie wär's mal mit
Einer der wohl angenehmsten Nichtstuer-Tage ist der Sonntag - und dieser sollte am liebsten nie enden.
Wer kennt es nicht: Es ist 17 Uhr und man fragt sich, was man denn bloss Leckeres zum Znacht kochen soll - und vor allem: wo kriegt man an einem Sonntag in der Schweiz die nötigen Zutaten dazu? Wer nun glaubt, Spätis gäbe es nur in Berlin, der irrt sich gewaltig - Basel kann da locker mithalten. Wie wärs mal mit einem kulinarischen Sonntagsausflug rund um die Welt bis nach Indien?
Unseren ersten leckeren Zwischenhalt machen wir bei Familie Vivegananthan in der Küchengasse 9 am Bahnhof SBB. Dort warten exotische Köstlichkeiten wie frischer Fisch aus Sri Lanka, Gemüse und Früchte aus Thailand, Indien und Afrika, sowie unser absoluter Favorit: das exotische Knabberzeug wie z.B. gesalzene Bananenchips für den regelmässigen Tatort Fernsehabend am Sonntag.
Suru und Dekan, die beiden Geschwister aus Sri Lanka, helfen ihrem Vater gerne in seinem Lebensmittel Lädeli aus und sind eine sehr freundliche Anlaufstelle bei allerlei Fragen zu den noch unbekannten Produkten - welche übrigens in Nu unseren hungrigen Gaumen erobert haben.
Ihre kulturelle Offenheit und Zugänglichkeit färbt aber auch positiv auf die Kundschaft ab: hin und wieder bekommt man hier tolle Rezepte von netten Miteinkäufern zugesteckt, die man zuvor noch nie gesehen hat. Liebe scheint wohl tatsächlich durch den Magen zu gehen.
Vom kleinen Sri Lanka am Bahnhof SBB geht’s mit dem 30er Bus weiter zum Kontinent Indien beim Erasmusplatz. Kurz nachdem man den Basler Ganges via Johanniterbrücke überquert hat, stösst man auf den Imbiss Singh Indian Food. Auch wenn die Aussentemperatur nicht wie gwünscht tropisch mitspielt, zaubern einem die wahrscheinlich köstlichsten und knusprigsten Samosas der Stadt ein wohlig warmes Gefühl im ganzen Körper.
Nach der kleinen Stärkung geht’s zu Fuss weiter in die Breisacherstrasse Richtung Oetlingerstrasse, wo wir auf das Lebensmittellädelchen Maxi treffen. In diesem tamilischen Familienbetrieb wird man liebevoll von der Familie Suthan empfangen und freundlich beraten.
Nebst hippen Getränken wie Club Mate und Gazosa findet man hier natürlich auch indische Spezialitäten, darunter pikante Gewürzmischungen oder Teigprodukte wie Porotta sowie Samosa.
Wer immernoch nicht genug hat, sollte ganz in der Näher unbedingt Frau Devi einen Besuch abstatten. Ihr kleines Indien befindet sich in der Oetlingerstrasse 35. Frau Devi bietet nebst würzigem Pakora auch ein unglaublich leckeres Linsen Dal an und ist immer für ein kleines Schwätzchen zu haben.
Wir freuen uns darüber, unser Fernweh in unmittelbarer Nähe stillen zu können und dabei auch noch derart warmherzig empfangen zu werden. Ob Kroatien, die Türkei, Indien oder Afrika: all die wunderschöne kulturelle Vielfalt findet sich in Basel wieder.
Wir mögen die interessanten Einwanderer, welche unser Stadtbild schmücken und uns mit ihrem Dasein nicht nur kulinarisch sondern auch zwischenmenschlich bereichern. Vielen lieben Dank und einen Toast auf die Völkerwanderung und auf dass wir alle Erdlinge sind!
_
von Derya Cukadar und Ana Brankovic
am 17.11.2014
Fotos
© Wie wär's mal mit
Dena in der Kaserne Basel
Hört, hört, Basel sei auch eine tolle Musikstadt! Ob Hinterhof, SUD, die Lady Bar, Kaserne Basel oder das neu eröffnete Kaschemme: hier tummeln sich viele begnadete internationale sowie lokale Künstler.
![]()
Vor allem die altbewährte Kaserne Basel verzaubert diesen Herbst mit einem abwechslungsreichen und sorgfältig von Sandro Bernasconi ausgewählten Programm jeden Musikliebhaber und bietet dazu auch noch faire Eintrittspreise.
![]()
In angenehmer Atmosphäre kann man hier tolle Livemusik geniessen und sich davor in der Kabar oder in der EG Lounge gleich nebenan einen leckeren Drink gönnen.
![]()
Vergangene Woche war die talentierte und seit 10 Jahren in Berlin Kreuzberg wohnhafte Sängerin Dena zu Besuch in der Kaserne Basel. Für Wie wär’s mal mit nahm sich die Beyoncé liebende und bodenständige Bulgarin gemütlich Zeit für einen Kaffee sowie leckere Zuckerwatte von der Basler Herbstmesse und stand unserem allerersten Musikinterview sympathisch Rede und Antwort. Was uns Dena Spannendes zu erzählen hat, könnt ihr im Folgenden nachlesen.
Ana hat euch hier schon mal zur musikalischen Einstimmung via The Moonkids ein Mixtape mit Songs von Denas Lieblingslabel zusammengestellt.
![]()
Liebe Dena, wenn deine Musik ein Ort wäre, was wäre das für ein Ort?
Hmm, interessante Frage. Das wäre etwas wie ein Warteraum am Flughafen oder am Bahnhof, wo unterschiedliche interessante Menschen zusammenkommen. Ein Patientenwarteraum im Krankenhaus wäre ebenfalls treffend.
Und wenn es ein Tier wäre?
Es wäre irgendetwas Kleines, Schwirrendes - vielleicht ein Kolibri.
![]()
Dein Song Cash, Diamond Rings, Swimming Pools als leckeres Menü:
woraus bestünde dies?
Es gäbe auf jeden Fall Zuckerwatte zum Dessert.
Die Vorspeise wäre Brot mit Schafskäse und der Hauptgang Lachs mit Champagner und Kaviar (lacht).
Welchen deiner Songs performst du am liebsten auf der Bühne?
Ich mag Thin Rope sehr.
Aber auch Flashed macht mir riesen Spass.
![]()
![]()
Dena in 3 Worten?
Das wäre ein bisschen so, wie ein Selfie von seinen eigenen Sachen zu machen. Das ist für mich fast so schwer, wie Heidegger zu verstehen. Da fällt mir so spontan nix ein (lacht).
![]()
![]()
Deine Lieblingskünstler zurzeit?
Mein grösstes Idol ist definitiv Beyoncé, sie ist eine äusserst inspirierende Performerin. Aber ich mag momentan auch die Songs von Tinashe sehr.
Und die Musik von Drake geht natürlich immer.
Und was ist momentan auf deiner persönlichen Playlist ganz weit oben?
Danny L Harle - Broken Flowers. Ich liebe diesen Song so sehr. Ich habe ihn in einem Mixtape vom Label PC Music gehört und sofort Shazamed. Das Label mag ich sehr. Sie haben sehr interessante Acts und alles hört sich spannend an: es vereinen sich nämlich Musikrichtungen von Jungle bis hin zu Plastic Electronica.
![]()
Welcher Song macht dich so traurig, dass du weinen könntest?
Wenn du sowieso in einer melancholischen Stimmung bist, können alle Akkordwechsel und Lyrics dies bewirken. Die Musik von Sampha geht mir sehr Nahe. Ich finde ihn super und allgemein auch die Sachen von Producer Lil Silva.
![]()
Welche Fashion Show oder welchen Designer würdest du musikalisch begleiten?
Ich bin ein grosser Fan von Jean Paul Gaultier, aber ich glaube, ich habe dazu keine passenden Songs. Stella McCartney hat für Adidas eine Show mit Badeanzügen gemacht. Die Models waren Synchronschwimmerinnen und schwammen zu Cash, Diamond Rings, Swimming Pools in einem Wasserbecken - das war echt cool und hat mich sehr gefreut!
Ansonsten mag ich den Bulgarischen Designer Vladimir Karaleev sehr. Er wohnt zurzeit ebenfalls in Berlin und macht wunderschöne Mode.
Welchen 90s Song würdest du covern?
Oh, da hab ich so viele Lieblinge! Also sicher alle Destiny’s Child Songs. Und neuchlich dachte ich an den Song Stay von Liza Loeb, den ich auch sehr gerne covern würde. Dieser ist übrigens auf dem Soundtrack zum tollen Film Reality Bites mit Winona Ryder zu hören.
Wenn deine Musik ein Film oder ein Genre wäre, was würde da am besten passen?
Das wäre wahrscheinlich eine TV Serie, so was in Richtung HBO Girls. Die vielfältigen Protagonistinnen funktionieren zu viert prima, das gefällt mir. Ich mag Lena Dunham und ihre Art den Charakter Hannah zu spielen.
Wenn etwas anderes vom Himmel fallen könnte statt Regen, was wäre dies?
Das wären Vitamine und Mineralien - also am liebsten Gesundheit für alle! Ich glaube nämlich, es wäre zu krass, wenn es plötzlich Geld oderso vom Himmel regnen würde, das wäre echt schlimm.
Wie wär’s mal mit...
...Vitaminen und Mineralien?
![]()
Wir bedanken uns herzlichst bei Dena für das tolle Interview sowie ihre wunderbare Musik und natürlich auch bei der Kaserne Basel - insbesondere bei Sandro Bernasconi - für das Booking, welches uns dieses und viele weitere tolle Konzerte in Basel überhaupt möglich macht.
_
von Ana Brankovic und Derya Cukadar
am 10.11.2014
Fotos
© Wie wär's mal mit
Hört, hört, Basel sei auch eine tolle Musikstadt! Ob Hinterhof, SUD, die Lady Bar, Kaserne Basel oder das neu eröffnete Kaschemme: hier tummeln sich viele begnadete internationale sowie lokale Künstler.
Vor allem die altbewährte Kaserne Basel verzaubert diesen Herbst mit einem abwechslungsreichen und sorgfältig von Sandro Bernasconi ausgewählten Programm jeden Musikliebhaber und bietet dazu auch noch faire Eintrittspreise.
In angenehmer Atmosphäre kann man hier tolle Livemusik geniessen und sich davor in der Kabar oder in der EG Lounge gleich nebenan einen leckeren Drink gönnen.
Vergangene Woche war die talentierte und seit 10 Jahren in Berlin Kreuzberg wohnhafte Sängerin Dena zu Besuch in der Kaserne Basel. Für Wie wär’s mal mit nahm sich die Beyoncé liebende und bodenständige Bulgarin gemütlich Zeit für einen Kaffee sowie leckere Zuckerwatte von der Basler Herbstmesse und stand unserem allerersten Musikinterview sympathisch Rede und Antwort. Was uns Dena Spannendes zu erzählen hat, könnt ihr im Folgenden nachlesen.
Ana hat euch hier schon mal zur musikalischen Einstimmung via The Moonkids ein Mixtape mit Songs von Denas Lieblingslabel zusammengestellt.

Liebe Dena, wenn deine Musik ein Ort wäre, was wäre das für ein Ort?
Hmm, interessante Frage. Das wäre etwas wie ein Warteraum am Flughafen oder am Bahnhof, wo unterschiedliche interessante Menschen zusammenkommen. Ein Patientenwarteraum im Krankenhaus wäre ebenfalls treffend.
Und wenn es ein Tier wäre?
Es wäre irgendetwas Kleines, Schwirrendes - vielleicht ein Kolibri.
Dein Song Cash, Diamond Rings, Swimming Pools als leckeres Menü:
woraus bestünde dies?
Es gäbe auf jeden Fall Zuckerwatte zum Dessert.
Die Vorspeise wäre Brot mit Schafskäse und der Hauptgang Lachs mit Champagner und Kaviar (lacht).
Welchen deiner Songs performst du am liebsten auf der Bühne?
Ich mag Thin Rope sehr.
Aber auch Flashed macht mir riesen Spass.

Dena in 3 Worten?
Das wäre ein bisschen so, wie ein Selfie von seinen eigenen Sachen zu machen. Das ist für mich fast so schwer, wie Heidegger zu verstehen. Da fällt mir so spontan nix ein (lacht).
Deine Lieblingskünstler zurzeit?
Mein grösstes Idol ist definitiv Beyoncé, sie ist eine äusserst inspirierende Performerin. Aber ich mag momentan auch die Songs von Tinashe sehr.
Und die Musik von Drake geht natürlich immer.
Und was ist momentan auf deiner persönlichen Playlist ganz weit oben?
Danny L Harle - Broken Flowers. Ich liebe diesen Song so sehr. Ich habe ihn in einem Mixtape vom Label PC Music gehört und sofort Shazamed. Das Label mag ich sehr. Sie haben sehr interessante Acts und alles hört sich spannend an: es vereinen sich nämlich Musikrichtungen von Jungle bis hin zu Plastic Electronica.
Welcher Song macht dich so traurig, dass du weinen könntest?
Wenn du sowieso in einer melancholischen Stimmung bist, können alle Akkordwechsel und Lyrics dies bewirken. Die Musik von Sampha geht mir sehr Nahe. Ich finde ihn super und allgemein auch die Sachen von Producer Lil Silva.
Welche Fashion Show oder welchen Designer würdest du musikalisch begleiten?
Ich bin ein grosser Fan von Jean Paul Gaultier, aber ich glaube, ich habe dazu keine passenden Songs. Stella McCartney hat für Adidas eine Show mit Badeanzügen gemacht. Die Models waren Synchronschwimmerinnen und schwammen zu Cash, Diamond Rings, Swimming Pools in einem Wasserbecken - das war echt cool und hat mich sehr gefreut!
Ansonsten mag ich den Bulgarischen Designer Vladimir Karaleev sehr. Er wohnt zurzeit ebenfalls in Berlin und macht wunderschöne Mode.
Welchen 90s Song würdest du covern?
Oh, da hab ich so viele Lieblinge! Also sicher alle Destiny’s Child Songs. Und neuchlich dachte ich an den Song Stay von Liza Loeb, den ich auch sehr gerne covern würde. Dieser ist übrigens auf dem Soundtrack zum tollen Film Reality Bites mit Winona Ryder zu hören.
Wenn deine Musik ein Film oder ein Genre wäre, was würde da am besten passen?
Das wäre wahrscheinlich eine TV Serie, so was in Richtung HBO Girls. Die vielfältigen Protagonistinnen funktionieren zu viert prima, das gefällt mir. Ich mag Lena Dunham und ihre Art den Charakter Hannah zu spielen.
Wenn etwas anderes vom Himmel fallen könnte statt Regen, was wäre dies?
Das wären Vitamine und Mineralien - also am liebsten Gesundheit für alle! Ich glaube nämlich, es wäre zu krass, wenn es plötzlich Geld oderso vom Himmel regnen würde, das wäre echt schlimm.
Wie wär’s mal mit...
...Vitaminen und Mineralien?

Wir bedanken uns herzlichst bei Dena für das tolle Interview sowie ihre wunderbare Musik und natürlich auch bei der Kaserne Basel - insbesondere bei Sandro Bernasconi - für das Booking, welches uns dieses und viele weitere tolle Konzerte in Basel überhaupt möglich macht.
_
von Ana Brankovic und Derya Cukadar
am 10.11.2014
Fotos
© Wie wär's mal mit